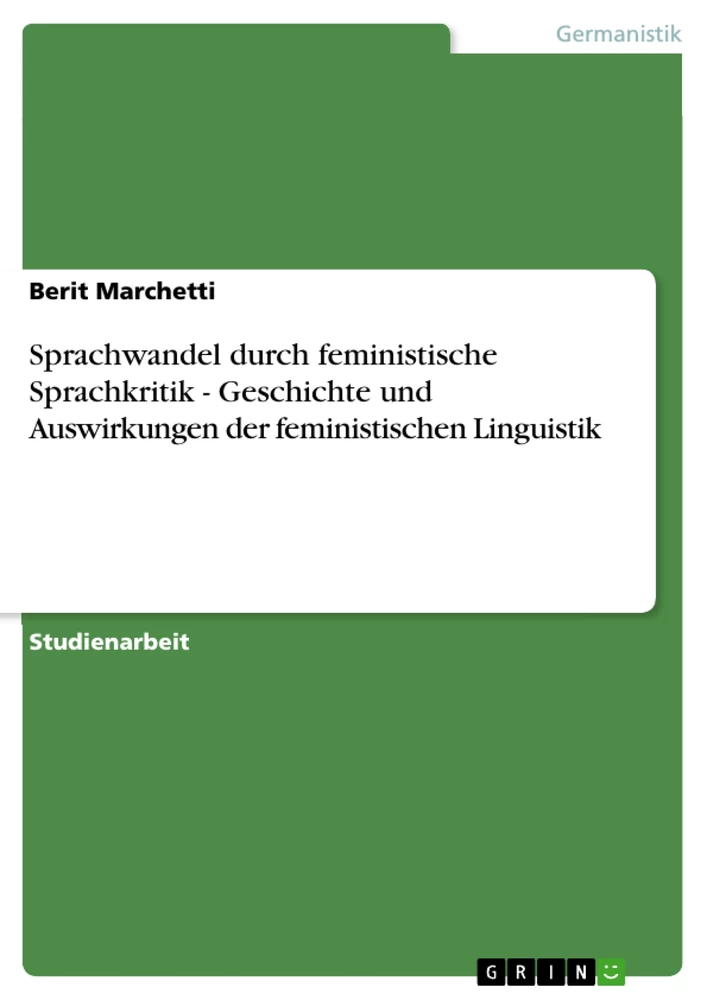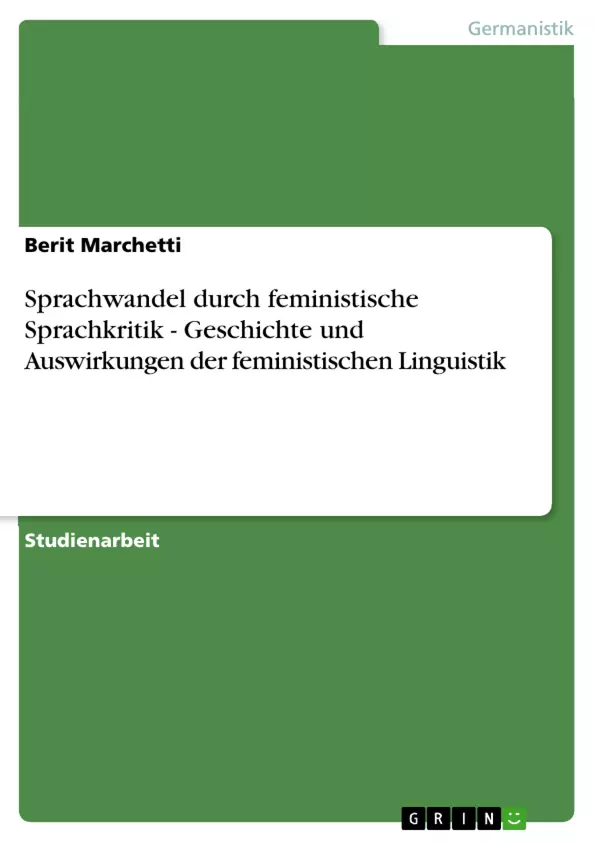Seit den 70er Jahren beschäftigen sich soziolinguistische Studien mit dem Thema Sprache und Geschlecht, bei dem zwei Bereiche zur Diskussion stehen. Zum einen steht das unterschiedliche Sprachverhalten von Männern und Frauen zur Debatte, die vor allem von Linguistinnen wie Senta Trömel-Plötz oder Robin Lakoff ins Rollen gebracht worden sind. Hier wird die Annahme gemacht, dass Frauen und Männer aufgrund ihrer unterschiedlichen Rollen in der Gesellschaft unterschiedliche Sprachverhalten an den Tag legen. Wir leben auch heute noch in einer patriarchalischen Welt, in der Frauen oft eine untergeordnete Position einnehmen, die unter anderem auch durch ihre Sprachgewohnheiten zum Ausdruck kommt.
Die These zur so genannten Frauensprache soll im folgenden insbesondere durch Arbeiten von Senta Trömel-Plötz und Ingrid Samel verdeutlicht werden.
Neben dieser Thematik wird aber auch seit längerem die deutsche Sprache von feministischen Linguisten und Linguistinnen daraufhin untersucht, inwieweit sie eine “Männersprache” darstellt, indem sie eine Weltsicht schafft, in der Frauen nicht präsent sind. Neben der schon genannten Senta Trömel-Plötz hat sich besonders Luise F. Pusch mit dieser Problematik beschäftigt und Lösungsvorschläge gegeben, wie der ständigen Präsenz der Männerdominanz insbesondere durch das generische Maskulinum im Deutschen entgegen zu wirken ist.
Beide Ansätze werden im folgenden näher erläutert werden. Anschließend werden weitere Lösungsvorschläge durch die UNESCO-Richtlinien und andere Institutionen aufgezeigt. Zum Schluss wird die Frage erörtert werden, inwieweit sich die Forderungen der Sprachkritik bis heute durchgesetzt haben und inwiefern der von den feministischen Linguistinnen geforderte Sprachwandel überhaupt sinnvoll ist.
Beginnen wird diese Arbeit nun mit einem kurzen Überblick über die Geschichte der feministischen Linguistik, um deren Anfänge und insbesondere deren Begründerinnen aufzuzeigen und unterschiedliche Herangehensweisen zu erläutern.
Inhaltsverzeichnis
- Feministische Linguistik
- Geschichte der feministischen Linguistik
- Der pragmatisch-kommunikative Aspekt der Sprachbetrachtung
- Senta Trömel-Plötz
- Gewalt durch Sprache
- Der systemtheoretische Aspekt der Sprachbetrachtung
- Luise F. Pusch
- Das generische Maskulinum
- Kritik am deutschen Sprachsystem
- UNESCO-Richtlinien für einen nicht-sexistischen Sprachgebrauch
- Sprachwandel durch feministische Sprachkritik
- Der Sinn von Sprachwandel durch feministische Sprachkritik
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der feministischen Sprachkritik und ihrer Auswirkungen auf den Sprachwandel. Es werden die Geschichte der feministischen Linguistik, ihre wichtigsten Vertreterinnen und ihre Argumente sowie die Kritik an der deutschen Sprache als "Männersprache" beleuchtet. Ziel ist es, die Geschichte und die wichtigsten Ansätze der feministischen Sprachkritik darzulegen und deren Relevanz für einen sprachlichen Wandel zu bewerten.
- Die Geschichte der feministischen Linguistik und ihre Begründerinnen
- Die These der "Frauensprache" und ihre Kritik
- Der systemtheoretische Ansatz der feministischen Sprachkritik und die Kritik am generischen Maskulinum
- Die Rolle der UNESCO-Richtlinien für einen nicht-sexistischen Sprachgebrauch
- Die Frage nach dem Sinn und der Wirksamkeit des Sprachwandels durch feministische Sprachkritik
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Anfänge der feministischen Linguistik und die zentralen Argumente der ersten Vertreterinnen wie Lakoff und Key. Es wird deutlich, dass die feministische Sprachkritik sich sowohl auf das unterschiedliche Sprachverhalten von Frauen und Männern als auch auf die "Männersprache" des deutschen Sprachsystems konzentriert.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Geschichte der feministischen Linguistik und stellt die zentralen Figuren wie Mary Ritchie Key, Robin Lakoff und Senta Trömel-Plötz vor. Es wird deutlich, dass die frühen Ansätze der feministischen Linguistik, die oft auf persönlichen Erfahrungen und Beobachtungen basierten, später durch empirische Forschung ergänzt wurden.
Das dritte Kapitel beschäftigt sich mit dem pragmatisch-kommunikativen Aspekt der Sprachbetrachtung und stellt die Arbeit von Senta Trömel-Plötz vor. Es wird argumentiert, dass Sprache durch Sexismus Gewalt auf Frauen ausübt und dass die "Frauensprache" als Ausdruck einer untergeordneten Position in der Gesellschaft zu verstehen ist.
Schlüsselwörter
Feministische Linguistik, Sprachwandel, Geschlechterdifferenz, "Frauensprache", "Männersprache", generisches Maskulinum, Sprachkritik, UNESCO-Richtlinien, Sexismus, Sprachliche Diskriminierung.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Ziel der feministischen Linguistik?
Sie untersucht, wie Sprache patriarchale Strukturen widerspiegelt und fordert einen Sprachwandel, der Frauen sichtbarer macht und Diskriminierung abbaut.
Warum wird das generische Maskulinum kritisiert?
Linguistinnen wie Luise F. Pusch argumentieren, dass das generische Maskulinum Frauen sprachlich unsichtbar macht und eine männlich dominierte Weltsicht zementiert.
Was versteht Senta Trömel-Plötz unter „Frauensprache“?
Sie beschreibt ein spezifisches Sprachverhalten von Frauen, das oft durch ihre untergeordnete gesellschaftliche Rolle geprägt ist und durch Kooperation statt Dominanz gekennzeichnet ist.
Gibt es internationale Richtlinien für geschlechtergerechte Sprache?
Ja, die UNESCO hat Richtlinien für einen nicht-sexistischen Sprachgebrauch veröffentlicht, um die Gleichstellung der Geschlechter in der Kommunikation zu fördern.
Hat die feministische Sprachkritik bereits zu Veränderungen geführt?
Ja, es hat ein Bewusstsein für sexistische Sprache stattgefunden, was sich in vielen Institutionen durch die Nutzung von Doppelnennungen oder neutralen Formulierungen zeigt.
Ist der geforderte Sprachwandel sinnvoll?
Die Arbeit erörtert, dass Sprache unser Denken beeinflusst. Ein Wandel zu mehr Inklusivität kann somit helfen, gesellschaftliche Realitäten und die Gleichstellung zu fördern.
- Citar trabajo
- Berit Marchetti (Autor), 2004, Sprachwandel durch feministische Sprachkritik - Geschichte und Auswirkungen der feministischen Linguistik, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64726