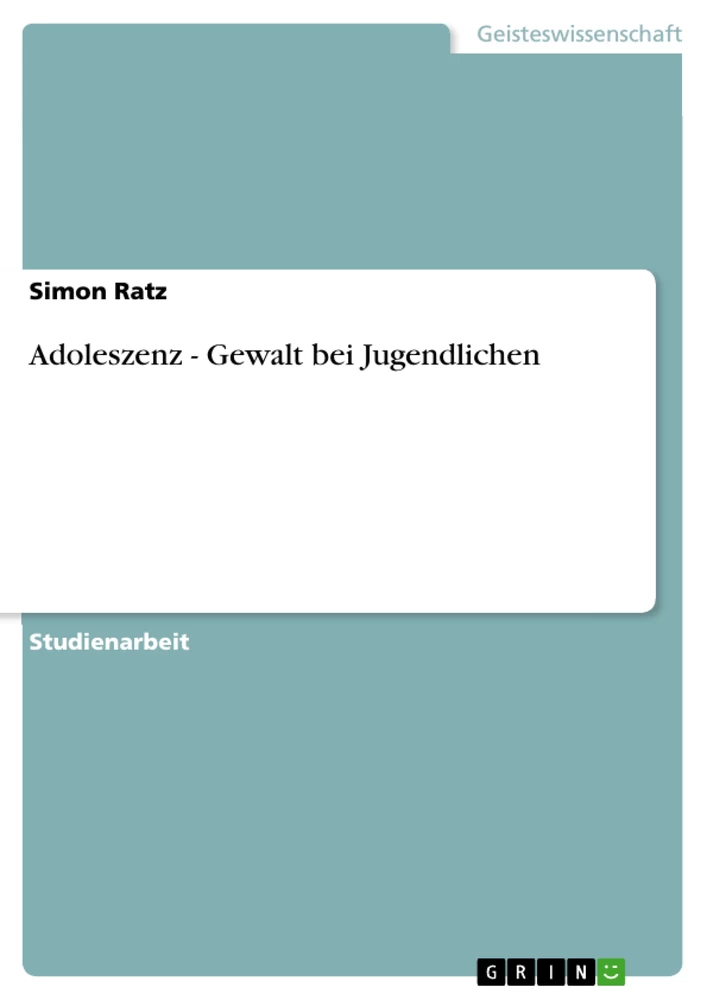Die Individuen, die sich benachteiligt fühlen, geschlagen, misshandelt werden, lassen häufig ein Verhaltensmuster erkennen. Sie treten oder schlagen ihrerseits irgendwann zurück, üben sich in Drohgebärden, verletzen andere ohne Rücksicht und Nachsicht. Der Gewalt-Exzess gibt oft den letzten, ultimativen „Kick“ als euphorisierende Zerstörung der Normen (vgl. Thomson 1999, vgl. hierzu das Verbrechen in der US-amerikan. Stadt Littleton/Denver im April 1999, das die amerikanische Nation aufrüttelte und bezüglich der Verbreitung von Waffen neu nachdenken ließ; vgl. FAZ vom 26.04.99: zwei Todesschützen hatten 12 Mitschüler und 1 Lehrer auf brutale Weise erschossen). Große Aufmerksamkeit genießen Medienberichte über jugendliche Gewaltaktionen. Diese sind jedoch Reportagen, die sensationalisierend auf die Verbrauchergunst abzielen. Hierbei wird aber kein Beitrag dazu geleistet, das diffuse, vielschichtige Phänomen „Jugendgewalt“ zu erklären. Ein Grund für dieses Defizit ist mit Sicherheit, dass die Medien mit Vorliebe Gewaltakte Jugendlicher gegen Asylbewerber und Ausländer thematisieren. Folglich werden Gewalttaten gegenüber anderen Bevölkerungsminderheiten vernachlässigt. Dies vermittelt wiederum den Eindruck, dass Jugendgewalt vornehmlich auf politische Intentionen basiert und zum größten Teil von „politisch motivierten“ Tätern extremistischer Gruppen verübt wird.
Die Erklärung von Jugendgewalt allein als Ausdruck gesellschaftlicher Basismechanismen (z. B. Geschlechterverhältnis oder Konkurrenz) und Krisen oder geschichtlicher Umbruchsituationen (z. B. Beitritt der DDR zur BRD) wird den oft trivialen Gewaltaktionen in der Jugendszene nicht gerecht. Was aus der Perspektive der pädagogischpsychologischen Jugendforschung im Vordergrund stehen muss, ist die Tatsache, dass es sich bei den Tätern um Jugendliche handelt, die in einer entscheidenden Phase ihrer Identitätsbildung stehen und Entwicklungsaufgaben mit altersspezifischen Mitteln zu bewältigen haben.
Wie kann man die Perspektive von jugendlichen Gewaltakteuren und Gewaltopfern begreifen? Das breite Spektrum von Jugendgewalt muss jedoch stets im Auge behalten werden. Welche Lebens- und Erfahrungskontexte bei Jugendlichen tragen zur Entwicklung von Gewaltakzeptanz und Gewaltbereitschaft bei und unter welchen Bedingungen führt Gewaltbereitschaft zur Beteiligung an Gewaltaktionen?
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gewaltakzeptanz, Gewaltbereitschaft und Gewalthandeln
- Familie, Persönlichkeit, Schule und Peers
- Fernsehen und Gewalt
- Visueller Analphabetismus
- Langeweile, Sehzwang und kollektive Abwehrversuche
- Psychische Wurzeln von Gewalt
- Entstehung von Feindbildstrukturen
- Abschlussbetrachtung
- Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Ursachen und Auswirkungen von Jugendgewalt und widmet sich dem komplexen Zusammenspiel zwischen familiären, sozialen und medialen Einflüssen, die zur Entwicklung von Gewaltakzeptanz, Gewaltbereitschaft und letztlich Gewalthandeln beitragen können.
- Die Rolle der Familie und des persönlichen Umfelds bei der Entstehung von Gewaltbereitschaft.
- Der Einfluss von Medien, insbesondere Fernsehen, auf die Entstehung von Gewaltakzeptanz und -bereitschaft.
- Die Herausbildung von Feindbildstrukturen und ihre Bedeutung im Kontext von Jugendgewalt.
- Die Bedeutung der Identitätsfindung im Jugendalter und ihr Einfluss auf die Bereitschaft zur Gewalt.
- Die unterschiedlichen Ebenen der Jugendgewalt: Akzeptanz, Verhaltensintentionen und Handeln.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit vor und beleuchtet die Problematik von Jugendgewalt im Kontext der gesellschaftlichen Debatte. Sie verdeutlicht die Relevanz der Thematik und die Notwendigkeit, das Phänomen Jugendgewalt aus unterschiedlichen Perspektiven zu beleuchten.
- Gewaltakzeptanz, Gewaltbereitschaft und Gewalthandeln: Dieses Kapitel befasst sich mit den verschiedenen Ebenen der Jugendgewalt. Es werden die Faktoren, die zur Akzeptanz und Bereitschaft zur Gewalt beitragen, sowie die Bedingungen, unter denen diese zur Teilnahme an Gewaltaktionen führen können, untersucht.
- Familie, Persönlichkeit, Schule und Peers: Hier wird der Einfluss des familiären Umfelds auf die Entwicklung von Gewaltbereitschaft bei Jugendlichen analysiert. Es werden interaktionale und ökonomische Variablen betrachtet, die in Bezug zur Gewaltbereitschaft stehen können.
- Fernsehen und Gewalt: Dieses Kapitel beleuchtet den Einfluss von Fernsehen auf die Gewaltbereitschaft von Jugendlichen. Die Arbeit thematisiert den Zusammenhang zwischen visueller Medienrezeption und der Entstehung von Gewaltakzeptanz und -bereitschaft.
Schlüsselwörter
Jugendgewalt, Gewaltakzeptanz, Gewaltbereitschaft, Gewalthandeln, Familie, Persönlichkeit, Schule, Peers, Fernsehen, Medien, Feindbildstrukturen, Identitätsentwicklung, psychische Wurzeln von Gewalt, visuell Analphabetismus, Langeweile, Sehzwang, kollektive Abwehrversuche.
Häufig gestellte Fragen
Welche Faktoren tragen zur Entstehung von Jugendgewalt bei?
Ein komplexes Zusammenspiel aus familiären Einflüssen, Persönlichkeitsmerkmalen, schulischen Erfahrungen, dem Einfluss von Gleichaltrigen (Peers) und medialen Faktoren.
Wie beeinflussen Medien die Gewaltbereitschaft?
Die Arbeit thematisiert "visuellen Analphabetismus" und die Wirkung von gewalthaltigen Fernsehinhalten, die zur Abstumpfung oder zur Entwicklung von Gewaltakzeptanz führen können.
Was versteht man unter "Feindbildstrukturen"?
Dies beschreibt die mentale Konstruktion von Gegnern, oft basierend auf politischen oder sozialen Vorurteilen, die als Rechtfertigung für gewalttätiges Handeln dienen können.
Warum ist die Identitätsbildung im Jugendalter entscheidend?
Jugendliche stehen in einer Phase, in der sie Entwicklungsaufgaben bewältigen müssen. Gewalt kann dabei fälschlicherweise als Mittel zur Identitätsstiftung oder Kompensation von Benachteiligung genutzt werden.
Können Medienberichte das Problem verschärfen?
Ja, sensationsorientierte Berichterstattung kann ein verzerrtes Bild von Jugendgewalt vermitteln und trägt oft wenig zur Aufklärung der vielschichtigen Ursachen bei.
- Citar trabajo
- Simon Ratz (Autor), 2005, Adoleszenz - Gewalt bei Jugendlichen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64779