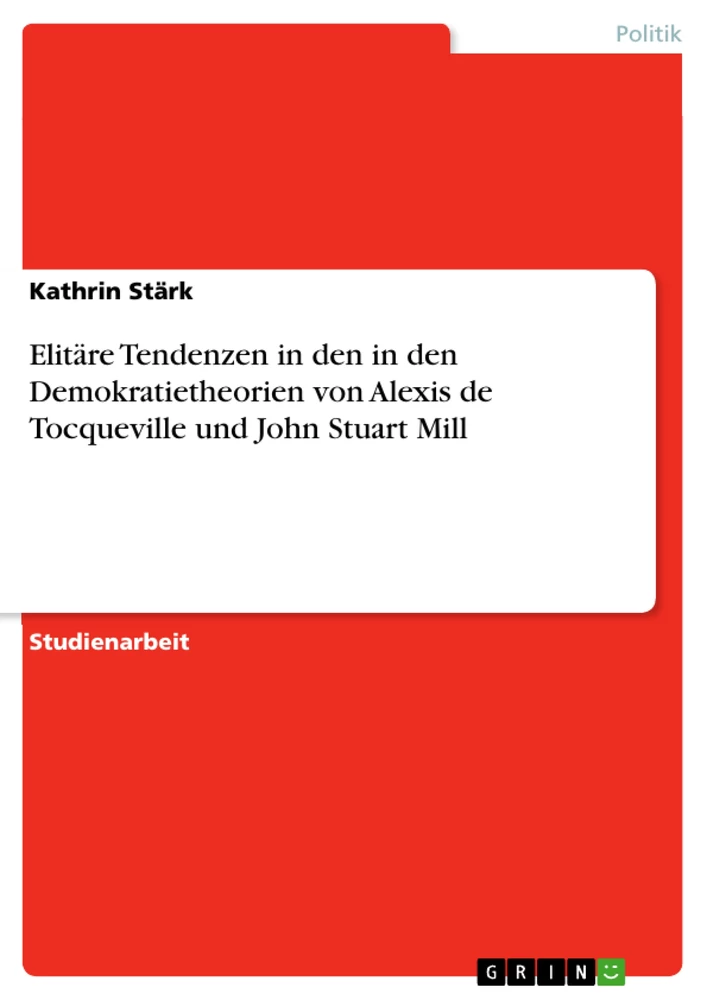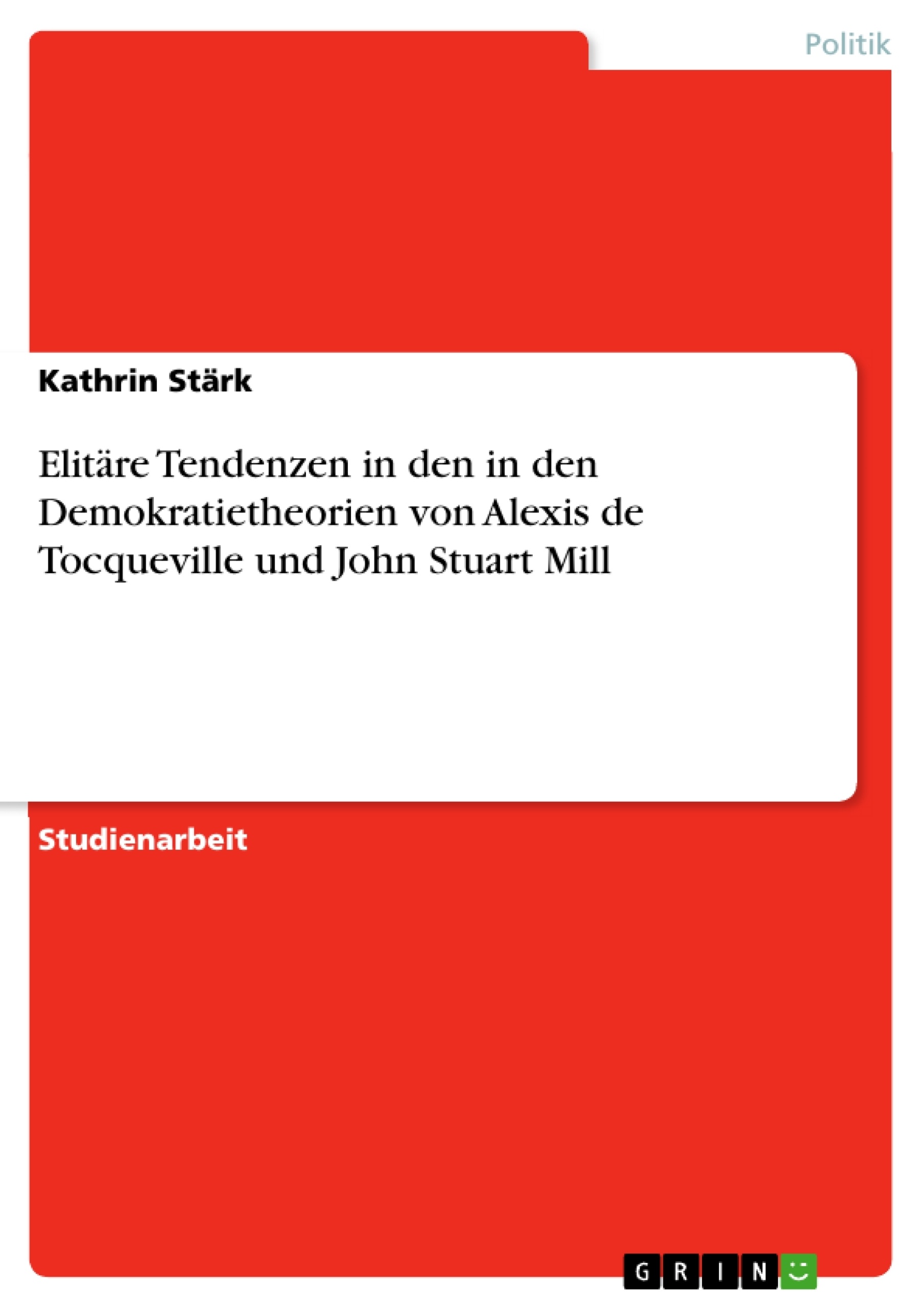Winston Churchill: "Demokratie ist die schlechteste aller Regierungsformen - abgesehen von all den anderen Formen, die von Zeit zu Zeit ausprobiert worden sind."
Die Demokratie ist die beste Staatsform, die wir kennen; dennoch ist sie nicht die Idealform. Die „Herrschaft des Volkes“ als die Demokratie gerne beschrieben wird, gibt es weder heute noch gab es sie zu Zeiten als die klassischen Demokratietheorien verfasst wurden. Während die ältere Staatsformenlehre von einer direkten Demokratie ausgeht, wie sie in der griechischen Polis zu finden war, gründet demokratische Herrschaft heute auf dem Prinzip der Volkssouveränität und der politischen Gleichheit - unabhängig von Geschlecht, Rasse und Konfession. So wenig wie es die Demokratie gibt, so wenig gibt es auch die Demokratietheorie. Vielmehr entpuppt sich die Demokratie als eine Herrschaft der Mehrheit über eine Minderheit, in der die Frage des Abstimmungsmodus entscheidend ist. Entscheidungsprozesse orientieren sich am Ideal der Kompromissfindung; ob dieser Kompromiss nun eine absolute, einfache, qualifizierte Mehrheit oder Einstimmigkeit verlangt, ist eine Frage der Sichtweise. Demokratischen Systemen wird häufig eine Tendenz zum Verharren im Status Quo nachgesagt. Als Alternative kann eine direkte Demokratie gesehen werden, was jedoch in großen Flächenstaaten und angesichts der großen Komplexität der Entscheidungen unmöglich zu verwirklichen ist. So gelangt man zwangsläufig zum Modell der repräsentativen Demokratie; wobei auch diese Staatsform neuralgische Punkte aufweist. Zum einen die Schnittstelle zwischen Repräsentierten und Repräsentanten; sowie innerhalb des Regierungssystems die Beziehung zwischen den politisch Herrschenden. In der vorliegenden Arbeit sollen nun die Demokratietheorien von Alexis de Tocqueville und John Stuart Mill näher betrachtet werden, die beide als Vordenker der Repräsentativdemokratie im 19. Jahrhundert gelten. Während bei Tocqueville kein einheitlich liberales Gedankengebäude zu erkennen ist, kann Mill eindeutig als liberal eingestuft werden.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Demokratietheorien von Tocqueville und Mill
- Zielkonflikt zwischen Freiheit und Gleichheit: Alexis de Tocqueville als Theoretiker der Massendemokratie
- Siegeszug der Demokratie
- Tocquevilles Freiheitsbegriff
- Spannungsfeld von Freiheit und Gleichheit
- Zentralisation der Verwaltung
- Der ,,Liberale einer neuen Art''
- John Stuart Mills liberale Theorie der Repräsentativdemokratie
- Demokratietheoretische Wurzeln
- Gefahren der „alten Demokratie“
- Bedingungen des Wahlrechts
- Mills Freiheitsprinzip
- Partizipation und Repräsentation in Mills Idealstaat
- Sozialisations- und Kompetenzsteigerungseffekte durch politische Partizipation
- Zielkonflikt zwischen Freiheit und Gleichheit: Alexis de Tocqueville als Theoretiker der Massendemokratie
- Elitäre Strukturen bei Tocqueville und Mill
- Zum Begriff der Eliten
- Klassische Elitetheorien
- Die liberale Elitentheorie
- Zwischenfazit
- Tocquevilles Auffassung von der Elite als intermediäre Instanz
- Mill zwischen Sozialliberalismus und Elitenherrschaft
- Zum Begriff der Eliten
- Fazit: Unterschiede Tocqueville – Mill
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit beschäftigt sich mit den Demokratietheorien von Alexis de Tocqueville und John Stuart Mill und analysiert deren elitäre Tendenzen. Die Arbeit zielt darauf ab, die Konzepte der beiden Denker im Kontext der repräsentativen Demokratie des 19. Jahrhunderts zu beleuchten und ihre Ansichten über die Rolle von Eliten im politischen System zu untersuchen.
- Der Siegeszug der Demokratie und die damit einhergehenden Herausforderungen für Freiheit und Gleichheit.
- Die Entwicklung des liberalen Freiheitsbegriffs bei Tocqueville und Mill.
- Die Bedeutung von Repräsentation und Partizipation in den Demokratietheorien der beiden Autoren.
- Die Rolle von Eliten in den politischen Systemen nach Tocqueville und Mill.
- Die Unterschiede und Gemeinsamkeiten in den elitentheoretischen Ansätzen von Tocqueville und Mill.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel erläutert die Demokratietheorien von Tocqueville und Mill, wobei insbesondere der Zielkonflikt zwischen Freiheit und Gleichheit im Fokus steht. Tocquevilles Analyse des „Siegeszugs der Demokratie“ in den Vereinigten Staaten und seine kritischen Beobachtungen zur Entwicklung der Massendemokratie werden dargestellt. John Stuart Mills liberale Theorie der Repräsentativdemokratie wird in ihren Grundzügen vorgestellt, wobei insbesondere die Frage nach den Bedingungen des Wahlrechts und der Partizipation im Zentrum der Betrachtung steht.
Das dritte Kapitel befasst sich mit den elitären Strukturen in den Demokratietheorien von Tocqueville und Mill. Es werden klassische Elitetheorien sowie die liberale Elitentheorie als theoretischer Hintergrund beleuchtet. Die Arbeit untersucht, wie Tocqueville die Elite als intermediäre Instanz im politischen System sah und welche elitären Elemente in Mills Konzept der Repräsentativdemokratie erkennbar sind.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit den zentralen Begriffen der Demokratietheorie, der Repräsentativdemokratie, dem Freiheitsbegriff, der Gleichheit und der Rolle von Eliten im politischen System. Darüber hinaus werden wichtige Konzepte aus den Werken von Tocqueville und Mill beleuchtet, wie z.B. der Siegeszug der Demokratie, die Gefahren der „alten Demokratie“, die Bedeutung von Partizipation und die Funktionsweise von intermediären Instanzen.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die zentralen Unterschiede zwischen Tocqueville und Mill?
Tocqueville analysierte primär die Gefahren der Massendemokratie (Tyrannei der Mehrheit), während Mill die repräsentative Demokratie als Mittel zur Kompetenzsteigerung der Bürger sah.
Was verstand Tocqueville unter der "Tyrannei der Mehrheit"?
Es beschreibt die Gefahr, dass in einer Demokratie die Mehrheit die individuellen Freiheiten und Meinungen der Minderheit unterdrückt, was zu Konformismus führt.
Welche elitären Tendenzen finden sich bei John Stuart Mill?
Mill schlug unter anderem ein Pluralwahlrecht vor, bei dem gebildete Bürger mehr Stimmen erhalten sollten, um die Qualität der politischen Entscheidungen zu sichern.
Was ist eine repräsentative Demokratie im Sinne des 19. Jahrhunderts?
Es ist ein System, in dem das Volk nicht direkt herrscht, sondern gewählte Repräsentanten Entscheidungen treffen, wobei die Schnittstelle zwischen Volk und Elite entscheidend ist.
Warum sah Tocqueville die Elite als "intermediäre Instanz"?
Er glaubte, dass bestimmte gesellschaftliche Gruppen (wie Juristen oder lokale Eliten) als Puffer zwischen dem Staat und der Masse dienen können, um die Freiheit zu schützen.
- Citation du texte
- Kathrin Stärk (Auteur), 2006, Elitäre Tendenzen in den in den Demokratietheorien von Alexis de Tocqueville und John Stuart Mill, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64819