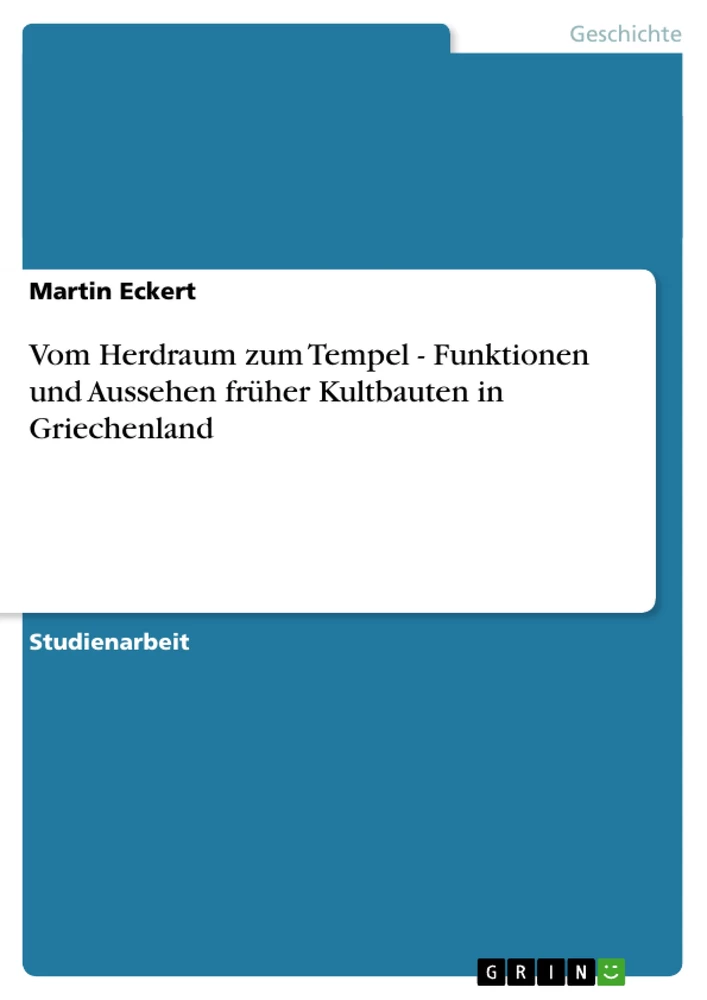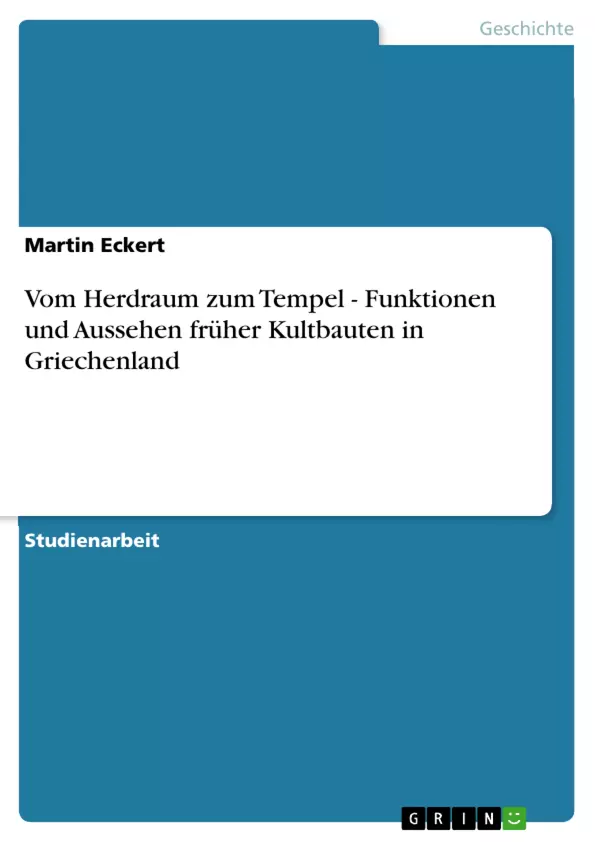Die Frage nach den Entwicklungslinien, die von der frühen griechischen Baukunst zum Peripteraltempel der archaischen und klassischen Zeit führen, wurde in der älteren Forschung zuerst mit dem Versuch einer morphologischen Ableitung aus früheren griechischen Gebäudetypen beantwortet. Insbesondere glaubte man, im Megaron des mykenischen Palastes und den Lang- bzw. Antenhäusern der protogeometrischen und geometrischen Zeit einen baulichen Vorläufer für die langgestreckt-rechteckige Form der Cella des sich seit der 1. Hälfte des 7. Jhs. im griechischen Kulturraum weiträumig verbreitenden Ringhallentempels gefunden zu haben. Als der Versuch einer morphologischen Herleitung des Ringhallentempels vor der unkanonischen, überraschenden Vielgestaltigkeit der frühen Baukunst kapitulieren musste und gleichzeitig der Vergleich der funktionalen und liturgischen Eigenschaften geometrischer Kultbauten mit denen der Peripteroi tiefgreifende Unterschiede zu Tage gefördert hatte, begann man, nach den sozialgeschichtlichen Ursachen zu fragen, die im Übergang von der geometrischen zur archaischen Epoche einen Wandel in der Kultpraxis bewirkt und damit gänzlich neuartige, diesen gewandelten Bedürfnissen strukturell entsprechende Sakralbauten notwendig gemacht hatten. Die vorliegende Arbeit macht es sich zur Aufgabe, die Befundlage unter morphologischen Gesichtspunkten zu ordnen und die architektonischen Strukturmerkmale der frühen Kultbauten hinsichtlich ihrer Übertragbarkeit auf den kanonischen Ringhallentempel zu untersuchen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Forschungsgeschichte
- 2. Quellen
- 3. Formen und Funktionen
- 4. Morphologie
- 4.1 Mykenische Megara: Eleusis und Tiryns
- 4.2 Oval- und Rundhäuser: Lathouresa
- 4.3 Langhäuser mit Apsiden: Antissa, Nichoria, Eretria
- 4.4 Prototypen der Peristase? Thermos, Samos, Lefkandi
- 4.5 Rechtwinklige Herdhäuser: Dreros, Prinias, Perachora, Thasos
- 4.6 Mehrzellige Oikoi: Eleusis, Athen, Porto Cheli
- 4.7 Ländliche Kapellen
- 5. Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die morphologischen Merkmale früher griechischer Kultbauten und deren mögliche Beziehung zum klassischen Peripteraltempel. Sie ordnet die Befundlage und analysiert architektonische Strukturen hinsichtlich ihrer Übertragbarkeit auf den kanonischen Tempeltyp.
- Entwicklungslinien der griechischen Tempelarchitektur
- Funktionen früher Kultbauten (kultisch, sozial, administrativ)
- Typologie und Morphologie frühgriechischer Gebäude
- Vergleich verschiedener Bauformen und ihrer regionalen Variationen
- Der Einfluss orientalischer und ägyptischer Tempelarchitektur
Zusammenfassung der Kapitel
1. Forschungsgeschichte: Die frühere Forschung versuchte, den Peripteraltempel morphologisch aus früheren griechischen Gebäudetypen abzuleiten, insbesondere dem mykenischen Megaron und Lang-/Antenhäusern. Diese Vorstellung einer linearen Entwicklung wurde jedoch aufgrund neuerer Befunde und funktionsanalytischer Überlegungen stark kritisiert. Die aktuelle Forschung nähert sich wieder einem morphologischen Ansatz, berücksichtigt aber auch funktionsanalytische und sozialgeschichtliche Aspekte, und sieht Vorbilder im orientalischen und ägyptischen Tempelbau. Diese Arbeit zielt auf eine geordnete Darstellung der Befunde unter morphologischen Gesichtspunkten und untersucht die Übertragbarkeit architektonischer Merkmale auf den Ringhallentempel.
2. Quellen: Die Arbeit diskutiert die Quellenlage, die sich als spärlich erweist. Die archäologische Befundlage wird anhand der Arbeiten von Nilsson, Sinos und Drerup dargestellt, wobei die Typologie von Drerup durch Mazarakis-Ainian ergänzt wird. Die Grabungsergebnisse zu frühen Ringhallentempeln sind teilweise noch unvollständig publiziert. Zeitgenössische literarische Quellen, wie Homer, die homerischen Hymnen, Pindar und Herodot, liefern nur bruchstückhafte Informationen. Vitruv bietet Beschreibungen, deren Quellenlage jedoch unsicher ist. Epigraphische Nachweise werden anhand der Arbeiten von Hägg beleuchtet.
3. Formen und Funktionen: Frühe Sakralbauten unterschieden sich von späteren Ringhallentempeln in Form und Funktion. Es gab keine eindeutige Unterscheidung zwischen profanen und sakralen Bauten. Minoische und mykenische "Palast-Heiligtümer" vereinigten profane und kultische Funktionen. Das mykenische Megaron diente sowohl sozialen als auch religiösen Zwecken. Im Gegensatz dazu kennzeichneten in der archaischen und klassischen Zeit Temenos und Altar die Heiligtümer, der Tempel war ein repräsentatives, aber nicht konstitutives Element. Die Opferhandlungen verlagerten sich aus dem Innenraum auf den Platz vor Tempel und Altar, und die Rolle des Basileus als kultische Bezugsperson ging auf den Priester über.
4. Morphologie: Dieses Kapitel bietet eine Typologie früher, kultisch genutzter Gebäude von der mykenischen bis zur geometrischen Zeit, basierend auf Drerup (1969). Es analysiert verschiedene Bauformen (Megara, Oval- und Rundhäuser, Langhäuser mit Apsiden, rechtwinklige Herdhäuser, mehrzellige Oikoi, ländliche Kapellen) unter Berücksichtigung ihrer funktionalen und sozialen Aspekte. Die Identifizierung sakraler Bezüge erfolgt anhand von Elementen wie Herden, Podien, Bänken, Ascheschichten und Speiseresten. Die Kapitel 4.1 - 4.7 beschreiben und analysieren einzelne Beispiele dieser Typologien, diskutieren deren Datierung, Funktion und Bedeutung im Kontext der Entwicklung der Tempelarchitektur.
Schlüsselwörter
Griechische Tempelarchitektur, frühgriechische Baukunst, Mykenische Kultur, geometrische Periode, archaische Periode, Kultbauten, Megaron, Langhaus, Peripteros, Ringhallentempel, Funktion, Morphologie, Sozialgeschichte, Kultpraxis, Orientalischer Einfluss, Opfer, Heiligtum, Temenos, Altar.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Morphologische Entwicklung frühgriechischer Kultbauten
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht die morphologischen Merkmale früher griechischer Kultbauten und deren mögliche Beziehung zum klassischen Peripteraltempel. Sie analysiert architektonische Strukturen hinsichtlich ihrer Übertragbarkeit auf den kanonischen Tempeltyp und beleuchtet dabei Entwicklungslinien der griechischen Tempelarchitektur, Funktionen früher Kultbauten (kultisch, sozial, administrativ), Typologie und Morphologie frühgriechischer Gebäude, regionale Variationen und den Einfluss orientalischer und ägyptischer Tempelarchitektur.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit und worum geht es in ihnen?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Kapitel 1 behandelt die Forschungsgeschichte zur Entwicklung des griechischen Tempels und die Kritik an früheren, linear-entwicklungsorientierten Ansätzen. Kapitel 2 beschreibt die oft spärliche Quellenlage, bestehend aus archäologischen Befunden und literarischen Quellen (Homer, Herodot etc.). Kapitel 3 untersucht Formen und Funktionen früher Sakralbauten und den Unterschied zu späteren Tempeln, betont die oft vermischten profanen und sakralen Nutzungen und den Wandel kultischer Praktiken. Kapitel 4, der Schwerpunkt der Arbeit, bietet eine detaillierte morphologische Typologie früher Kultbauten (Megara, Rundhäuser, Langhäuser etc.) mit zahlreichen Beispielen (Eleusis, Tiryns, Lathouresa etc.). Kapitel 5 fasst die Ergebnisse zusammen und gibt einen Ausblick.
Welche Bauformen werden im Detail analysiert?
Kapitel 4 bietet eine detaillierte Analyse verschiedener Bauformen: Mykenische Megara (Eleusis und Tiryns), Oval- und Rundhäuser (Lathouresa), Langhäuser mit Apsiden (Antissa, Nichoria, Eretria), mögliche Prototypen der Peristase (Thermos, Samos, Lefkandi), rechtwinklige Herdhäuser (Dreros, Prinias, Perachora, Thasos), mehrzellige Oikoi (Eleusis, Athen, Porto Cheli) und ländliche Kapellen. Die Analyse berücksichtigt jeweils Datierung, Funktion und Bedeutung im Kontext der Tempelentwicklung.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Arbeit stützt sich auf archäologische Befunde, die hauptsächlich durch die Arbeiten von Nilsson, Sinos und Drerup dargestellt werden, ergänzt durch Mazarakis-Ainian. Die Grabungsergebnisse zu frühen Ringhallentempeln sind teilweise noch unvollständig publiziert. Literarische Quellen wie Homer, die homerischen Hymnen, Pindar und Herodot liefern nur bruchstückhafte Informationen. Vitruv wird ebenfalls berücksichtigt, seine Quellenlage ist jedoch unsicher. Epigraphische Nachweise werden anhand der Arbeiten von Hägg beleuchtet.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit am besten?
Die wichtigsten Schlüsselwörter sind: Griechische Tempelarchitektur, frühgriechische Baukunst, Mykenische Kultur, geometrische Periode, archaische Periode, Kultbauten, Megaron, Langhaus, Peripteros, Ringhallentempel, Funktion, Morphologie, Sozialgeschichte, Kultpraxis, Orientalischer Einfluss, Opfer, Heiligtum, Temenos, Altar.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt auf eine geordnete Darstellung der Befunde zu frühgriechischen Kultbauten unter morphologischen Gesichtspunkten und untersucht die Übertragbarkeit architektonischer Merkmale auf den Ringhallentempel. Sie hinterfragt frühere, linear-entwicklungsorientierte Ansätze und integriert funktionsanalytische und sozialgeschichtliche Aspekte.
- Quote paper
- Martin Eckert (Author), 2005, Vom Herdraum zum Tempel - Funktionen und Aussehen früher Kultbauten in Griechenland, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64874