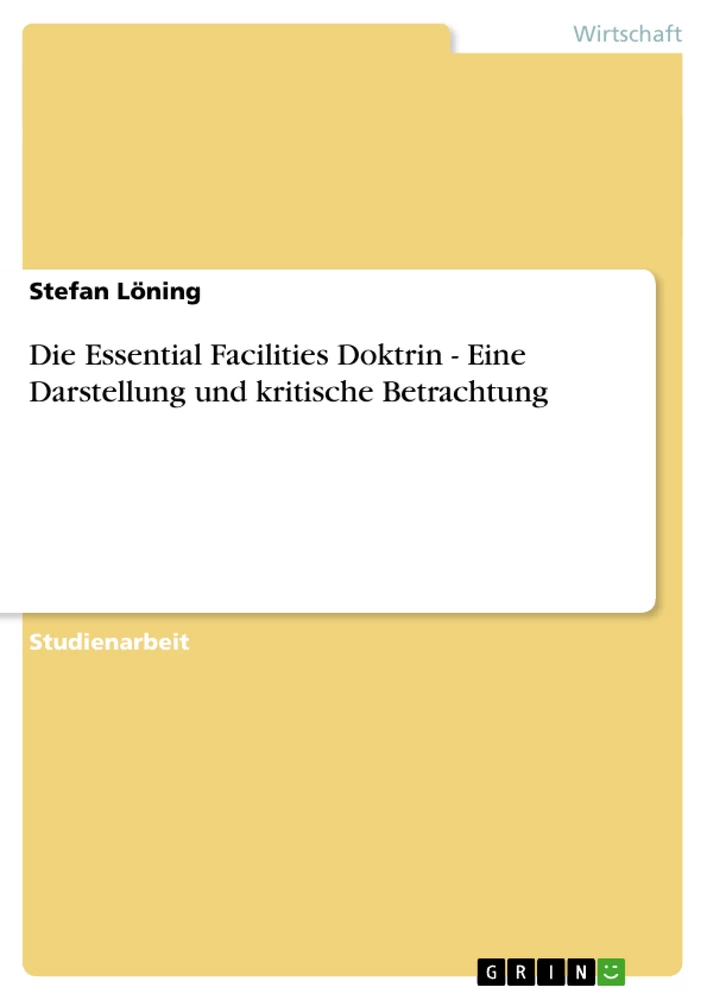In den letzten Jahren nutzte Microsoft seine marktführende Position vor allem über die Plattform „Windows“ mehrfach aus, um bspw. den „Media Player“ oder die Internetsuchmaschine „MSN“ gegenüber Konkurrenzprodukten zu begünstigen. Dies ist nur ein Beispiel für den Missbrauch einer marktbeherrschenden Stellung und der Weigerung, den Mitbewerbern den Zugang zu einer wesentlichen Einrichtung (Essential Facility) zu gewähren. Primär geht es also um Märkte, auf denen sich (potentielle) Wettbewerber nur über die Mitbenutzung einer wesentlichen Einrichtung betätigen können, da der Aufbau einer ähnlichen, parallelen Einrichtung zu kostspielig oder unmöglich ist.
Die vorliegende Arbeit charakterisiert zu Beginn die Begriffe der Essential Facility und der Essential Facilities Doktrin (EFD) näher. Diesem folgt eine nähere Betrachtung von Monopolen aus volkswirtschaftlicher Sicht. Da die EFD einerseits aus dem Bereich der Vereinigten Staaten stammt und auf deutscher und europäischer Ebene eine zeitlich versetzte Übernahme stattfand und andererseits die Doktrin auf völlig unterschiedlichen Rechtsgrundlagen fußt, wird im Anschluss eine getrennte Darstellung der Entwicklung und Anwendung der EFD im amerikanischen und insbesondere im deutschen und europäischen Recht vorgenommen. Diese Darstellung soll keine, wie in der Literatur oftmals zu findende, bloße Aneinanderreihung von Urteilen sein, sondern vor allem die Schlüsselbegriffe der relevanten Rechtsnormen charakterisieren, auf die die Grundsätze der EFD angewandt werden. Der reinen Beschreibung folgt eine explizite Herausarbeitung der Unterschiede der einzelnen Ausprägungsvarianten. Die Frage, ob man überhaupt von EINER Essential Facilities Doktrin sprechen kann, soll zum Ende dieser Abhandlung genauso kritisch hinterfragt werden, wie die Untersuchung auf die praktische Relevanz der Doktrin.
Primäres Ziel der Arbeit ist also nicht die reine Beschreibung der EFD und ihre Auswirkung in der Rechtsprechung. Vielmehr soll im ersten Teil die unterschiedliche rechtliche Implementierung der Grundsätze der EFD und die Auswirkungen auf Urteile und Entscheidungen aufgezeigt werden. Der zweite Teil nimmt dann mehrere im ersten Teil herausgearbeitete Feststellungen auf, um auf Grundlage dieser dem Kern der Arbeit in Form weitergehender Fragen, wie nach der Einheitlichkeit und der Vereinbarkeit der EFD mit der Definition der Doktrin und vor allem der Bedeutung der EFD über die Literatur hinweg auf den Grund zu gehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung und Begriffsbestimmungen
- Problemstellung und Ziel der Arbeit
- Der Begriff der Essential Facility und der Essential Facilities Doktrin
- Charakterisierung von Monopolen
- Die Essential Facilities Doktrin im US-Amerikanischen Anti-Trust-Recht
- Die frühesten Wurzeln
- Die Essential Facilities Doktrin als Ausnahme zur Geschäftspartnerwahlfreiheit
- Die Essential Facilities im deutschen Kartellrecht
- Die erstmalige gesetzliche Verankerung der Thematik
- Der § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB
- Die Tatbestandsmerkmale der deutschen Essential Facilities Doktrin
- Marktbeherrschendes Unternehmen
- Zugangsverweigerung trotz angemessenem Entgelt
- Netze und andere Infrastruktureinrichtungen
- Unmöglichkeit des Zugangs
- Vor- und nachgelagerte Märkte
- Mögliche Rechtfertigungsgründe
- Die Essential Facilities im europäischen Kartellrecht
- Verhältnis des europäischen zum deutschen Kartellrecht
- Die Anfänge der europäischen Essential Facilities Doktrin
- Der Artikel 82 EG
- Die wesentlichen Merkmale der europäischen Essential Facilities Doktrin
- Definition des relevanten Marktes
- Missbräuchliches Ausnutzen
- Die beherrschende Stellung
- Der Begriff der Einrichtung und deren Wesentlichkeit
- Mögliche Rechtfertigungsgründe
- Eine rechtsvergleichende Betrachtung
- Die deutsche vers. die europäische Variante der Essential Facilities Doktrin
- Existiert eine einheitliche Essential Facilities Doktrin ?
- Die praktische Relevanz der Essential Facilities Doktrin
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit befasst sich mit der Essential Facilities Doktrin, einem wichtigen Instrument des Kartellrechts zur Regulierung von marktbeherrschenden Unternehmen. Das Ziel der Arbeit ist es, die Doktrin sowohl im deutschen als auch im europäischen Recht zu analysieren und zu vergleichen, um deren praktische Relevanz zu beleuchten.
- Die Entstehung und Entwicklung der Essential Facilities Doktrin in verschiedenen Rechtsordnungen
- Die rechtlichen Grundlagen und Tatbestandsmerkmale der Doktrin
- Die Anwendung der Doktrin in der Praxis, insbesondere in Bezug auf die Regulierung von Infrastruktureinrichtungen
- Der Vergleich der Essential Facilities Doktrin im deutschen, europäischen und amerikanischen Kartellrecht
- Die Relevanz der Doktrin für die Gewährleistung eines wettbewerbsorientierten Marktes
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Thematik der Essential Facilities Doktrin. Sie definiert die wesentlichen Begriffe und erläutert den Hintergrund der Doktrin. Anschließend wird die Entstehung und Entwicklung der Doktrin im US-amerikanischen Anti-Trust-Recht betrachtet. Die Arbeit analysiert die Doktrin im deutschen Kartellrecht, wobei sie sich insbesondere mit dem § 19 Abs. 4 Nr. 4 GWB befasst. Im weiteren Verlauf wird die Essential Facilities Doktrin im europäischen Kartellrecht beleuchtet. Hierbei werden die relevanten Rechtsgrundlagen und die Anwendung der Doktrin in der Praxis untersucht. Die Arbeit schließt mit einer rechtsvergleichenden Betrachtung der Doktrin im deutschen, europäischen und amerikanischen Kartellrecht und beleuchtet die praktische Relevanz der Essential Facilities Doktrin.
Schlüsselwörter
Die Arbeit fokussiert auf die Themengebiete Essential Facilities Doktrin, Kartellrecht, Marktbeherrschung, Zugangsverweigerung, Infrastruktureinrichtungen, Wettbewerbsrecht, Rechtsvergleichung, Deutschland, Europa, USA.
Häufig gestellte Fragen
Was besagt die Essential Facilities Doktrin (EFD)?
Sie verpflichtet marktbeherrschende Unternehmen, Wettbewerbern den Zugang zu einer wesentlichen Einrichtung (z.B. Netze oder Infrastruktur) zu gewähren, wenn deren Aufbau unmöglich oder zu kostspielig ist.
Wo liegen die Ursprünge dieser Rechtsdoktrin?
Die Doktrin stammt ursprünglich aus dem US-amerikanischen Anti-Trust-Recht und wurde später in das europäische und deutsche Recht übernommen.
In welchem deutschen Gesetz ist die EFD verankert?
Im deutschen Recht findet sich die gesetzliche Verankerung primär im § 19 Abs. 4 Nr. 4 des Gesetzes gegen Wettbewerbsbeschränkungen (GWB).
Welches bekannte Beispiel gibt es für den Missbrauch einer Essential Facility?
Ein häufig genanntes Beispiel ist Microsoft, das seine marktführende Position über Windows nutzte, um eigene Produkte wie den Media Player zu begünstigen.
Welche Tatbestandsmerkmale müssen für die Anwendung der EFD erfüllt sein?
Dazu gehören unter anderem die Marktbeherrschung, eine Zugangsverweigerung trotz angemessenem Entgelt und die Unmöglichkeit des Zugangs auf andere Weise.
- Citation du texte
- Stefan Löning (Auteur), 2006, Die Essential Facilities Doktrin - Eine Darstellung und kritische Betrachtung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64925