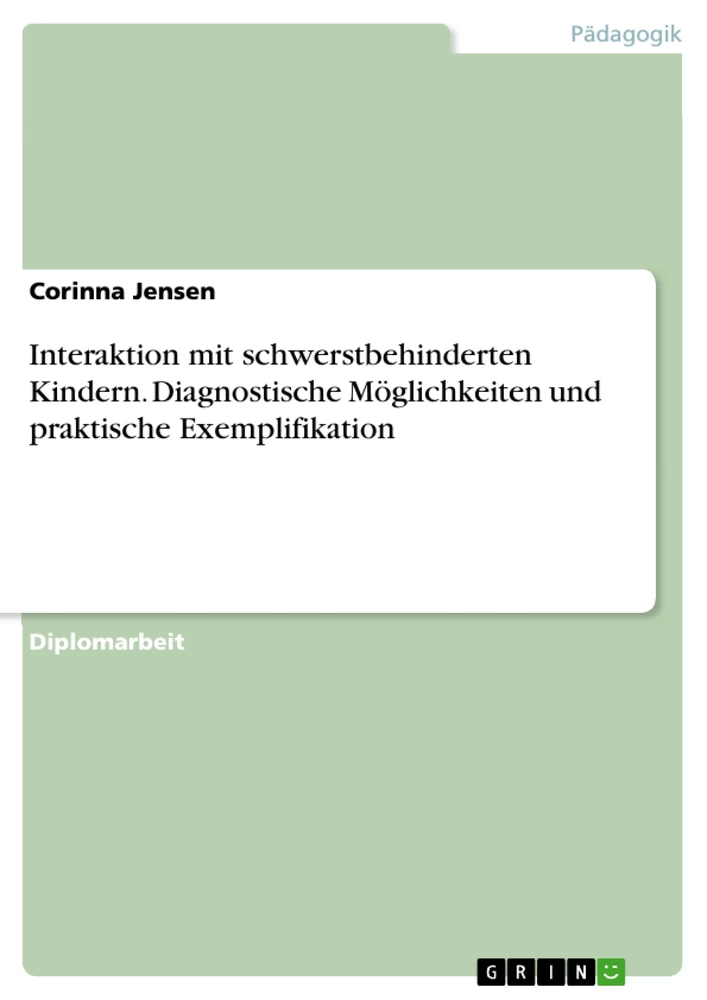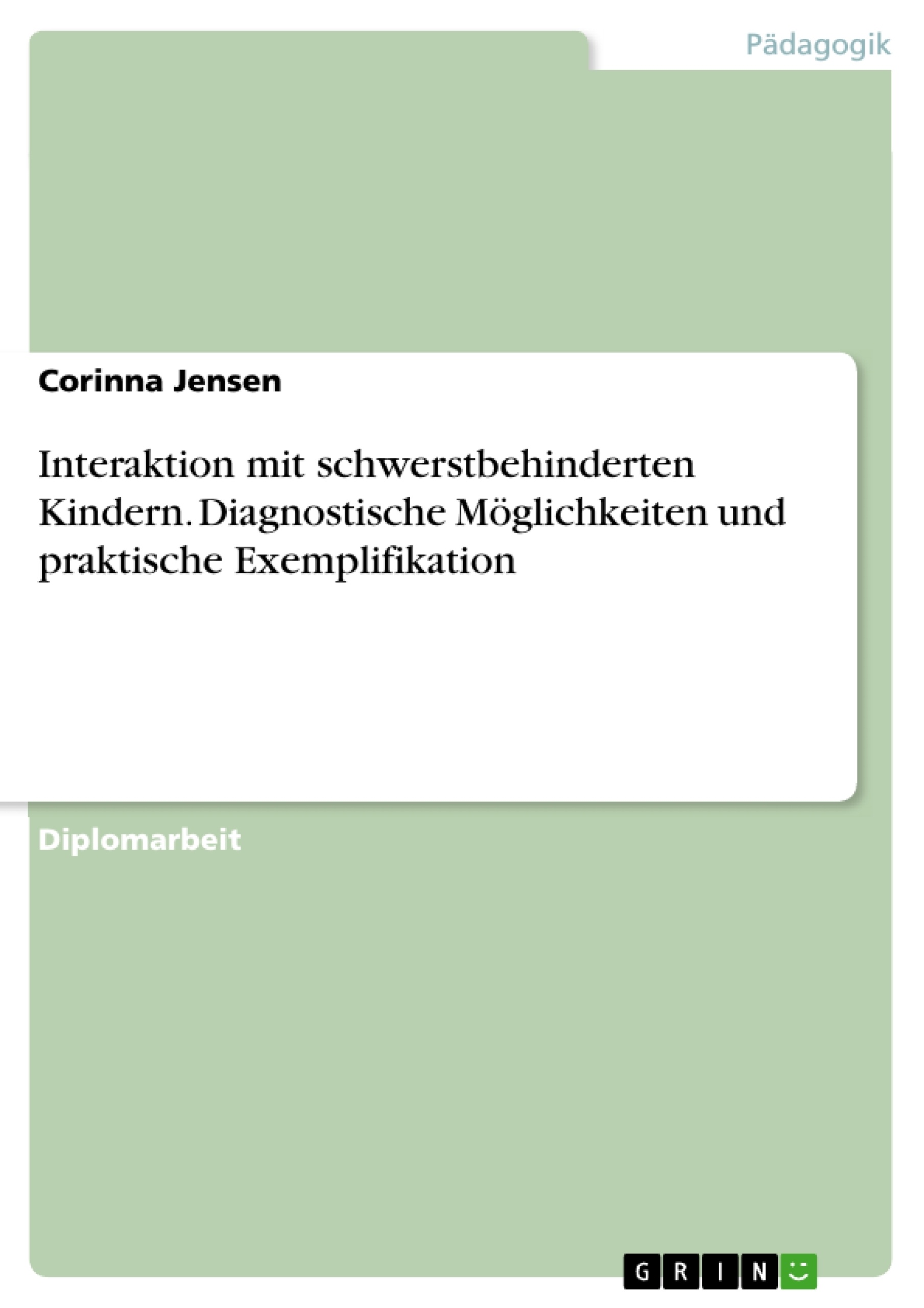Diese Arbeit hat Interaktion mit schwerstbehinderten Kindern zum Gegenstand. Ausgehend von der Annahme, dass die Kinder die Lautsprache nicht oder nur ansatzweise lernen können, werden Stufen der vorsprachlichen Entwicklung skizziert. Außerdem werden die intuitiven Kompetenzen der Eltern, die es den Kindern erleichtern in den Dialog mit ihnen zu treten, dargestellt. Die diagnostischen Möglichkeiten sind eingeschränkt, weil die Kinder sich (noch) nicht lautsprachlich verständigen können.
Bei den persönlichen Praktikums- und Arbeitserfahrungen während meines Studiums stellte sich die Interaktion mit Kindern mit schweren Behinderungen für mich immer wieder als besondere Herausforderung dar. Darüber hinaus stellte ich fest, dass die diagnostischen Möglichkeiten für die betroffenen Kinder sehr begrenzt scheinen. Daraus entwickelten sich einige Fragen für mich:
* Welche Anforderungen muss ein diagnostisches Verfahren erfüllen, um ein schwerstbehindertes Kind richtig einschätzen zu können?
* Welche Fördermaßnahmen lassen sich aus den diagnostischen Ergebnissen ableiten?
* Erleichtern diagnostische Verfahren das „Verstehen“ der Kinder?
* Sind umfangreiche diagnostische Verfahren in der alltäglichen Praxis anwendbar?
Diese Arbeit stützt sich auf nachfolgende fachwissenschaftliche Begründung:
Bisher liegen nur sehr wenige diagnostische Verfahren für den Personenkreis der schwerstbehinderten Kinder vor. Darüber hinaus muss eine Diagnostik für den Personenkreis sich besonderen Anforderungen stellen: „Kinder mit so geringen Ausdruck- und Antwortmöglichkeiten können nur schwer in ihrer Entwicklung und Persönlichkeit eingeschätzt werden. Wir können Auskünfte über das Befinden über innere Vorstellungen, über Gefühle und Gedanken nicht unmittelbar von den Kindern bekommen.“ (FRÖHLICH 2004, S. 3) Es zeigt sich, dass die in der Praxis angewendeten Diagnoseverfahren unzureichend sind, weil in ihnen zu viele Fähigkeiten und Fertigkeiten abgefragt und voraus-gesetzt werden, die ein betroffenes Kind nicht erfüllen kann.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Zum Begriff und Personenkreis, schwerstbehinderte Kinder
- Die Entstehung schwerster Behinderung
- Theoretische Überlegungen zur Interaktion
- Die Phasen der kindlichen Entwicklung
- Die Pränatale Entwicklung
- Die Perinatale Entwicklung
- Das erste Lebensjahr
- Das auftauchende Selbst
- Das Kern-Selbst
- Das subjektive Selbst
- Interaktion
- Aufriss zu den Theorien der Spracherwerbsforschung
- Der deterministische Ansatz
- Der kognitive Ansatz
- Der interaktive Ansatz
- Der entwicklungspsychologische Ansatz
- Begriff Interaktion
- Begriff Kommunikation
- Der kompetente Säugling
- Intuitive elterliche Didaktik
- Medien der Kommunikation und ihre Bedeutung
- Die visuelle Kommunikation
- Die taktile Kommunikation
- somatische Kommunikation
- Die geruchliche Kommunikation
- Die geschmackliche Kommunikation
- Die thermische Kommunikation
- Die vibratorische Kommunikation
- Begriff Dialog
- Prinzipien und Strukturelemente der frühen dialogischen Austauschprozesse
- Rhythmische Strukturen und Timing
- Begrüßung, Einleitung, gemeinsame Orientierung
- Der spielerische Dialog
- Die Abwendung
- Reziprozität und Synchronisation
- Dialog als Konzept der Ko-Regulation
- Sensitivität und Responsivität
- Erkennen der Interaktionsbereitschaft des Kindes
- Steuerung der Erregungs- und Aufmerksamkeitsprozesse des Kindes
- Beachtung der Rückkoppelungssignale des Kindes
- Kontingenzerfahrungen
- Die Bedeutung von affektiver Abstimmung und Belohnung
- Positive Wechselseitigkeit als Schlüssel gelungener Interaktion
- Erschwernisse in der Kommunikation durch die schwere Beeinträchtigung
- Ressourcen für die Kommunikation mit schwer beeinträchtigten Kindern
- Problemaufriss: Diagnostik bei schwerstbehinderten Kindern
- Zum Begriff der Diagnostik
- Zum Begriff Psychodiagnostik
- Gegenstands- und Aufgabenbereich sonderpädagogischer Diagnostik
- Testtheoretische Vorrausetzungen zur Realisierung Sonderpädagogischer Diagnostik
- Der psychologische Test
- Gütekriterien psychologischer Tests und sonderpädagogische Relevanz
- Objektivität
- Reliabilität
- Validität
- Normierung
- Nebengütekriterien von Tests
- Die Vergleichbarkeit
- Ökonomie
- Nützlichkeit
- Informationsgewinnung im Rahmen förderdiagnostischer Praxis
- Förderdiagnostische Verfahren
- Die Verhaltensbeobachtung
- Quantitative und qualitative Diagnostik
- Einzelfallstudien
- Förderdiagnostik bei schwerstbehinderten Kindern nach Andreas Fröhlich und Ursula Haupt
- Möglichkeiten und Ziele der Förderdiagnostik
- Grundlagen des Diagnoseverfahrens
- Durchführung
- Die fünf Niveastufen
- Die Auswertung der Förderdiagnostik
- Interaktionsdiagnostik mit dem pädagogischen Ziel der Verbesserung von Interaktionsstrukturen
- Videogestützte Interaktionsanalyse
- Beobachtungsmethoden
- Beurteilungskategorien
- Spielfeinfühligkeit
- Mütterliche Responsivität
- Mütterliches Scaffolding
- Mütterliche Kooperation
- Das Verhalten des Kindes / Konstruktives Spielinteresse
- Emotionsregulation
- Praktische Exemplifikation
- Anamnese
- Auswertung der Förderdiagnostik für schwerstbehinderte Kinder nach Fröhlich
- Die Beziehung zwischen Mutter und Kind
- Die Reaktion des Kindes auf Stimme und Sprache
- Die lautlichen Äußerungen des Kindes
- Die Reaktion des Kindes auf sensorische Angebote
- Handbewegungen/Spielen
- Bewegungen des ganzen Körpers
- Räumliches Erleben
- Trinken und Essen
- Umgang mit dem Kind
- Ableitung der Förderziele
- Auswertung der Interaktionsanalyse
- Adaptation des Verfahrens
- Spielfeinfühligkeit
- Mütterliche Responsivität
- Mütterliches Scaffolding
- Mütterliche Kooperation
- Das Verhalten des Kindes/ Konstruktives Spielinteresse
- Emotionsregulation
- Zusammenfassendes Ergebnis
- Zusammenfassende Reflexion und Konsequenzen
- Entwicklung schwerster Behinderung
- Theoretische Modelle der Interaktion
- Diagnostik bei schwerstbehinderten Kindern
- Förderdiagnostische Verfahren
- Interaktionsanalyse und deren praktische Anwendung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Interaktion mit schwerstbehinderten Kindern. Die Arbeit untersucht diagnostische Möglichkeiten und ihre praktische Anwendung anhand eines Fallbeispiels.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit und die Forschungsfrage vor. Kapitel 2 definiert den Begriff „schwerstbehinderte Kinder“ und beleuchtet die Entstehung schwerster Behinderung. Kapitel 3 diskutiert theoretische Überlegungen zur Interaktion und beleuchtet verschiedene Phasen der kindlichen Entwicklung. Kapitel 4 widmet sich dem Konzept der Interaktion und Kommunikation sowie deren Bedeutung für die Entwicklung des Kindes. Kapitel 5 behandelt die Thematik der Diagnostik bei schwerstbehinderten Kindern, inklusive verschiedener Testverfahren und Gütekriterien. Kapitel 6 zeigt die praktische Anwendung der diagnostischen Verfahren anhand eines Fallbeispiels.
Schlüsselwörter
Schwerstbehinderung, Interaktion, Kommunikation, Diagnostik, Förderdiagnostik, Interaktionsanalyse, Videogestützte Beobachtung, Fallbeispiel, Entwicklungspsychologie, Sonderpädagogik
Häufig gestellte Fragen
Wie kommunizieren schwerstbehinderte Kinder ohne Lautsprache?
Die Kommunikation erfolgt über vorsprachliche Wege, wie visuelle, taktile, somatische, vibratorische und thermische Signale sowie über Mimik und Körperkontakt.
Was ist "intuitive elterliche Didaktik"?
Dies beschreibt das natürliche, oft unbewusste Verhalten von Eltern, ihr Timing und ihre Signale so an den Säugling oder das Kind anzupassen, dass ein Dialog entstehen kann.
Welche Anforderungen muss Diagnostik bei schwerstbehinderten Kindern erfüllen?
Sie darf nicht zu viele Fähigkeiten voraussetzen, die das Kind nicht leisten kann, und muss sich stattdessen auf Beobachtungen von Befinden, Reaktionen und Interaktionsbereitschaft stützen.
Wer entwickelte maßgebliche Förderdiagnostik-Verfahren für diesen Bereich?
Andreas Fröhlich und Ursula Haupt haben bedeutende Verfahren zur Förderdiagnostik bei schwerstbehinderten Kindern entwickelt.
Welche Rolle spielt die Videoanalyse in der Interaktionsdiagnostik?
Die videogestützte Analyse ermöglicht es, feine Signale wie Spielfeinfühligkeit, mütterliche Responsivität und die Emotionsregulation des Kindes detailliert auszuwerten.
- Citar trabajo
- Dipl. Reha. Päd. Corinna Jensen (Autor), 2006, Interaktion mit schwerstbehinderten Kindern. Diagnostische Möglichkeiten und praktische Exemplifikation, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/64957