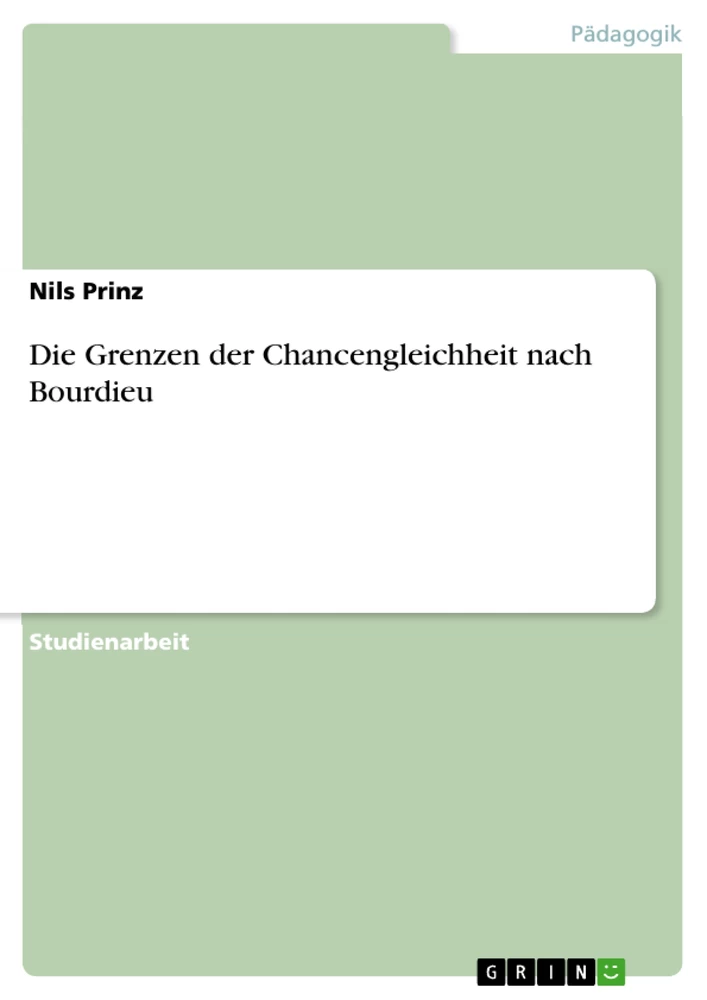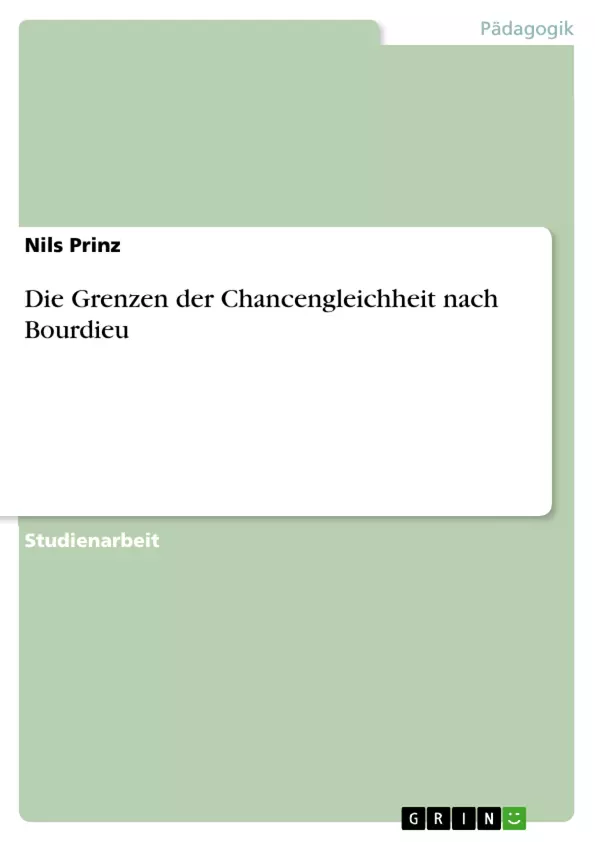Die Idee der Chancengleichheit gilt bis heute als eine wesentliche Zieldimension pädagogischer Institutionen. Während dieser Anspruch an das Bildungswesen in der Operationswirklichkeit von Recht und Gesetz bereits realisiert wurde, ist die Verwirklichung dieses Zieles in der Realität (noch) fragwürdig. Die soziale Disposition des Einzelnen, die Möglichkeiten und Chancen, die von der Stellung im sozialen Gefüge, von der Zugehörigkeit zu einer Schicht abhängen, haben anscheinend bestimmenden Einfluss auf den Werdegang einer Person innerhalb des Bildungssystems.
Dieser Zusammenhang des persönlichen Milieus, das den Lebensraum eines jeden darstellt und seine Sozialisation bestimmt, und dem resultierenden Lebenslauf soll hier nachgegangen werden. Zunächst wird diese Untersuchung die Sozialisationstheorien von Pierre Bourdieu herausarbeiten und bestimmende Begriffe definieren. Anschließend folgt eine konkrete Schilderung der Implikationen, die aus diesem Konzept hervorgehen. Eine kurze Einführung in das Sozialisationskonzept von Klaus Hurrelmann liefert dann im Folgenden die Argumente für eine kritische Realitätsprüfung der Theorien Bourdieus, die im Schlussteil versucht werden soll.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung und Gang der Untersuchung
- Sozialisation als Habitualisierung nach Pierre Bourdieu
- Prinzipien und Formen des Kapitals
- Kulturelles Kapital
- Soziales Kapital
- Ökonomisches Kapital
- Transformationen des Kapitals
- Prinzipien und Formen des Kapitals
- Interaktive Persönlichkeitsentwicklung nach Hurrelmann
- Resumée
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Frage, inwieweit die Idee der Chancengleichheit in der Realität des Bildungssystems umgesetzt wird. Sie untersucht die Sozialisationstheorien von Pierre Bourdieu, um den Zusammenhang zwischen der sozialen Disposition des Einzelnen und seinem Werdegang innerhalb des Bildungssystems zu beleuchten. Die Arbeit analysiert die Konzepte des Kapitals und des Habitus, um zu verstehen, wie soziale Strukturen und die Positionierung im sozialen Raum den Lebenslauf beeinflussen. Sie bezieht sich auch auf das Sozialisationskonzept von Klaus Hurrelmann, um die Theorien von Bourdieu kritisch zu hinterfragen.
- Die Rolle der sozialen Disposition bei der Chancengleichheit im Bildungssystem
- Die Sozialisationstheorien von Pierre Bourdieu und ihre Anwendung auf das Bildungssystem
- Die Konzepte des Kapitals und des Habitus und ihre Bedeutung für die individuelle Entwicklung
- Kritische Analyse der Theorien Bourdieus im Lichte der Sozialisationstheorie von Klaus Hurrelmann
- Der Zusammenhang zwischen sozialer Herkunft, Kapital und Bildungserfolg
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung und Gang der Untersuchung: Die Einleitung stellt das Thema der Chancengleichheit im Bildungssystem vor und skizziert den Aufbau der Arbeit. Sie beleuchtet die Diskrepanz zwischen dem Anspruch der Chancengleichheit und der tatsächlichen Situation im Bildungssystem.
- Sozialisation als Habitualisierung nach Pierre Bourdieu: Dieses Kapitel stellt die Sozialisationstheorien von Pierre Bourdieu vor und erklärt zentrale Begriffe wie Habitus und Kapital. Es wird gezeigt, wie Bourdieu die Entstehung von Klassenstrukturen und Lebenstilen aus der Positionierung im sozialen Raum erklärt.
- Prinzipien und Formen des Kapitals: Dieses Kapitel geht auf die verschiedenen Formen des Kapitals ein, die nach Bourdieu den Lebensweg eines Menschen bestimmen. Es werden kulturelles, soziales und ökonomisches Kapital unterschieden und deren Einfluss auf die Bildungskarriere erläutert.
Schlüsselwörter
Chancengleichheit, Bildungssystem, Sozialisation, Pierre Bourdieu, Habitus, Kapital, Klassenstruktur, Lebenslauf, soziale Disposition, soziale Herkunft, Bildungserfolg, Klaus Hurrelmann, interaktive Persönlichkeitsentwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Pierre Bourdieu unter "Habitus"?
Der Habitus ist ein System von dauerhaften Dispositionen, das durch die soziale Herkunft geprägt wird und das Denken sowie Handeln eines Menschen unbewusst steuert.
Welche Kapitalformen beeinflussen laut Bourdieu den Bildungserfolg?
Bourdieu unterscheidet zwischen ökonomischem Kapital (Geld), sozialem Kapital (Beziehungen) und kulturellem Kapital (Bildung, Wissen, Titel). Besonders das kulturelle Kapital ist entscheidend für den Erfolg im Schulsystem.
Warum ist echte Chancengleichheit laut dieser Theorie schwer erreichbar?
Weil pädagogische Institutionen oft unbewusst die Verhaltensweisen und das Wissen der herrschenden Schichten voraussetzen, wodurch Kinder aus bildungsfernen Milieus trotz gleicher formaler Rechte benachteiligt werden.
Wie unterscheidet sich Hurrelmanns Ansatz von dem Bourdieus?
Klaus Hurrelmann betont die interaktive Persönlichkeitsentwicklung, bei der das Individuum seine Umwelt aktiv mitgestaltet, während Bourdieu stärker auf die prägende Kraft sozialer Strukturen fokussiert.
Was bedeutet "soziale Disposition" im Bildungswesen?
Es beschreibt die Ausgangslage eines Einzelnen im sozialen Gefüge. Diese Stellung bestimmt maßgeblich die Möglichkeiten und Chancen, die eine Person innerhalb des Bildungssystems wahrnehmen kann.
- Citar trabajo
- Nils Prinz (Autor), 2003, Die Grenzen der Chancengleichheit nach Bourdieu, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65002