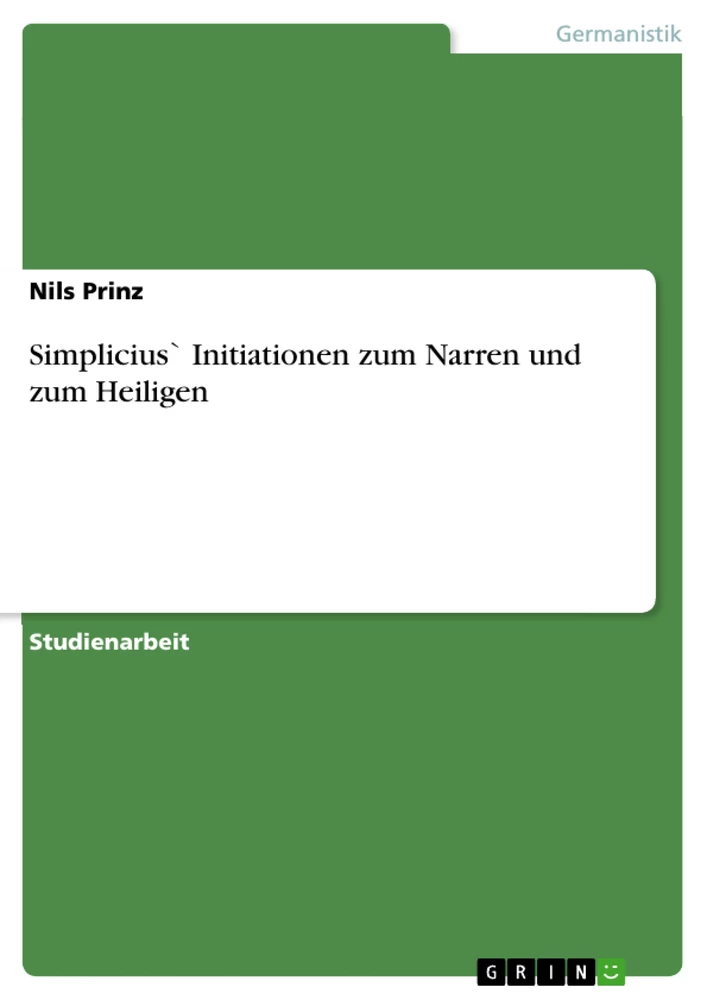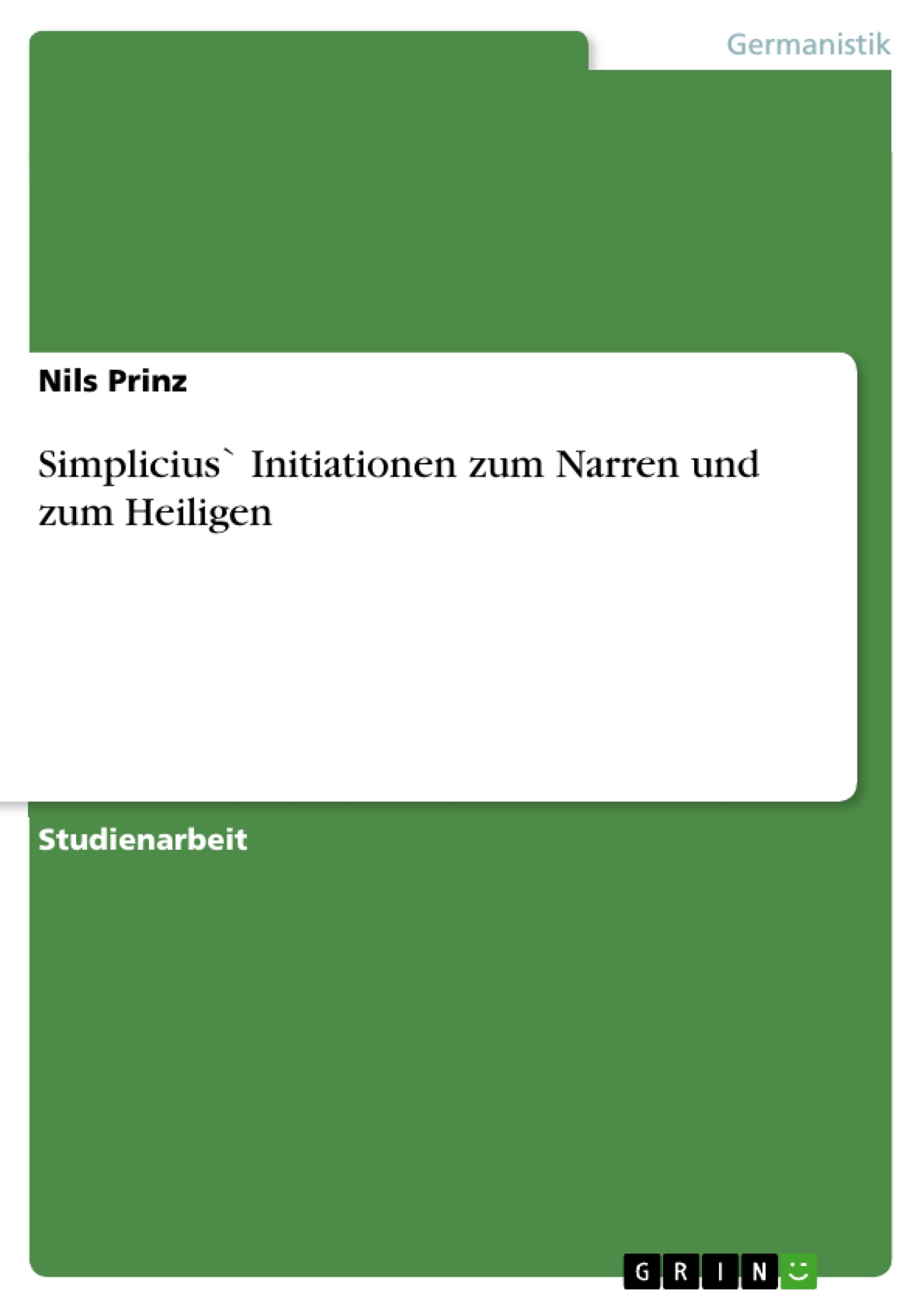Der vollständige Titel von Grimmelshausens ‚Simplicissimus Teutsch’ lautet:„Der Abentheuerliche Simplicissimus Teutsch / Das ist: Die Beschreibung deß Lebens eines seltzamen Vaganten / genant Melchior Sternfels von Fuchshaim / wo und welcher gestalt Er nemlich in diese Welt kommen / was er darinn gesehen / gelernet / erfahren und außgestanden / auch warumb er solche wieder freywillig quittirt. Überauß lustig / und männiglich nutzlich zu lesen.“
Nacheinander ist Simplicius - der Protagonist einer fiktiven Autobiographie - Bauernjunge, Gefährte eines Einsiedels, Narr und Diener eines adeligen Herrn, Soldatenknecht und Soldat, bürgerlicher Ehemann, Abenteurer und männliche Hure, landstreichender Quacksalber, schließlich Bauer, Privatgelehrter, Pilger und schließlich wieder ein Einsiedel. Dabei bildet der Dreißigjährige Krieg den Hintergrund für große Teile des Romans, der das Leben aller gesellschaftlichen Schichten zu dieser Zeit berührt: das der ländlichen und das der städtischen Bevölkerung, das Leben bei Hofe, das der Soldaten, der Geistlichen und nicht zuletzt das der Rechtlosen und Vogelfreien.
Vor diesem vielfarbigen Bild vom Leben in ‚Deutschland’ des 17. Jahrhunderts schildert Grimmelshausen in diesem Roman den Weg seines Helden ‚in die Welt’ und durch sie hindurch bis zu ihrem ‚Verlassen’.1
Diese Untersuchung befasst sich vornehmlich mit zwei zentralen Initiationsprozessen: den, der Simplicius in die Welt samt ihren Verstrickungen führt und jenen, der seine Entwicklung zum ‚Heiligen’ besiegelt.
Eine zentrale Ausgangsannahme der Arbeit ist, dass das Schlossabenteuer das komplementäre Ritual zur Hanauer Initiation darstellt.
Das Ziel der Untersuchung ist, die Bedeutung beider Szenen jeweils für sich und im Zusammenhang zu erarbeiten und aus den resultierenden Erkenntnissen heraus, Mutmaßungen über Grimmelshausens Intention für diese Verschränkung weit auseinanderliegender Textteile innerhalb des ‚Simplicianischen Zyklus`’ anzustellen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Gang der Untersuchung
- Der, Picaro' Simplicius und der,Simplicianische Zyklus'
- Simplicius Verwandlung zum Narren
- Simplicius beim Einsiedel
- Simplicius in Hanau
- Simplicius Verwandlung
- Simplicius als Narr
- Simplicius Sündenfall
- Simplicius` Verstrickung in die Welt
- Die Sünde der Trägheit
- Der Betrüger Simplicius
- Die Sünde des Hochmuts
- Zusammenfassung
- Simplicius' weiterer Lebensweg
- Die Schlossepisode
- Die Erzscherer
- Simplicius Auftrag
- Deutung gemeinsamer Motive in beiden Szenen
- Die Parallelen
- Die Bedeutung der qualitativen Unterschiede
- Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert zwei zentrale Initiationsprozesse im Roman "Simplicissimus Teutsch" von Grimmelshausen: die Eingliederung des Protagonisten Simplicius in die Welt und seine Entwicklung zum "Heiligen". Besonderes Augenmerk liegt dabei auf der Hanauer Narrenverwandlung und der Schlossepisode, die als komplementäre Rituale verstanden werden. Ziel der Untersuchung ist es, die Bedeutung beider Szenen sowohl isoliert als auch im Zusammenhang zu erarbeiten und daraus Schlussfolgerungen über Grimmelshausens Intentionen für diese Verbindung weit auseinanderliegender Textteile zu ziehen.
- Die Entwicklung des Protagonisten Simplicius als „Picaro“
- Die Rolle der Narrenverwandlung im Kontext des Romans
- Die Bedeutung der Schlossepisode als komplementäre Initiation
- Grimmelshausens Intentionen für die Verschränkung beider Szenen
- Der Einfluss einsiedlerischer Lehren auf Simplicius' Wandlungsphasen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt den literaturhistorischen Kontext des „Simplicissimus Teutsch“ vor und skizziert die zentralen Forschungsfragen der Arbeit. In Kapitel 2 wird die Hanauer Narrenverwandlung beleuchtet, wobei Simplicius' frühe Jahre und seine Verstrickung in die Welt behandelt werden. Kapitel 3 betrachtet Simplicius' Sündenfall und seine weitere Lebensentwicklung. Kapitel 4 widmet sich der Schlossepisode, die als komplementäres Ritual zur Hanauer Initiation betrachtet wird. Kapitel 5 analysiert gemeinsame Motive in beiden Szenen und die Bedeutung der qualitativen Unterschiede. Die Schlussbetrachtung fasst die Erkenntnisse der Arbeit zusammen und reflektiert die Autorintention.
Schlüsselwörter
Simplicius Teutsch, Grimmelshausen, Picaro-Roman, Narrenverwandlung, Initiation, Schlossepisode, Hanau, Einsiedel, "Simplicianischer Zyklus", christlich-erbauliche Ausrichtung, Sünde, Reue, Buße, Dreißigjähriger Krieg.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die zentralen Initiationsprozesse von Simplicius?
Die Arbeit untersucht die Verwandlung zum Narren (Eintritt in die Welt) und die spätere Entwicklung zum Heiligen (Abkehr von der Welt).
Was geschieht bei der "Hanauer Initiation"?
Simplicius wird in Hanau gewaltsam in einen Narren verwandelt und verliert seine ursprüngliche Unschuld durch die Konfrontation mit der höfischen Welt.
Welche Bedeutung hat die Schlossepisode im Roman?
Sie wird als komplementäres Ritual zur Hanauer Szene gedeutet und markiert einen weiteren wichtigen Wendepunkt in Simplicius' Lebensweg.
In welchem historischen Kontext spielt "Simplicissimus Teutsch"?
Der Dreißigjährige Krieg bildet den Hintergrund und beeinflusst das Leben aller gesellschaftlichen Schichten, die im Roman dargestellt werden.
Warum bezeichnet man Simplicius als "Picaro"?
Als Schelmenfigur (Picaro) wandert er durch verschiedene soziale Schichten und erfährt die Welt in all ihrer moralischen Verstrickung.
- Citar trabajo
- Nils Prinz (Autor), 2006, Simplicius` Initiationen zum Narren und zum Heiligen, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65007