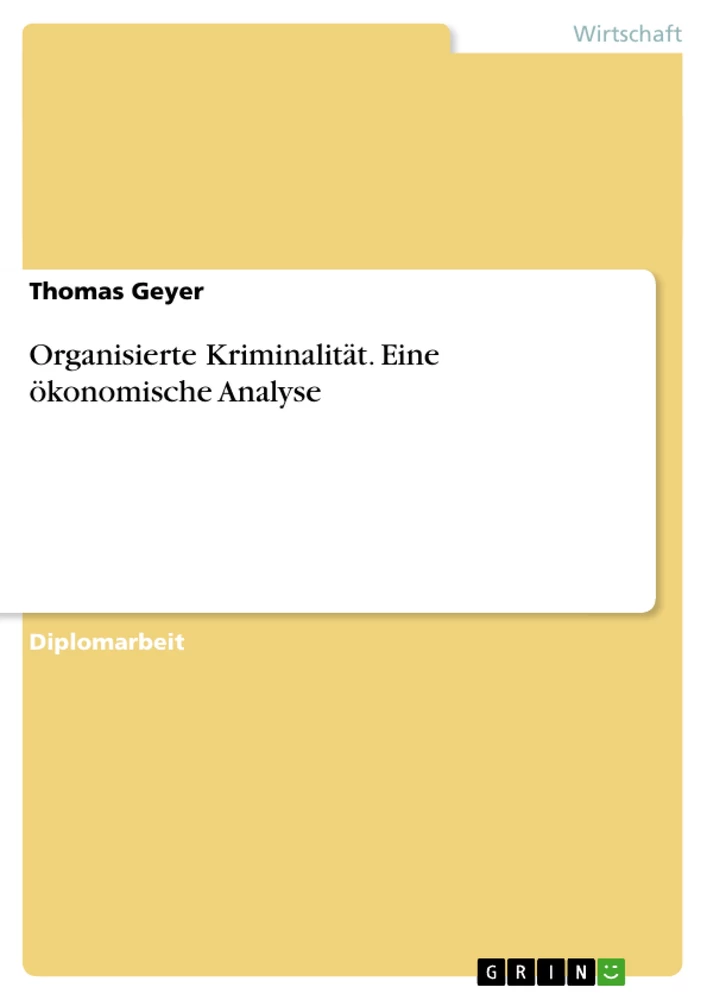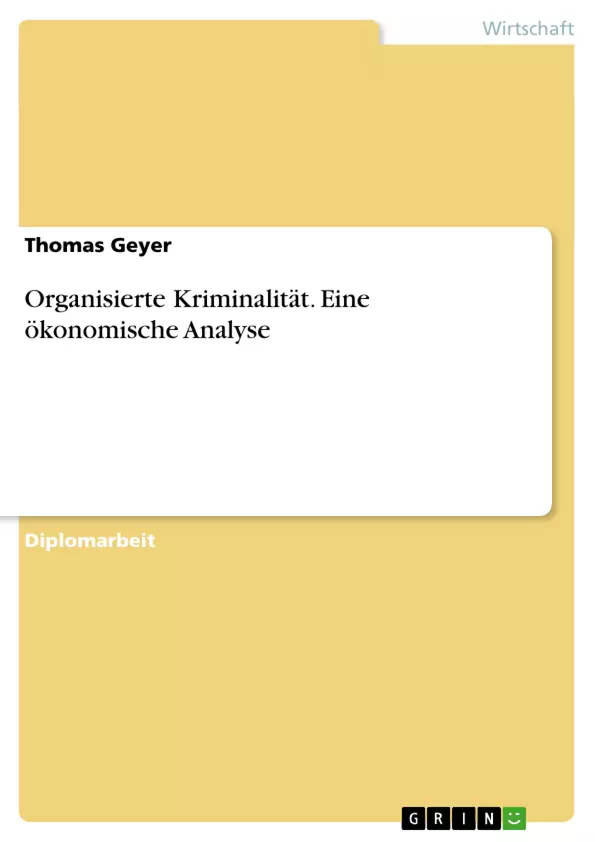Das Phänomen der „Organisierten Kriminalität“ (OK) ist ein äußerst umstrittenes Thema. Bei genauerer Betrachtung, erweist sich die Diskussion zunächst vor allem politischer Natur.
Über diese politische Diskussion hinaus, sind auch die Medien durch die dramatisierende Darstellung der Gefahren der OK beteiligt, wie schließlich auch Forscher im Streit um die adäquate Definition der OK engagiert sind. Der Fakt, dass sich so viele Gruppen mit dem Definieren, Beschreiben und Analysieren beschäftigt haben, kann auch teilweise erklären, weshalb so viele unterschiedliche Auffassungen und Vorstellungen bezüglich der OK existieren. Erschwert wird die Forschung dabei vor allem durch die Vielfalt der OK und ihrer Aktivitäten. Aber auch die der Illegalität geschuldete Geheimhaltung obstruiert die Auseinandersetzung mit der OK und gestaltet die Datensammlung schwierig. Da die Strafverfolgungsbehörden zudem ihre gewonnenen Erkenntnisse nur sehr restriktiv zur Verfügung stellen und diese dann teilweise schon verzerrt sind, erschwert dies die Erforschung des Problems zusätzlich. Entsprechend ist empirische Literatur nur spärlich vorhanden. Für ein besseres Verständnis der OK sollte jedoch eine interdisziplinäre Betrachtung erfolgen. Die ökonomischen Beiträge zur OK sind dabei allerdings bisher unterrepräsentiert. Daher soll die vorliegende Arbeit einen sachlichen Beitrag zu dem in der Öffentlichkeit häufig überzeichnet dargestellten Phänomen der OK liefern.
Es wird daher zu erarbeiten sein, ob diesbezüglich eine theoretische Fundierung besteht und ob sich die Adaption des Unternehmensbegriffs auf die OK rechtfertigen lässt. Dies erscheint insbesondere deshalb angezeigt, da die OK im Allgemeinen als Anbieter illegaler Güter und Dienstleistungen für die Öffentlichkeit angesehen wird.
Im Hauptteil der Arbeit sollen zunächst die generellen Konsequenzen skizziert werden, während im Anschluss daran die speziellen Konsequenzen der Illegalität und die Reaktionen und Maßnahmen der OK hierauf dargestellt werden. Es ist anzunehmen, dass die Illegalität dabei Auswirkungen auf die Struktur der OK und ihrer Beziehungen mit ihren Umweltsystemen hat.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung und Abgrenzung
- 2. Die Organisierte Kriminalität
- 2.1. Begriffsbestimmung und -verständnis
- 2.2. Die Organisierte Kriminalität als illegales Unternehmen?-Das „,enterprise model“ von Smith
- 2.3. Die formale Unternehmenseigenschaft
- 2.4. Abgrenzung zum Terrorismus
- 2.5. Umfang wesentlicher Tätigkeitsfelder der Organisierten Kriminalität
- 3. Auswirkungen der Organisierten Kriminalität auf die legale Wirtschaft und ihr Gefahrenpotenzial
- 3.1. Beeinträchtigungen des Wettbewerbs und des marktwirtschaftlichen Systems
- 3.2. Gefahren für die Demokratie und Schäden für die Allgemeinheit
- 4. Generelle Konsequenzen der Illegalität für die Organisierte Kriminalität
- 5. Spezielle Konsequenzen der Illegalität und Anpassungsstrategien der Organisierten Kriminalität
- 5.1. Personal
- 5.1.1. Informationsreduzierung und ökonomische Anreize
- 5.1.2. Disziplinierung durch Androhung und Einsatz von Gewalt
- 5.1.3. Generelle Mitarbeiterreduzierung und nicht-ökonomische Faktoren
- 5.2. Zulieferer
- 5.2.1. Vertragsbeziehungen und deren Durchsetzung
- 5.2.2. Ein heuristisches Modell der vertikalen Integration
- 5.2.2. Vor- und Nachteile der vertikalen Integration
- 5.3. Endkunden
- 5.4. Konkurrenten
- 5.4.1. Monopolbestrebungen einer illegalen Unternehmung
- 5.4.2. Gewalteinsatz in einem oligopolistischen Markt
- 5.4.3. Gewalteinsatz unter polypolistischen Marktbedingungen
- 5.5. Finanzierung und Investition
- 5.5.1. Beschränkungen bei der Kapitalbeschaffung
- 5.5.2. Die Geldwäsche zur Legalisierung illegaler Einkünfte
- 5.6. Regulierung
- 5.6.1. Risikominimierung durch Korruption
- 5.6.2. Korruption als Risikofaktor
- 6. Fazit und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit befasst sich mit einer ökonomischen Analyse der organisierten Kriminalität. Ziel ist es, die organisierte Kriminalität als illegales Unternehmen zu betrachten und die Besonderheiten ihrer Funktionsweise und ihrer Anpassungsstrategien im Vergleich zu legalen Unternehmen zu beleuchten.
- Begriffsbestimmung und -verständnis der organisierten Kriminalität
- Analyse des „enterprise model“ von Smith und der formalen Unternehmenseigenschaft
- Auswirkungen der organisierten Kriminalität auf die legale Wirtschaft und das marktwirtschaftliche System
- Konsequenzen der Illegalität für die organisierte Kriminalität
- Anpassungsstrategien der organisierten Kriminalität in Bezug auf Personal, Zulieferer, Endkunden, Konkurrenten, Finanzierung und Regulierung
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 dient der Einleitung und Abgrenzung des Themas. Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Begriffsbestimmung und dem Verständnis der organisierten Kriminalität. Es wird das „enterprise model“ von Smith vorgestellt und die formale Unternehmenseigenschaft der organisierten Kriminalität beleuchtet. Außerdem werden die Abgrenzung zum Terrorismus und der Umfang wesentlicher Tätigkeitsfelder der organisierten Kriminalität erörtert.
Kapitel 3 untersucht die Auswirkungen der organisierten Kriminalität auf die legale Wirtschaft und ihr Gefahrenpotenzial. Dabei werden die Beeinträchtigungen des Wettbewerbs und des marktwirtschaftlichen Systems sowie die Gefahren für die Demokratie und Schäden für die Allgemeinheit analysiert.
Kapitel 4 befasst sich mit den generellen Konsequenzen der Illegalität für die organisierte Kriminalität. Kapitel 5 untersucht die spezifischen Konsequenzen der Illegalität und die Anpassungsstrategien der organisierten Kriminalität in verschiedenen Bereichen, wie z.B. Personal, Zulieferer, Endkunden, Konkurrenten, Finanzierung und Regulierung.
Schlüsselwörter
Organisierte Kriminalität, illegales Unternehmen, enterprise model, Wettbewerbsbeeinträchtigung, Gefahren für die Demokratie, Anpassungsstrategien, Personal, Zulieferer, Endkunden, Konkurrenten, Finanzierung, Regulierung, Korruption, Geldwäsche
Häufig gestellte Fragen
Kann man Organisierte Kriminalität (OK) ökonomisch als Unternehmen betrachten?
Ja, das „enterprise model“ von Smith betrachtet die OK als Anbieter illegaler Güter und Dienstleistungen, die nach ökonomischen Prinzipien wie Gewinnmaximierung agieren.
Wie beeinflusst die Illegalität die Personalstruktur der OK?
Wegen des Entdeckungsrisikos setzt die OK auf Informationsreduzierung, ökonomische Anreize und Disziplinierung durch Gewaltandrohung statt auf formale Verträge.
Welche Auswirkungen hat die OK auf die legale Wirtschaft?
Sie verzerrt den Wettbewerb, schädigt das marktwirtschaftliche System durch illegale Preisabsprachen und untergräbt die Demokratie durch Korruption.
Wie funktioniert die Finanzierung in der Organisierten Kriminalität?
Da der Zugang zum legalen Kapitalmarkt fehlt, nutzt die OK interne Finanzierung und komplexe Geldwäscheverfahren, um illegale Einkünfte zu legalisieren.
Warum ist Korruption für die OK strategisch wichtig?
Korruption dient der Risikominimierung, um Strafverfolgung zu verhindern oder regulatorische Hürden zu umgehen, stellt aber gleichzeitig ein internes Sicherheitsrisiko dar.
Was ist "vertikale Integration" im Kontext krimineller Organisationen?
Es beschreibt die Kontrolle über die gesamte Wertschöpfungskette (z.B. Produktion, Schmuggel, Verkauf), um Abhängigkeiten von externen Zulieferern und damit Entdeckungsrisiken zu senken.
- Citation du texte
- Thomas Geyer (Auteur), 2005, Organisierte Kriminalität. Eine ökonomische Analyse, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65151