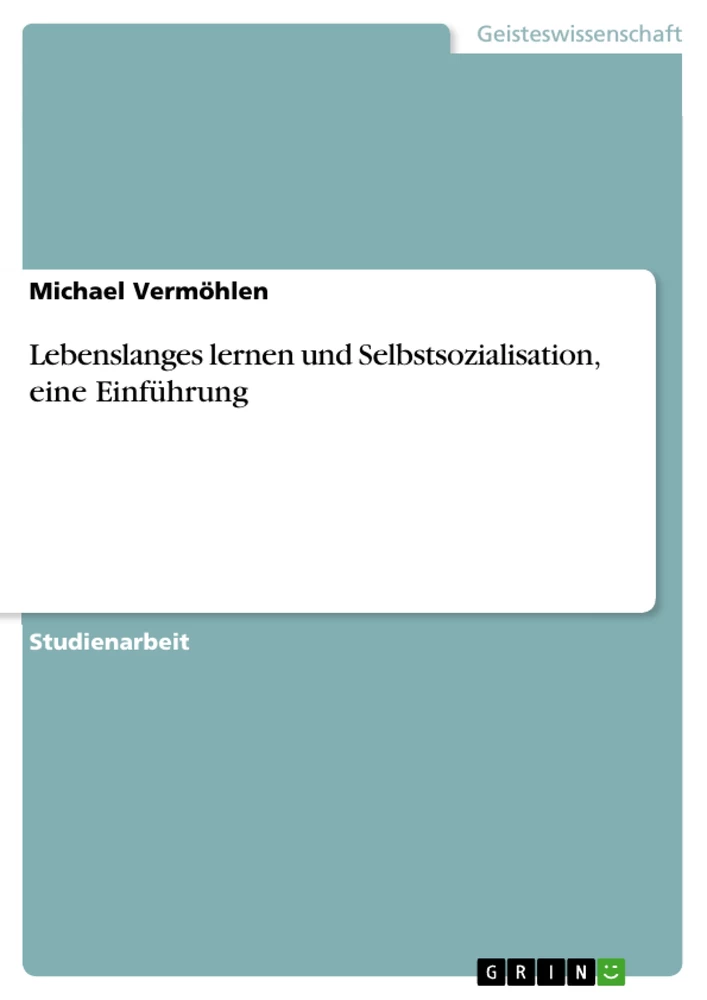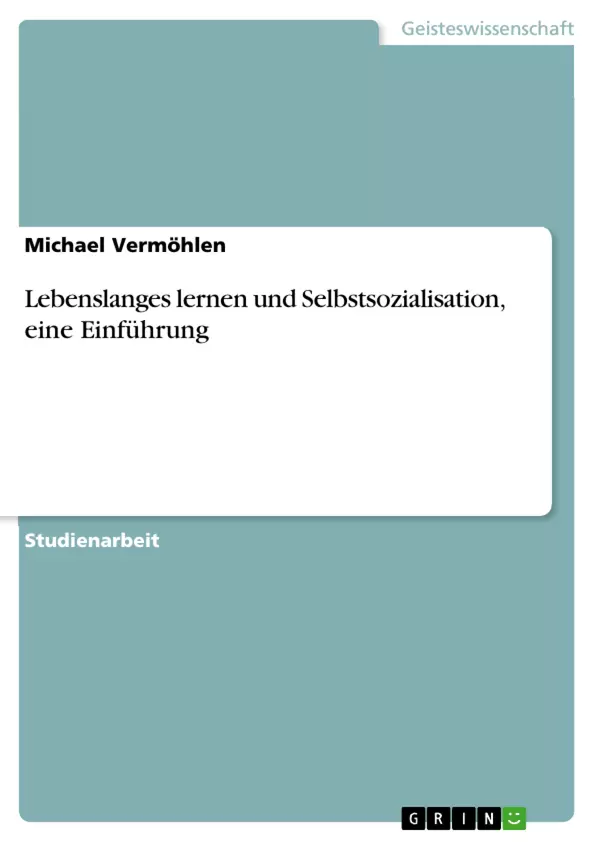Zu Beginn meines Referats, machte ich dem Plenum, in Form einer Aufzählung kurz wieder bewusst, dass es verschiedene Lernformen gibt, die in den, oftmals recht unscharfen, Begriff des Lebenslangen Lernens einfließen. Folgende drei Hauptbereiche sind dabei von Bedeutung:
1. formale Lernprozesse,
welche generell in den etablierten Bildungseinrichtungen wie Schule, Universität etc. stattfinden, und in der Regel mit einer gesellschaftlich anerkannten Zertifizierung (Abitur, Diplom etc.) abgeschlossen werden.
2. nicht formale Lernprozesse, welche normalerweise abseits der klassischen
Bildungsinstitutionen stattfinden, wie beispielsweise am Arbeitsplatz, in Vereinen und Verbände etc..
3. informelle Lernprozesse,
die maßgeblich durch weitgehend unbewusste Lernprozesse
geprägt sind. In diese Kategorie fallen sowohl beispielsweise das durchblättern einer Zeitschrift oder eines Buches, Gespräche, Radio hören usw.. Sprich vorrangig alle Lernprozesse, die unbeabsichtigt, und oftmals auch unbemerkt nebenbei ablaufen.
Inhaltsverzeichnis
- Lebenslanges Lernen (L³) und Selbstsozialisation
- Formen von lebenslangem Lernen:
- formale Lernprozesse
- nicht formale Lernprozesse
- informelle Lernprozesse
- Folgerung (der Commission of the European Communities 2000)
- Exkurs: Bildungswandel
- Vier Hauptgründe für diesen Bildungswandel:
- Zwischenfazit:
- Probleme/ Kritik
- Damit einhergehende Folgen:
- Folgerung
- Mögliche Alternativen: (nach Dausien/ Alheit)
- Analyse I
- Analyse II
- Fazit:
- Kurzer Ausblick:
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Der Text befasst sich mit dem Konzept des lebenslangen Lernens (L³) und seiner Bedeutung in einer sich ständig wandelnden Gesellschaft. Es wird dargelegt, dass Lernen nicht nur auf die formale Bildung beschränkt sein sollte, sondern ein lebenslanger Prozess ist, der in verschiedenen Formen stattfindet.
- Formen von lebenslangem Lernen: formal, non-formal und informal
- Die Rolle von Bildungseinrichtungen und gesellschaftlichen Kontexten
- Die Herausforderungen und Möglichkeiten des Bildungswandels
- Die Bedeutung von „Lernumwelten“ für vernetztes Lernen
- Die Verbindung von Bildung und ökonomischer sowie sozialer Entwicklung
Zusammenfassung der Kapitel
Lebenslanges Lernen (L³) und Selbstsozialisation
Dieser Abschnitt stellt die verschiedenen Formen des lebenslangen Lernens vor: formale, non-formale und informelle Lernprozesse. Die Bedeutung und die jeweiligen Merkmale jeder Form werden erläutert.
Folgerung (der Commission of the European Communities 2000)
Der Text zitiert die Schlussfolgerungen der Commission of the European Communities bezüglich des Lebenslangen Lernens. Es wird betont, dass Lernen „lifewide“ stattfinden soll, d.h. systematisch auf die gesamte Lebensspanne ausgedehnt werden soll.
Exkurs: Bildungswandel
Dieser Abschnitt beleuchtet den globalen bildungspolitischen Paradigmenwechsel und die wachsende Bedeutung des Konzepts des lifelong learning. Es werden die vier Hauptgründe für diesen Wandel vorgestellt, darunter die Veränderung der Bedeutung der Arbeit und die Notwendigkeit einer Anpassungsfähigkeit in einer dynamischen Arbeitswelt.
Schlüsselwörter
Die zentralen Themen des Textes umfassen lebenslanges Lernen, Selbstsozialisation, Bildungswandel, formale, non-formale und informelle Lernprozesse, Lernumwelten, vernetztes Lernen, ökonomische und soziale Entwicklung.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die drei Hauptbereiche des lebenslangen Lernens?
Es wird zwischen formalen Lernprozessen (Schule/Uni), nicht formalen (Arbeitsplatz/Vereine) und informellen Lernprozessen (unbewusstes Lernen im Alltag) unterschieden.
Was bedeutet der Begriff „lifewide learning“?
Dieser Begriff betont, dass Lernen systematisch auf die gesamte Lebensspanne und alle Lebensbereiche ausgedehnt werden sollte, nicht nur auf die Jugendphase.
Welche Gründe gibt es für den aktuellen Bildungswandel?
Hauptgründe sind der Wandel der Arbeitswelt, die Notwendigkeit ständiger Anpassungsfähigkeit und die ökonomische sowie soziale Entwicklung in einer dynamischen Gesellschaft.
Was versteht man unter informellen Lernprozessen?
Das sind Lernprozesse, die unbeabsichtigt und oft unbemerkt nebenbei ablaufen, wie zum Beispiel beim Radiohören, in Gesprächen oder beim Lesen einer Zeitschrift.
Welche Rolle spielt die Selbstsozialisation beim Lernen?
Selbstsozialisation beschreibt die aktive Gestaltung der eigenen Bildungsbiografie durch das Individuum in Wechselwirkung mit seiner Umwelt.
Was sind „Lernumwelten“ im Kontext des vernetzten Lernens?
Lernumwelten sind Kontexte abseits klassischer Institutionen, die Gelegenheiten für informelles und praxisnahes Lernen bieten.
- Quote paper
- Michael Vermöhlen (Author), 2005, Lebenslanges lernen und Selbstsozialisation, eine Einführung, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65153