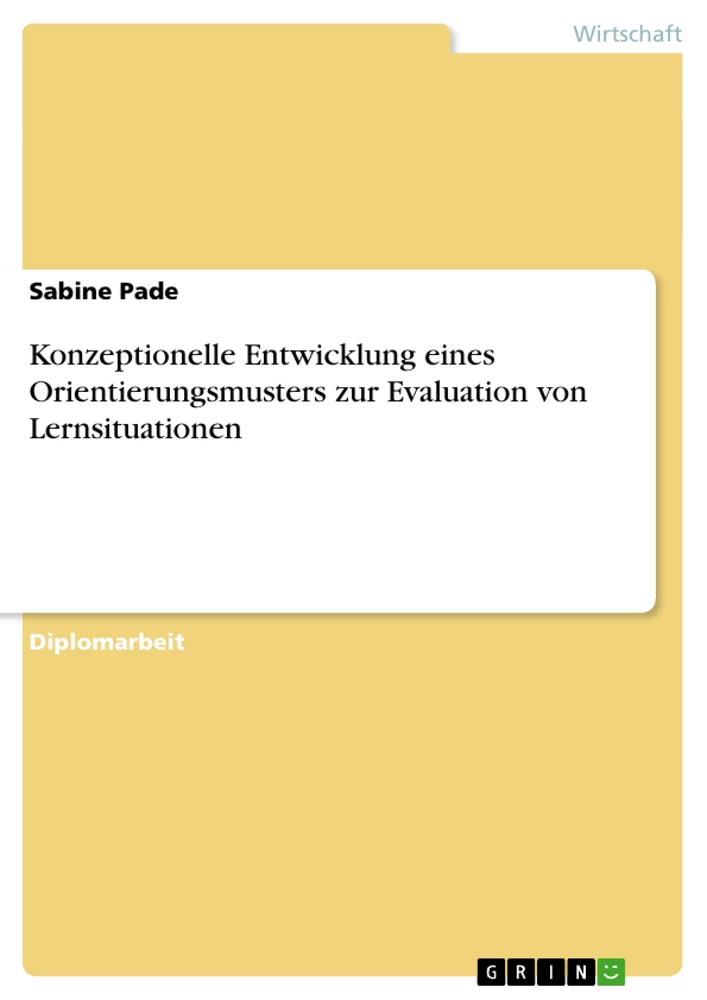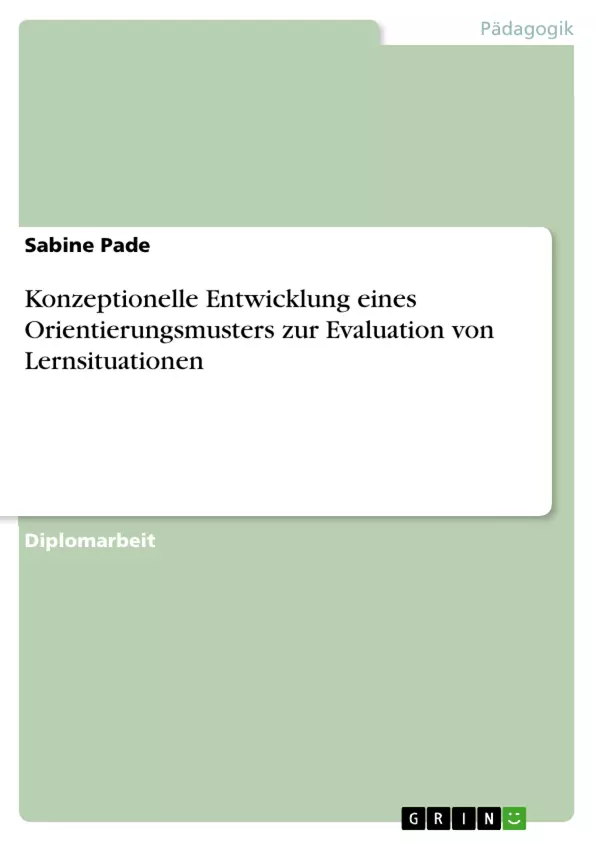Mit der „Handreichung für die Erarbeitung von Rahmenlehrplänen für den berufsbezogenen Unterricht in der Berufsschule“ durch die Kultusministerkonferenz (KMK) wurde seit 1996 eine neue Form der schulischen Curricula vorgegeben. Der Unterricht wird nicht mehr in traditionellen Fächern organisiert, sondern in Form von Lernfeldern vorstrukturiert, die sich an Handlungsfeldern (resp. Tätigkeitsfeldern) ausrichten, ohne diese deckungsgleich abzubilden. Somit fungieren nicht mehr Fächer als Ordnungssystem des Lehrplans, sondern Handlungssituationen. Die strukturellen Merkmale dieser Lernfeld curricula sind damit einerseits in dem fächerübergreifenden Ansatz bei inhaltlicher Offenheit und andererseits aber auch in einer Kompetenzorientierung und einem Tätigkeitsbezug zu sehen. „Lernfelder sind fächerübergreifende curriculare Einheiten“. Sie sind der Bezugspunkt zu den Inhalten, die von den Lehrkräften nun vor Ort in der Schule für die einzelnen Lernfelder auszudifferenzieren sind. Dabei sollen sie sich an beruflichen Tätigkeitsfeldern anlehnen. Über diese Kompetenzorientierung soll dann generell die berufliche Handlungskompetenz gefördert werden. Dieses Konstrukt ist nur schwer zu bestimmen.
Für SLOANE et al. lässt sich diese berufliche Handlungskompetenz als kategoriale Kompetenz in Form einer Matrix mit den Kategorien Domäne-Person-Gruppe auf der einen und Methode/Lernen-Sprache/Text-Ethik auf der anderen Seite operationalisieren, während BADER hierzu ausführt: “Berufliche Handlungskompetenz ist die Fähigkeit und Bereitschaft des Menschen, in beruflichen Situationen sach- und fachgerecht, persönlich durchdacht und in gesellschaftlicher Verantwortung zu handeln, d. h. anstehende Probleme zielorientiert auf der Basis von Wissen und Erfahrungen sowie durch eigene Ideen selbstständig zu lösen, die gefundenen Lösungen zu bewerten und seine Handlungsfähigkeit weiterzuentwickeln.“ Neben der schwierigen Begriffsbestimmung fehlt darüber hinaus eine Evaluation der Zielgröße beruflicher Handlungskompetenz im kaufmännischen Berufsfeld. Hier besteht ein erheblicher Forschungsbedarf.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1. Hintergrund und Ausgangslage
- 1.2. Problemstellung und Zielsetzung
- 1.3. Vorgehensweise
- 2. Curriculum
- 3. Das Lernfeldcurriculum
- 3.1. Charakteristika
- 3.2. Prinzipien
- 3.3. Aufbau
- 3.4. Implementation
- 4. Evaluation
- 4.1. Definition
- 4.2. Formen der Evaluation
- 4.3. Ziel und Funktionen der Evaluation
- 4.4. Gründe der Evaluation
- 4.5. Evaluierende Personen/Institutionen
- 5. Lernsituationen
- 5.1. Gestaltungsansätze von Lernsituationen
- 5.1.1. nach BADER
- 5.1.2. nach BUSCHFELD
- 5.1.3. nach KREMER/SLOANE
- 5.1.4. anderer Modellversuche: CULIK, NELE, SELUBA
- 5.2. Analyse der Gestaltungskriterien
- 5.3. Interpretation der Gestaltungskriterien
- 5.4. Entwicklung eines Orientierungsmusters
- 6. Evaluation von vier Lernsituationen im Ausbildungsberufsgang „Kauffrau/Kaufmann im Einzelhandel“/„Verkäuferin/Verkäufer“
- 6.1. Erste Evaluationsschritte: Erprobung des Orientierungsmusters
- 6.2. Evaluation der Lernsituationen anhand des Orientierungsmusters
- 6.3. Revision des Orientierungsmusters
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit verfolgt das Ziel, ein Orientierungsmuster zur Evaluation von Lernsituationen zu entwickeln. Dies geschieht auf der Grundlage einer Analyse verschiedener Gestaltungsansätze und deren Kriterien. Die Arbeit untersucht verschiedene Modelle zur Gestaltung von Lernsituationen und integriert diese in ein umfassendes Evaluationsmodell.
- Entwicklung eines Orientierungsmusters zur Evaluation von Lernsituationen
- Analyse verschiedener Gestaltungsansätze für Lernsituationen
- Kriterien zur Bewertung von Lernsituationen
- Anwendung des Orientierungsmusters in praktischen Beispielen
- Reflexion und Revision des entwickelten Orientierungsmusters
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Arbeit ein, beschreibt den Hintergrund und die Ausgangslage, formuliert die Problemstellung und die Zielsetzung der Arbeit sowie die gewählte Vorgehensweise. Es legt die Basis für die folgenden Kapitel, indem es den Kontext und die Forschungsfrage der Arbeit klar definiert. Die Bedeutung der Evaluation von Lernsituationen im Kontext der Wirtschaftspädagogik wird herausgestellt.
2. Curriculum: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über das Curriculum, welches den Rahmen für die Entwicklung und Evaluation von Lernsituationen bildet. Es skizziert die grundlegenden Konzepte und Prinzipien des Curriculums und erklärt deren Relevanz für die spätere Entwicklung des Orientierungsmusters. Der Fokus liegt hier auf der Struktur und den Inhalten des Curriculums, um den Kontext der nachfolgenden Analyse zu verdeutlichen.
3. Das Lernfeldcurriculum: In diesem Kapitel wird das Lernfeldcurriculum detailliert beschrieben. Die Charakteristika, Prinzipien, der Aufbau und die Implementierung des Lernfeldcurriculums werden erläutert, wobei der Zusammenhang zu den folgenden Kapiteln über Evaluation und Lernsituationen deutlich wird. Der Schwerpunkt liegt auf den besonderen Merkmalen des Lernfeldcurriculums, die für die Evaluation von Lernsituationen relevant sind. Hier wird die Grundlage für die spätere praktische Anwendung des entwickelten Orientierungsmusters geschaffen.
4. Evaluation: Dieses Kapitel widmet sich dem Thema Evaluation. Es definiert den Begriff "Evaluation", beschreibt verschiedene Formen der Evaluation und erläutert deren Ziele, Funktionen und Beweggründe. Es werden die beteiligten Personen und Institutionen benannt und ihre Rollen in der Evaluation skizziert. Das Kapitel dient dazu, das theoretische Fundament für die Entwicklung und Anwendung des Orientierungsmusters zu legen, indem es verschiedene Evaluationsansätze beleuchtet und ein Verständnis der verschiedenen Perspektiven auf den Evaluationsprozess schafft.
5. Lernsituationen: Das Kapitel analysiert verschiedene Gestaltungsansätze von Lernsituationen, indem es die Modelle von Bader, Buschfeld, Kremer/Sloane und weitere Modellversuche vorstellt und vergleicht. Es analysiert und interpretiert die Gestaltungskriterien dieser Modelle und mündet schließlich in der Entwicklung eines eigenen Orientierungsmusters. Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit, da es die theoretischen Grundlagen für das entwickelte Orientierungsmuster liefert. Die kritische Analyse der verschiedenen Modelle zeigt das fundierte Wissen der Autorin auf und bildet die Basis für die Entwicklung eines innovativen und praxisrelevanten Orientierungsmusters.
Schlüsselwörter
Evaluation von Lernsituationen, Lernfeldcurriculum, Orientierungsmuster, Gestaltungskriterien, Wirtschaftspädagogik, Berufsausbildung, Einzelhandel, didaktische Modelle.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Evaluation von Lernsituationen im Lernfeldcurriculum
Was ist das Thema der Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit befasst sich mit der Entwicklung eines Orientierungsmusters zur Evaluation von Lernsituationen im Lernfeldcurriculum, insbesondere im Kontext der Berufsausbildung im Einzelhandel (Kauffrau/Kaufmann im Einzelhandel und Verkäuferin/Verkäufer).
Welche Ziele verfolgt die Arbeit?
Das Hauptziel ist die Entwicklung eines praxisorientierten Orientierungsmusters zur systematischen Evaluation von Lernsituationen. Die Arbeit analysiert bestehende Gestaltungsansätze, identifiziert relevante Kriterien und integriert diese in ein umfassendes Evaluationsmodell. Die Anwendung des Modells wird an praktischen Beispielen aus dem Einzelhandel demonstriert.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit stützt sich auf eine Literaturanalyse verschiedener Gestaltungsansätze von Lernsituationen (Bader, Buschfeld, Kremer/Sloane u.a.). Die Analyse dieser Ansätze und deren Kriterien bildet die Grundlage für die Entwicklung des Orientierungsmusters. Das entwickelte Muster wird anschließend an vier Lernsituationen im Einzelhandel erprobt und evaluiert.
Welche Gestaltungsansätze für Lernsituationen werden untersucht?
Die Arbeit untersucht und vergleicht die Gestaltungsansätze von Bader, Buschfeld, Kremer/Sloane und weiteren Modellversuchen (Culik, Nele, Seluba). Diese werden hinsichtlich ihrer Gestaltungskriterien analysiert und interpretiert, um ein umfassendes Verständnis der verschiedenen Perspektiven zu erhalten.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in sechs Kapitel: Einleitung (Hintergrund, Problemstellung, Vorgehensweise), Curriculum, Lernfeldcurriculum, Evaluation (Definition, Formen, Ziele), Lernsituationen (Analyse verschiedener Gestaltungsansätze und Entwicklung des Orientierungsmusters), und schließlich die Evaluation von vier Lernsituationen im Einzelhandel mit anschließender Revision des Orientierungsmusters.
Was ist das Ergebnis der Arbeit?
Das Ergebnis ist ein entwickeltes und erprobtes Orientierungsmuster zur Evaluation von Lernsituationen. Dieses Muster ermöglicht eine systematische und nachvollziehbare Bewertung von Lernsituationen und trägt somit zur Qualitätssicherung der Berufsausbildung bei.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Evaluation von Lernsituationen, Lernfeldcurriculum, Orientierungsmuster, Gestaltungskriterien, Wirtschaftspädagogik, Berufsausbildung, Einzelhandel, didaktische Modelle.
Für wen ist diese Arbeit relevant?
Diese Arbeit ist relevant für Lehrende, Ausbilder, Curriculum-Entwickler und alle, die sich mit der Gestaltung und Evaluation von Lernsituationen in der beruflichen Bildung, insbesondere im Einzelhandel, auseinandersetzen.
Wo kann man die vollständige Arbeit einsehen?
Die vollständige Arbeit ist [hier den Zugriff einfügen, z.B. "in der Universitätsbibliothek X einsehbar" oder "auf Anfrage beim Verfasser erhältlich"].
- Quote paper
- Sabine Pade (Author), 2005, Konzeptionelle Entwicklung eines Orientierungsmusters zur Evaluation von Lernsituationen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65156