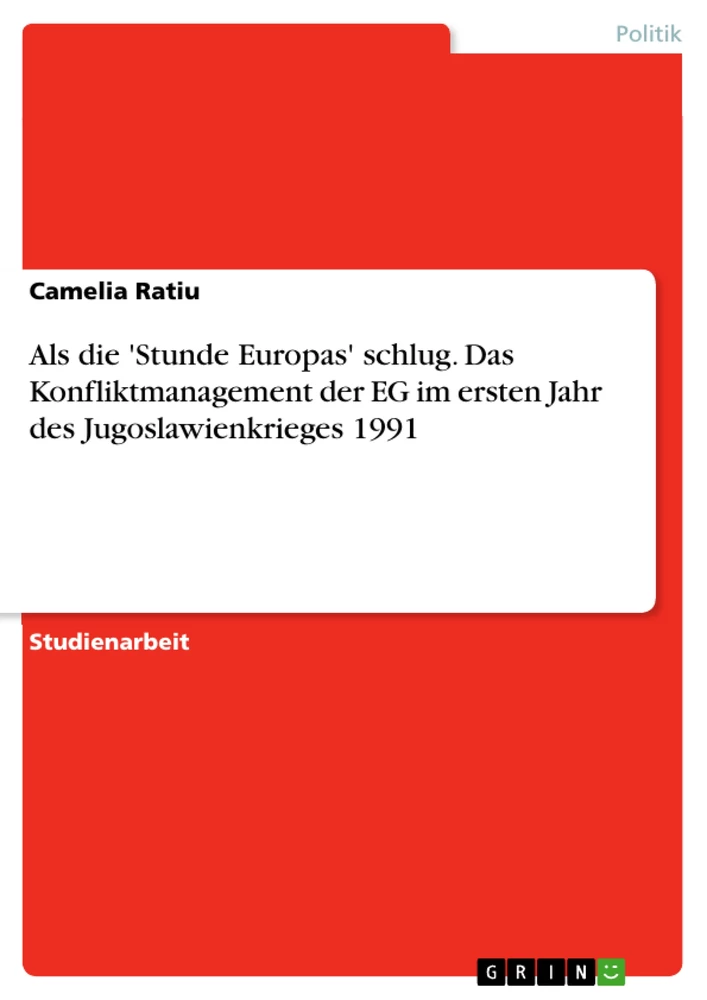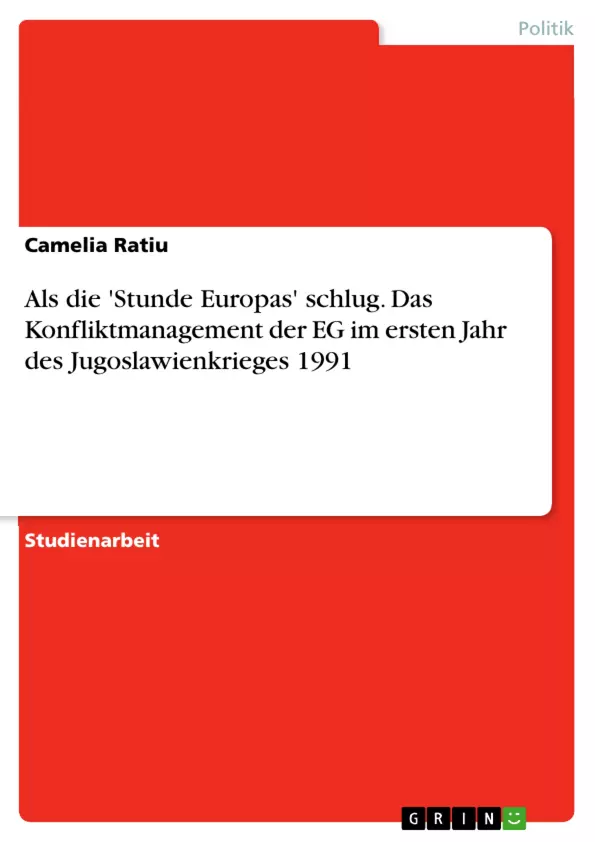Der Krieg im ehemaligen Jugoslawien zwischen den Jahren 1991 und 1995 stellte die erste Bewährungsprobe für die europäische Sicherheitsordnung nach dem Ende des Ost-West-Konflikts dar und geriet für die Europäische Gemeinschaft zu einem außerordentlichen Fehlschlag. Aufgrund ihrer geografischen Nähe und ihrer Bedeutung als Wertegemeinschaft kam der EG Anfang der neunziger Jahre die Hauptverantwortung für die friedliche Gestaltung des postkommunistischen Übergangs in Mittel- und Osteuropa zu. Dementsprechend wurde der gewaltsame Zerfall der jugoslawischen Föderation ursprünglich als eine ausschließlich europäische Angelegenheit begriffen. Bald sollte sich jedoch zeigen, dass die Europäer dieser neuen Herausforderung nicht gewachsen waren. Weder vermochte die EG angesichts der Zuspitzung der innerjugoslawischen Krise gewaltvorbeugend zu wirken, noch gelang es ihr, nach Kriegsausbruch eine wirkungsvolle Konfliktregulierungsstrategie zu entwickeln um die kriegerischen Auseinandersetzungen auf dem Balkan zu beendigen. Bis heute haben die Europäer durch die Bewältigung der enormen Folgekosten des Jugoslawienkonflikts den Preis für ihre Unfähigkeit zu entrichten, der Rückkehr des Krieges nach Europa frühzeitig und entschlossen entgegenzutreten. Vor diesem aktuellen Hintergrund erscheint es angebracht, die Lehren aus dieser Erfahrung zu ziehen.
Ziel der vorliegenden Arbeit ist somit, die Gründe für das Scheitern der Konfliktregulierungsversuche der EG im Jugoslawienkrieg näher zu untersuchen. Die Analyse des europäischen Konfliktmanagements beschränkt sich allerdings auf das Jahr 1991, das der damalige EG-Ratspräsident und luxemburgische Außenminister Jacques Poos ursprünglich voller Hoffnung als „die Stunde Europas“ bezeichnet hatte. In diesem Zeitraum übernahm die Gemeinschaft die führende Rolle in den internationalen Vermittlungsbemühungen und hatte die Gelegenheit, sich als Garant europäischer Sicherheit zu behaupten. Stattdessen wurde ihr jedoch die eigene Handlungsunfähigkeit schmerzhaft vor Augen geführt.
Das erste Kapitel der Arbeit beschäftigt sich mit den Ursachen und der Entwicklung der jugoslawischen Krise Ende der achtziger Jahre. Im zweiten Kapitel wird auf die ordnungpolitischen Interessen der EG im jugoslawischen Raum eingegangen, ebenso wie auf die Gründe für die Fehleinschätzung der innerjugoslawischen Situation durch die Gemeinschaft.
Inhaltsverzeichnis
- I. Einleitung
- II. Zur Vorgeschichte: die Entwicklung der jugoslawischen Krise um die Wende 1989/90
- III. Die ordnungspolitischen Interessen und die ungenügende Konfliktwahrnehmung der EG
- IV. Der Stand der EPZ zu Beginn des Jugoslawienkrieges
- V. Das Konfliktmanagement der Europäischen Gemeinschaft 1991
- 5.1. Die gescheiterte Konfliktprevention
- 5.2. Das Abkommen von Brioni
- 5.3. Die Absage an einen Peacekeeping-Einsatz der WEU
- 5.4. Die EG-Beobachtermission
- 5.5. Die Einrichtung der Haager Friedenskonferenz
- 5.6. Das Scheitern des EG-Friedensplans und die Einschaltung der UNO
- 5.7. Die strittige Anerkennungspolitik der EG
- VI. Die Rolle der drei EG-Großmächte Deutschland, Frankreich und Großbritannien
- 6.1. Die Haltung Deutschlands
- 6.2. Die Haltung Frankreichs
- 6.3. Die Haltung Großbritanniens
- VII. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit untersucht die Gründe für das Scheitern der Konfliktregulierungsversuche der EG im Jugoslawienkrieg. Der Fokus liegt dabei auf dem Jahr 1991, welches der damalige EG-Ratspräsident Jacques Poos als „die Stunde Europas“ bezeichnete. Die Arbeit analysiert die Handlungsunfähigkeit der EG im Angesicht der jugoslawischen Krise und die Folgen für die europäische Sicherheitsordnung.
- Die Entwicklung der jugoslawischen Krise und die politischen Interessen der EG im jugoslawischen Raum.
- Die strukturellen Schwächen der Europäischen Politischen Zusammenarbeit (EPZ) und ihre Auswirkungen auf die Krisenreaktionsfähigkeit der EG.
- Die gescheiterte Konfliktprevention der EG und die mangelnde Wirksamkeit der Maßnahmen zur Konfliktbewältigung.
- Die Rolle der drei EG-Großmächte Deutschland, Frankreich und Großbritannien im Jugoslawienkonflikt.
- Die Folgen des gescheiterten europäischen Konfliktmanagements für die europäische Sicherheitsordnung.
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel behandelt die Ursachen und die Entwicklung der jugoslawischen Krise Ende der 1980er Jahre. Es zeigt auf, wie die inneren Spannungen und der Verlust der strategischen Sonderstellung Jugoslawiens im Zuge des Ost-West-Konflikts zu einer tiefen Krise führten, die entlang ethnischer Linien artikuliert wurde. Das zweite Kapitel beleuchtet die ordnungspolitischen Interessen der EG im jugoslawischen Raum und erklärt, warum die Gemeinschaft die Situation falsch einschätzte. Es wird erläutert, dass die EG zwar eine friedliche Gestaltung des postkommunistischen Übergangs in Mittel- und Osteuropa anstrebte, jedoch die wachsenden Spannungen in Jugoslawien unterschätzte. Das dritte Kapitel beleuchtet den Stand der Europäischen Politischen Zusammenarbeit zu Beginn des Jugoslawienkrieges und analysiert, wie die politischen und strukturellen Schwächen der EPZ die Krisenreaktionsfähigkeit der EG beeinträchtigten. Das vierte Kapitel konzentriert sich auf die Jugoslawienpolitik der EG im ersten Kriegsjahr. Es untersucht die Wirksamkeit der Maßnahmen zur Konfliktbewältigung, von der gescheiterten Konfliktprevention über das Abkommen von Brioni bis hin zur strittigen Anerkennungspolitik der EG.
Schlüsselwörter
Jugoslawienkrieg, Europäische Gemeinschaft (EG), Konfliktmanagement, Konfliktprevention, Europäische Politische Zusammenarbeit (EPZ), jugoslawische Krise, nationale Interessen, ethnische Konflikte, Friedenskonferenz, Anerkennungspolitik, Deutschland, Frankreich, Großbritannien.
Häufig gestellte Fragen
Warum wird das Jahr 1991 als "Stunde Europas" bezeichnet?
Der Begriff stammt vom damaligen EG-Ratspräsidenten Jacques Poos, der hoffte, dass die Europäische Gemeinschaft den Jugoslawienkonflikt eigenständig und friedlich lösen würde.
Warum scheiterte das Konfliktmanagement der EG in Jugoslawien?
Gründe waren strukturelle Schwächen der Europäischen Politischen Zusammenarbeit (EPZ), mangelnde Konfliktprävention und uneinheitliche nationale Interessen der Mitgliedsstaaten.
Welche Rolle spielten Deutschland, Frankreich und Großbritannien?
Die drei Großmächte verfolgten teils unterschiedliche Strategien, insbesondere bei der Frage der Anerkennung der Unabhängigkeit sloweniens und Kroatiens.
Was war das Abkommen von Brioni?
Es war ein Vermittlungsversuch der EG im Juli 1991, um den Zehn-Tage-Krieg in Slowenien zu beenden und weitere Kampfhandlungen in Jugoslawien zu verhindern.
Was war die Haager Friedenskonferenz?
Die EG richtete diese Konferenz ein, um eine politische Gesamtlösung für die jugoslawische Krise zu finden, was jedoch letztlich am Widerstand der Konfliktparteien scheiterte.
Was waren die Folgen des gescheiterten Konfliktmanagements?
Das Scheitern führte zu einem langjährigen Krieg auf dem Balkan und machte die Einschaltung der UNO sowie später der NATO notwendig.
- Citar trabajo
- Camelia Ratiu (Autor), 2005, Als die 'Stunde Europas' schlug. Das Konfliktmanagement der EG im ersten Jahr des Jugoslawienkrieges 1991, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65175