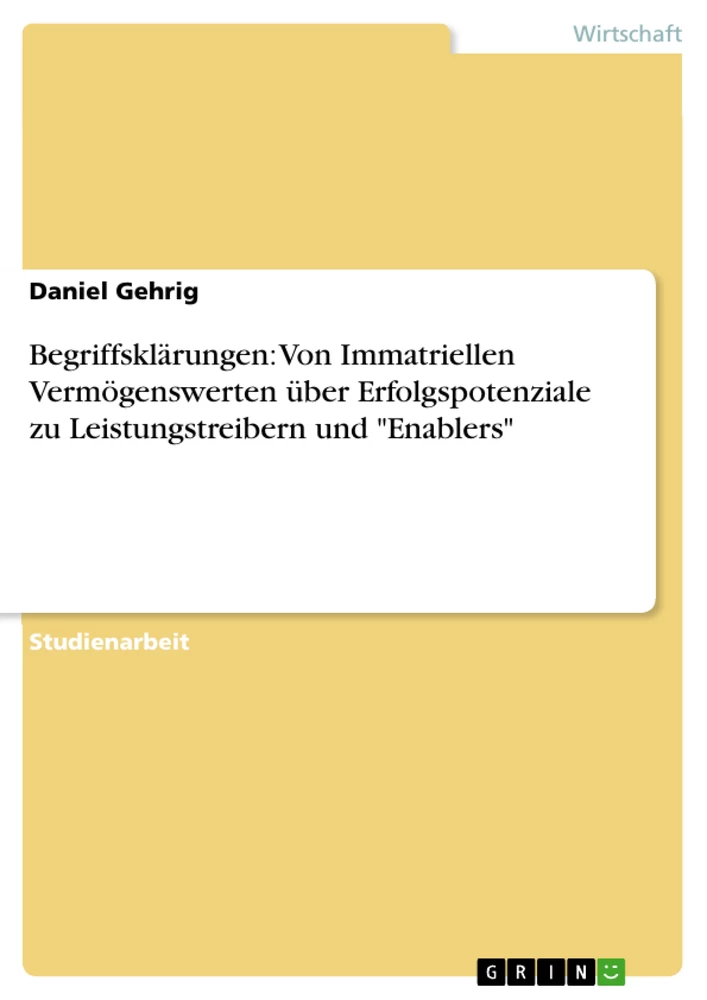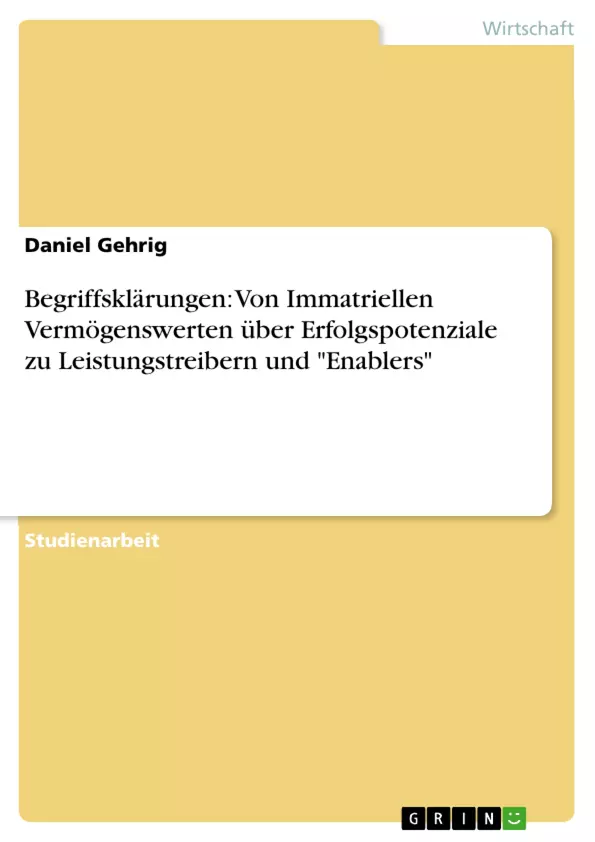Im Controlling und der Betriebswirtschaft allgemein werden oftmals für ein und die selbe Bedeutung mehrere Begriffe angewandt. Dieses Phänomen wird auch in der folgenden Arbeit durchleuchtet. Hierzu werden die vier Begriffe zunächst umfangreich erläutert. Als Fazit wird vom Autor die Vernetzung dieser Begriffe aufgezeigt und deren gleichsame Bedeutung für das Unternehmen beschrieben.
Inhaltsverzeichnis
- Immaterielle Vermögenswerte
- Vorschriften nach IAS/IFRS
- Vorschriften nach HGB
- Fazit zu immateriellen Vermögenswerten
- Erfolgspotenziale
- Leistungstreiber
- Balanced Scorecard
- Definition: Leistungstreiber
- Enablers
- EFQM
- Definition: Enablers
- Führung
- Mitarbeiter
- Politik und Strategie
- Partner und Ressourcen
- Prozesse
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit befasst sich mit der Klärung des Begriffsverständnisses immaterieller Vermögenswerte und deren Bedeutung für den Unternehmenserfolg. Sie untersucht den Zusammenhang zwischen immateriellen Vermögenswerten, Erfolgspotenzialen, Leistungstreibern und Enablern. Die Arbeit analysiert die bilanzrechtlichen Vorschriften nach HGB und IAS/IFRS für immaterielle Vermögenswerte.
- Bilanzierung immaterieller Vermögenswerte nach HGB und IAS/IFRS
- Definition und Abgrenzung immaterieller Vermögenswerte
- Erfolgspotenziale und deren Beziehung zu immateriellen Vermögenswerten
- Leistungstreiber als Indikatoren für den Unternehmenserfolg
- Die Rolle von Enablern für die Entwicklung und Umsetzung von Strategien
Zusammenfassung der Kapitel
Immaterielle Vermögenswerte: Dieses Kapitel analysiert die zunehmende Bedeutung immaterieller Vermögenswerte für die Bewertung von Unternehmen. Es wird auf die Diskrepanz zwischen Marktwert und Buchwert eingegangen und die Herausforderungen für traditionelle rechnungswesenbasierte Informationssysteme hervorgehoben, die die Bewertung und Erfassung dieser Werte erschweren. Die Arbeit beleuchtet die Bedeutung zukünftiger Cashflows und Erlöse und benennt Beispiele immaterieller Vermögenswerte wie Wissen der Mitarbeiter, Innovationskraft und Kundenbeziehungen. Schließlich wird die Problematik der Bewertung und Bilanzierung dieser Vermögenswerte angesprochen, da diese trotz ihres Wertes schwer zu erfassen sind.
Vorschriften nach IAS/IFRS: Dieses Kapitel beschreibt die Definition immaterieller Vermögenswerte nach IAS 38.8 als identifizierbare, nicht-monetäre Vermögenswerte ohne physische Substanz. Es werden die Ansatzkriterien nach IAS 38 detailliert erläutert, einschließlich Identifizierbarkeit (Separierbarkeit und Rechtentstehung) und Verfügungsmacht. Das Kapitel betont die Notwendigkeit, dass diese Vermögenswerte einen zukünftigen wirtschaftlichen Nutzen stiften und sich eindeutig von anderen Posten abgrenzen lassen. Ein Beispiel ist die Software eines Unternehmens wie Microsoft, die veräußert werden soll.
Vorschriften nach HGB: Dieses Kapitel erläutert die bilanzrechtlichen Vorschriften für immaterielle Vermögenswerte nach dem Handelsgesetzbuch (HGB). Es wird zwischen entgeltlich erworbenen und selbst geschaffenen immateriellen Vermögenswerten unterschieden. Während entgeltlich erworbene Vermögenswerte grundsätzlich in der Bilanz zu aktivieren sind (Umkehrschluss aus §246 HGB), besteht für selbst geschaffene Vermögenswerte im Anlagevermögen ein generelles Ansatzverbot (§248 HGB). Eine Ausnahme besteht für selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte im Umlaufvermögen, wie beispielsweise Software im Rahmen einer Auftragsfertigung mit vereinbartem Festpreis.
Fazit zu immateriellen Vermögenswerten: Dieses Kapitel vergleicht die unterschiedlichen Definitionen von immateriellen Vermögenswerten, insbesondere die Definitionen des intellektuellen Kapitals (differenziert in Human-, Struktur- und Beziehungskapital) und die Definition nach IAS 38.8. Es fasst die wichtigsten Aspekte der vorherigen Kapitel zusammen und hebt die Herausforderungen bei der Bewertung und Bilanzierung dieser Vermögenswerte hervor.
Schlüsselwörter
Immaterielle Vermögenswerte, Intangible Assets, IAS 38, HGB, Bilanzierung, Erfolgspotenziale, Leistungstreiber, Enabler, Intellektuelles Kapital, Human-Kapital, Strukturkapital, Beziehungskapital, Bewertung, Zukunftsorientierung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ): Seminararbeit zu Immateriellen Vermögenswerten, Erfolgspotenzialen und Leistungstreibern
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht das Verständnis immaterieller Vermögenswerte und deren Bedeutung für den Unternehmenserfolg. Sie analysiert den Zusammenhang zwischen immateriellen Vermögenswerten, Erfolgspotenzialen, Leistungstreibern und Enablern und beleuchtet die bilanzrechtlichen Vorschriften nach HGB und IAS/IFRS für immaterielle Vermögenswerte.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt die Bilanzierung immaterieller Vermögenswerte nach HGB und IAS/IFRS, die Definition und Abgrenzung immaterieller Vermögenswerte, Erfolgspotenziale und deren Beziehung zu immateriellen Vermögenswerten, Leistungstreiber als Indikatoren für den Unternehmenserfolg und die Rolle von Enablern für die Entwicklung und Umsetzung von Strategien. Konkret werden die Vorschriften nach IAS 38 und HGB detailliert erläutert.
Wie werden immaterielle Vermögenswerte nach IAS/IFRS bilanziert?
Das Kapitel zu IAS/IFRS beschreibt die Definition immaterieller Vermögenswerte nach IAS 38.8 als identifizierbare, nicht-monetäre Vermögenswerte ohne physische Substanz. Es erläutert die Ansatzkriterien, einschließlich Identifizierbarkeit (Separierbarkeit und Rechtentstehung) und Verfügungsmacht. Die Vermögenswerte müssen einen zukünftigen wirtschaftlichen Nutzen stiften und sich von anderen Posten abgrenzen lassen.
Wie werden immaterielle Vermögenswerte nach HGB bilanziert?
Das Kapitel zum HGB unterscheidet zwischen entgeltlich erworbenen und selbst geschaffenen immateriellen Vermögenswerten. Entgeltlich erworbene Vermögenswerte sind grundsätzlich zu aktivieren (Umkehrschluss aus §246 HGB), während für selbst geschaffene Vermögenswerte im Anlagevermögen ein generelles Ansatzverbot (§248 HGB) besteht. Ausnahmen gibt es für selbst erstellte immaterielle Vermögenswerte im Umlaufvermögen (z.B. Software in der Auftragsfertigung).
Was sind die wichtigsten Herausforderungen bei der Bilanzierung immaterieller Vermögenswerte?
Die Bewertung und Bilanzierung immaterieller Vermögenswerte ist herausfordernd, da diese trotz ihres Wertes schwer zu erfassen sind. Die Arbeit hebt die Diskrepanz zwischen Marktwert und Buchwert und die Herausforderungen für traditionelle rechnungswesenbasierte Informationssysteme hervor. Die Bewertung zukünftiger Cashflows und Erlöse spielt eine zentrale Rolle.
Welche Rolle spielen Erfolgspotenziale und Leistungstreiber?
Die Seminararbeit untersucht den Zusammenhang zwischen immateriellen Vermögenswerten, Erfolgspotenzialen und Leistungstreibern. Leistungstreiber werden als Indikatoren für den Unternehmenserfolg betrachtet. Die Arbeit analysiert die Bedeutung dieser Faktoren für den Unternehmenserfolg.
Was sind Enabler und welche Rolle spielen sie?
Enabler sind Faktoren, die die Entwicklung und Umsetzung von Strategien unterstützen. Die Seminararbeit untersucht die Rolle von Enablern im Kontext immaterieller Vermögenswerte und des Unternehmenserfolgs. Beispiele für Enabler umfassen Führung, Mitarbeiter, Politik und Strategie, Partner und Ressourcen sowie Prozesse.
Was sind die Schlüsselwörter der Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Immaterielle Vermögenswerte, Intangible Assets, IAS 38, HGB, Bilanzierung, Erfolgspotenziale, Leistungstreiber, Enabler, Intellektuelles Kapital, Human-Kapital, Strukturkapital, Beziehungskapital, Bewertung, Zukunftsorientierung.
Wie werden immaterielle Vermögenswerte definiert?
Die Arbeit vergleicht verschiedene Definitionen, insbesondere die Definitionen des intellektuellen Kapitals (Human-, Struktur- und Beziehungskapital) und die Definition nach IAS 38.8. Beispiele immaterieller Vermögenswerte sind Wissen der Mitarbeiter, Innovationskraft und Kundenbeziehungen.
- Quote paper
- Daniel Gehrig (Author), 2006, Begriffsklärungen: Von Immatriellen Vermögenswerten über Erfolgspotenziale zu Leistungstreibern und "Enablers", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65302