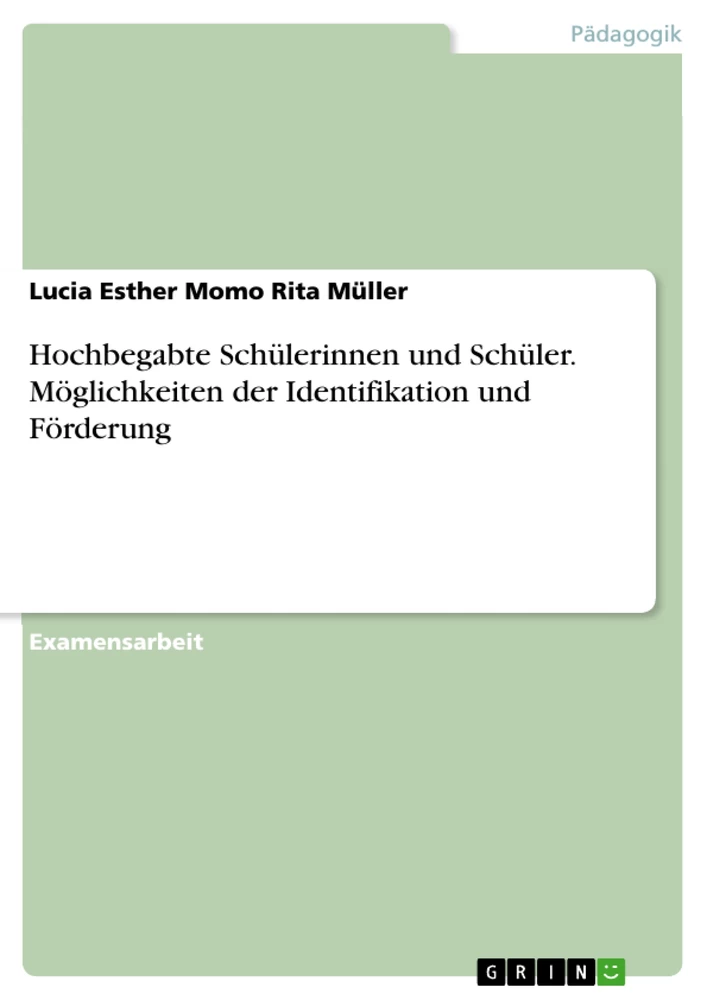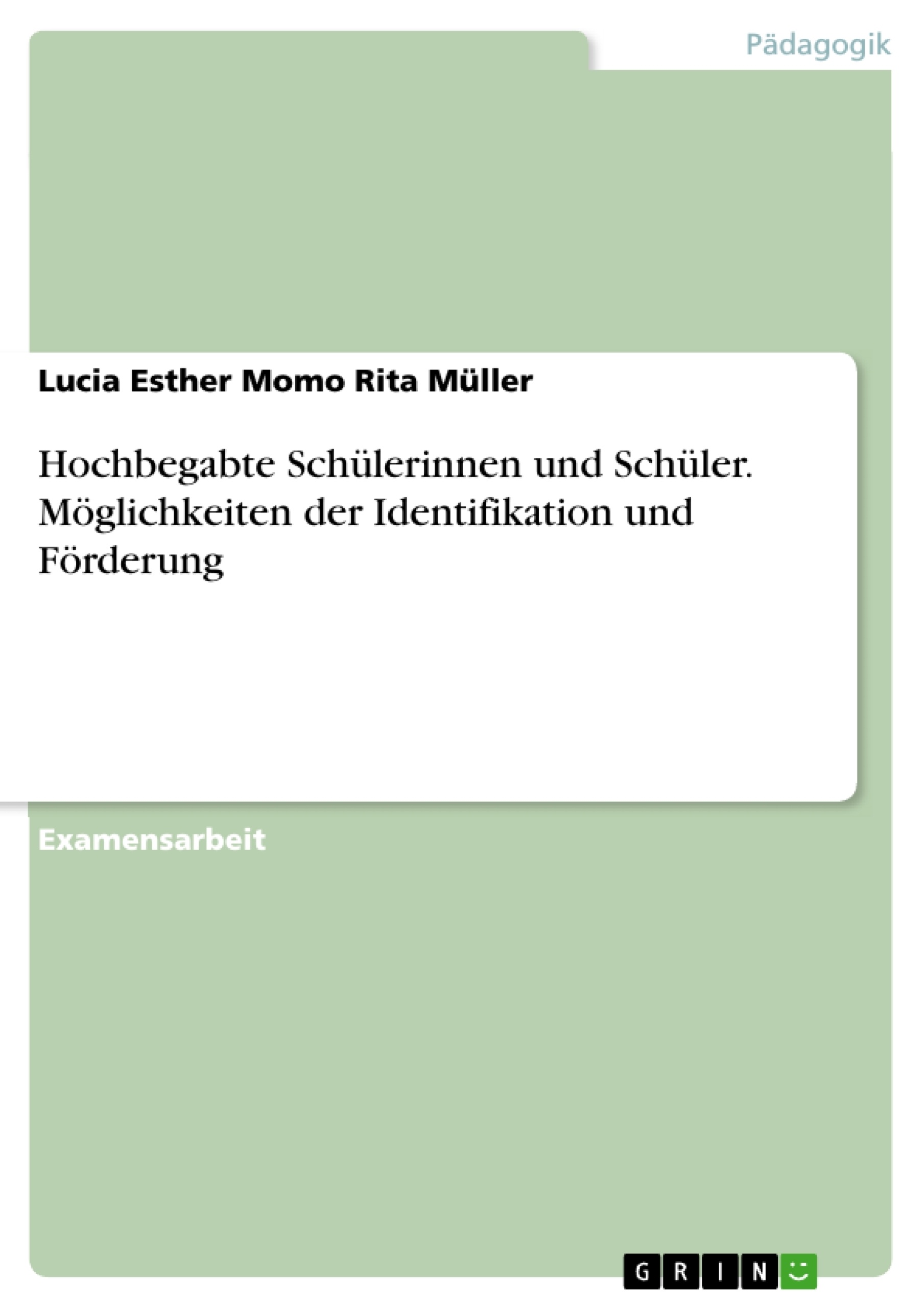Die vorliegende Arbeit richtet sich in erster Linie an (zukünftige) Lehrkräfte, da Hochbegabung im schulischen Umfeld den Schwerpunkt der Betrachtungen und Analyse darstellt. Darüber hinaus sollen Eltern hochbegabter Kinder auf Möglichkeiten der Identifikation und Förderung aufmerksam gemacht werden.
Der Anteil hochbegabter Kinder und Jugendlicher liegt in Deutschland bei 2-3 Prozent pro Jahrgang. Geht man von einer Klassenstärke von 25 bis 30 Kindern aus, so folgt, dass rechnerisch gesehen in ungefähr jeder zweiten Schulklasse ein hochbegabtes Kind sitzt. Hochbegabung ist demnach ein durchaus präsentes Phänomen in den Schulen, mit dem es sich auseinander zu setzen lohnt.
Ziel dieser Arbeit ist zuächst, jene Fragen zu klären, die sich im Zusammenhang mit dem oftmals unreflektiert verwendeten Begriff der Hochbegabung ergeben. Neben einer Begriffsbestimmung und der Systematisierung unterschiedlicher Hochbegabungsdefinitionen sollen ausgewählte Modelle der Hochbegabung vorgestellt werden.
Im Anschluss wird dargelegt, welche Eigenschaften typisch für das Verhalten hochbegabter Kinder und Jugendlicher sind. In der Tat unterscheiden sich intellektuell hochbegabte Schülerinnen und Schüler in einer Reihe von Merkmalen von ihren durchschnittlich begabten Altersgenossen. Hieraus können sich verschiedene Schwierigkeiten schulischer, persönlicher und sozialer Art ergeben. Es wird daher auf mögliche Problemfelder, wie schulische Unterforderung und Minderleistung, eingegangen.
In den folgenden Abschnitten dieser Arbeit werden Möglichkeiten der Identifikation und Förderung hochbegabter Schülerinnen und Schüler angesprochen. Neben der Bedeutung und Notwendigkeit von Diagnose werden Überlegungen zu deren Zeitpunkt und möglichen Fehlern dargelegt. Schließlich sollen verschiedene Verfahren zur Identifikation Hochbegabter vorgestellt und bewertet werden.
Im anschließenden Kapitel zur Hochbegabtenförderung soll zunächst geklärt werden, weshalb hochbegabte Kinder und Jugendliche überhaupt einer Förderung bedürfen. Nach einigen allgemeinen Überlegungen die Förderung betreffend, sollen mögliche Förderformen für hochbegabte Schülerinnen und Schüler dargelegt und bewertet werden. Ziel ist eine Darstellung dessen, was bereits möglich ist, vielerorts aber schlichtweg mangels Information oder Engagement nicht umgesetzt wird.
Ingesamt soll dazu beigetragen werden, hochbegabte Kinder und Jugendliche besser verstehen, erkennen und fördern zu können
Inhaltsverzeichnis
- Vorbemerkung
- I. Einleitung
- II. Was ist intellektuelle Hochbegabung?
- 1. Was ist Intelligenz?
- 1.1. Definitionen der Intelligenz.
- 1.2. BIS - das Berliner Intelligenzstrukturmodell
- 2. Zur Definition von intellektueller Hochbegabung
- 2.1. Systematisierung diverser Hochbegabungsdefinitionen
- 2.2. Modelle der Hochbegabung
- 2.2.1. Renzullis „Drei-Ringe-Modell“ und Erweiterungen
- 2.2.2. Das Münchener (Hoch-)Begabungsmodell von Heller, Perleth und Hany
- 1. Was ist Intelligenz?
- III. Merkmale im Verhalten hochbegabter Kinder und Jugendlicher und mögliche Problemfelder
- 1. Merkmale hochbegabter Kinder und Jugendlicher
- 2. Mögliche Problemfelder
- 2.1. Dyssynchronien
- 2.2. Soziale Konflikte
- 2.3. Schulische Unterforderung
- 3. Schulische Minderleistung bei intellektueller Hochbegabung
- IV. Möglichkeiten der Identifikation
- 1. Bedeutung und Notwendigkeit von Diagnose.
- 2. Zeitpunkt einer Diagnose
- 3. Mögliche Diagnosefehler
- 4. Verschiedene Verfahren zur Identifikation Hochbegabter
- 4.1. Informelle Verfahren
- 4.1.1. Das Lehrerurteil
- 4.1.2. Nominierung durch die Eltern
- 4.1.3 Checklisten
- 4.1.4. Nominierung durch Gleichaltrige
- 4.1.5. Selbstnominierung
- 4.1.6 Zensuren
- 4.2. Formelle Verfahren - Intelligenztests
- 4.3. Identifikation hochbegabter Underachiever
- 4.1. Informelle Verfahren
- V. Hochbegabtenförderung
- 1. Begründung einer Förderung
- 2. Allgemeine Überlegungen
- 2.1. Akzeleration und Enrichment
- 2.2. Integration versus Segregation
- 3. Förderungsformen
- 3.1. Akzelerationsansätze
- 3.1.1. Vorzeitige Einschulung
- 3.1.2. Flexible Eingangsphase
- 3.1.3. Überspringen von Klassen
- 3.1.4. Gruppenspringen
- 3.1.5. Teilunterricht in anderen Klassen – das Drehtürmodell
- 3.1.6. D-Zug Klassen
- 3.2. Enrichmentansätze
- 3.2.1. AG-Modelle und Kurse
- 3.2.2. Spezielle Schulzüge – zusätzliche Fremdsprachen und Leistungskurse
- 3.2.3. Schülerwettbewerbe
- 3.2.4. Außerschulische Angebote
- 3.2.4.1. Schülerakademien und Sommerprogramme
- 3.2.4.2. Kooperation von Schulen und außerschulischen Einrichtungen
- 3.3. Mischformen und weitere Förderungsmöglichkeiten
- 3.3.1. Binnendifferenzierung
- 3.3.2. Spezialschulen und Schulen mit Hochbegabtenklassen
- 3.3.3. Auslandsjahr
- 3.1. Akzelerationsansätze
- VI. Zusammenfassung und abschließende Bemerkungen
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die wissenschaftliche Arbeit befasst sich mit dem Thema der intellektuellen Hochbegabung bei Schülerinnen und Schülern. Ziel ist es, ein umfassendes Verständnis von Hochbegabung zu entwickeln und die Herausforderungen und Chancen im Kontext der schulischen Förderung zu beleuchten. Die Arbeit betrachtet dabei verschiedene Definitionen von Hochbegabung, analysiert die Merkmale hochbegabter Kinder und Jugendlicher, diskutiert die Bedeutung der Identifikation und beleuchtet verschiedene Förderungsansätze.
- Definitionen von Hochbegabung und ihre Bedeutung
- Merkmale und Fähigkeiten von Hochbegabten
- Mögliche Problemfelder und Herausforderungen für hochbegabte Kinder und Jugendliche
- Methoden zur Identifikation von Hochbegabung und deren Grenzen
- Verschiedene Ansätze der Hochbegabtenförderung und deren Wirksamkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Hochbegabung ein und skizziert die Relevanz des Themas für die schulische Praxis. Die Arbeit analysiert zunächst verschiedene Definitionen von Intelligenz und Intellektueller Hochbegabung und stellt verschiedene Modelle der Hochbegabung vor. Die Untersuchung des Verhaltens hochbegabter Kinder und Jugendlicher zeigt die spezifischen Stärken und Schwächen sowie mögliche Problemfelder wie Dyssynchronien, soziale Konflikte und schulische Unterforderung auf. Die Arbeit diskutiert die Bedeutung und Notwendigkeit einer frühzeitigen Diagnose, beleuchtet mögliche Fehlerquellen und stellt unterschiedliche Verfahren zur Identifikation hochbegabter Kinder und Jugendlicher vor. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der Unterscheidung zwischen informellen und formellen Verfahren. Schließlich untersucht die Arbeit verschiedene Förderungsformen, differenziert zwischen Akzelerations- und Enrichmentansätzen und beleuchtet Mischformen und weitere Möglichkeiten.
Schlüsselwörter
Intellektuelle Hochbegabung, Intelligenz, Hochbegabungsdefinitionen, Merkmale hochbegabter Kinder und Jugendlicher, Problemfelder, Identifikation, Diagnose, Förderungsformen, Akzeleration, Enrichment, Integration, Segregation.
Häufig gestellte Fragen
Wie wird intellektuelle Hochbegabung definiert?
Hochbegabung wird meist über einen Intelligenzquotienten (IQ) von über 130 definiert. Modelle wie Renzullis „Drei-Ringe-Modell“ ergänzen dies um Faktoren wie Kreativität und Zielstrebigkeit.
Was ist der Unterschied zwischen Akzeleration und Enrichment?
Akzeleration bedeutet das schnellere Durchlaufen der Schullaufbahn (z.B. Klassenüberspringen). Enrichment bezeichnet die Vertiefung und Erweiterung von Lerninhalten über den normalen Lehrplan hinaus.
Was versteht man unter einem "Underachiever"?
Ein Underachiever ist ein hochbegabter Schüler, dessen tatsächliche Schulleistungen deutlich hinter seinem intellektuellen Potenzial zurückbleiben, oft aufgrund von Unterforderung oder Motivationsmangel.
Welche Problemfelder können bei hochbegabten Kindern auftreten?
Typische Probleme sind soziale Isolation, schulische Unterforderung, soziale Konflikte mit Gleichaltrigen und sogenannte Dyssynchronien (ungleichmäßige Entwicklung von Geist und Motorik/Emotion).
Welche Verfahren zur Identifikation von Hochbegabung gibt es?
Man unterscheidet informelle Verfahren (Lehrerurteil, Nominierung durch Eltern, Checklisten) und formelle Verfahren (standardisierte Intelligenztests).
- Arbeit zitieren
- Lucia Esther Momo Rita Müller (Autor:in), 2005, Hochbegabte Schülerinnen und Schüler. Möglichkeiten der Identifikation und Förderung, München, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65317