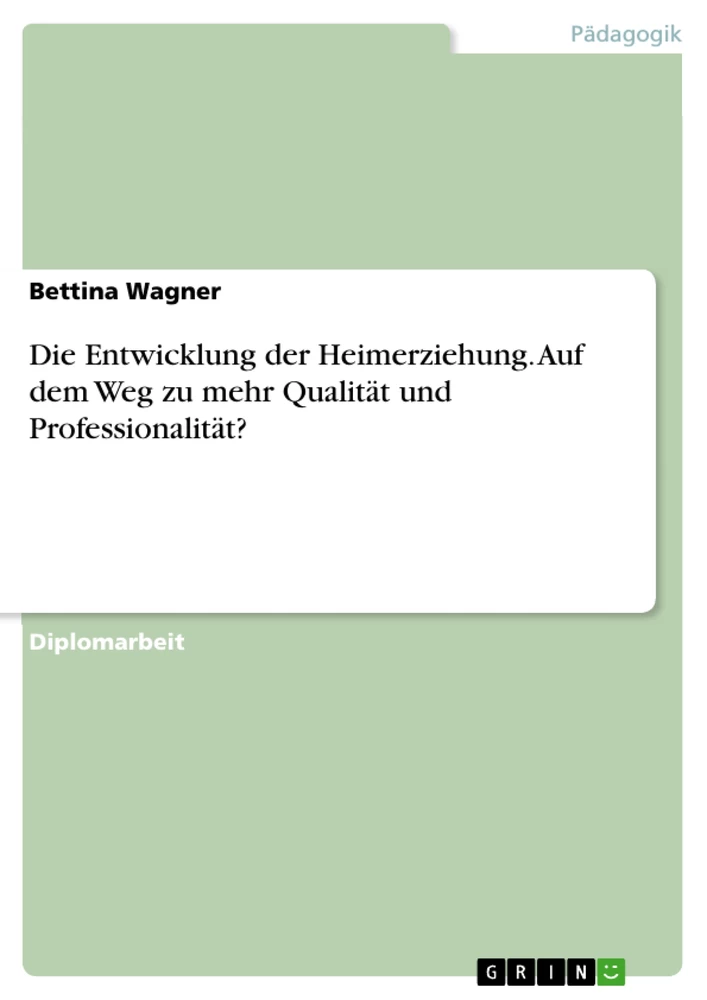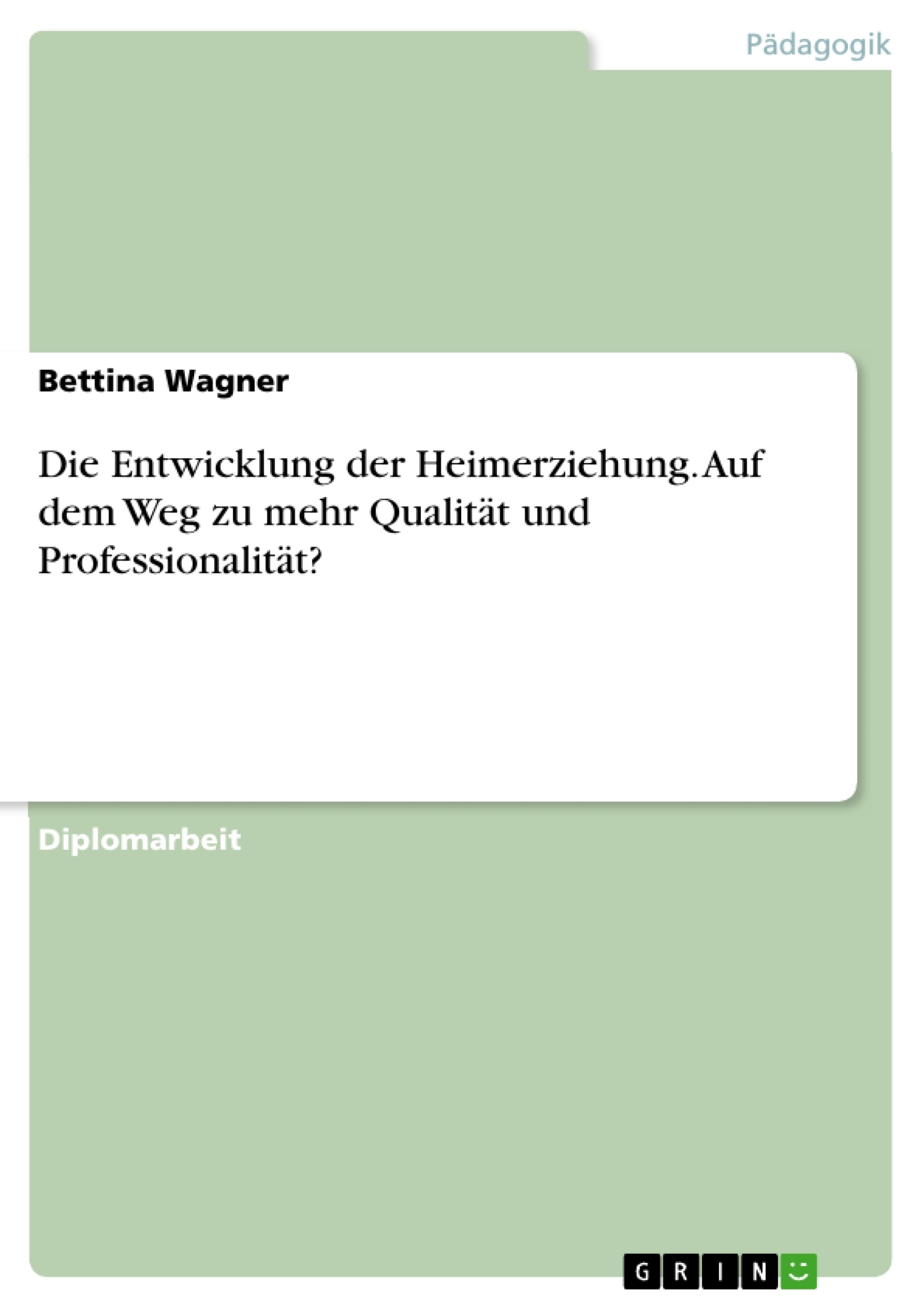Um die Organisationsveränderungen, die veränderten Leitbilder, Konzeptionen und das gegenwärtige Selbstverständnis der Heimerziehung zu verstehen, ist es unumgänglich, die Personen- und Ideengeschichte der Heimerziehung aufzuzeigen. Somit soll die folgende Arbeit mit einem detaillierten Abriss der historischen Entwicklung der Heimerziehung begonnen werden, angefangen bei ihren Wurzeln in den ersten Waisen- und Findelhäusern im Mittelalter über den Waisenhausstreit in der Aufklärung bis zu den Reformen ab Ende der 60er Jahre des 20. Jahrhunderts.
An dieser Stelle darf auch ein Porträt der Lebenswerke der Pioniere der Heimerziehung wie Johann Heinrich Pestalozzi, Johann Hinrich Wichern, August Aichhorn, Janusz Korczak und Bruno von Bettelheim nicht fehlen. Im zweiten Kapitel liegt der Fokus auf der heutigen Situation der stationären Erziehungshilfen. Neben der Charakterisierung der Adressaten und der Beleuchtung der Anlässe für eine Heimeinweisung sowie der Darstellung der Aufgaben und Ziele der Heimerziehung geht es darum, die Effektivität dieser Hilfeform unter Bezugnahme auf Erkenntnisse der Wirksamkeitsforschung herauszuarbeiten, wobei hierfür v. a. die Ergebnisse
des Forschungsprojekts Jugendhilfeleistungen (JULE) „Leistungen und Grenzen von Heimerziehung“ herangezogen werden. Des Weiteren erfolgt in diesem Abschnitt eine Vorstellung der verschiedenen Einrichtungsarten bzw. Betreuungsformen der gegenwärtigen stationären Erziehungshilfen.
Im Mittelpunkt des dritten Kapitels stehen die rechtlichen Grundlagen der Heimerziehung. Neben der Verrechtlichung der stationären Erziehungshilfen im KJHG, den Rechten und Pflichten von Eltern und Kind sowie der Darstellung des Hilfeplanverfahrens soll auch auf die Träger und Finanzierung der Heimerziehung eingegangen werden. Der Schwerpunkt des vierten Kapitels liegt auf der Qualitätsentwicklung in den stationären Erziehungshilfen. Hier soll insbesondere die personelle Ausstattung sowie der Qualifizierungs- und Professionalisierungsgrad der Fachkräfte, die mitverantwortlich für den
Erfolg der Maßnahmen sind, beleuchtet werden. Ebenfalls soll herausgearbeitet werden, inwieweit sich betriebswirtschaftliche Prinzipien wie Qualitätsmanagement in der Heimerziehung etabliert haben. Des Weiteren soll auch auf die Mitspracherechte, v. a. der jungen Menschen im Heim, eingegangen werden, die als wesentliches Qualitätsmerkmal moderner Heimerziehung gelten. [...]
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- 1. DIE GESCHICHTE DER HEIMERZIEHUNG
- 1.1. Historische Entwicklung
- Antike
- Waisen und Findelkinder im Frühchristentum
- Waisen und Findelkinder im Frankenreich
- Waisen und Findelkinder im Mittelalter
- Waisen- und Findelanstalten in der nachreformatorischen Zeit
- Waisenhäuser im Pietismus
- Der Waisenhausstreit
- Die Rettungshausbewegung
- 1871-1900: Die Verrechtlichung der Jugendhilfe
- Die Anstaltserziehung vor und während des 1. Weltkrieges
- Fürsorgeerziehung in der Weimarer Republik
- Heimerziehung im Nationalsozialismus
- Heimerziehung nach 1945
- 1.2. Heimkritik und Reformtendenzen
- Heimkampagne und Heimkritik
- Weitere Reformwellen nach der Heimkampagne
- 1.3. Pioniere der Heimerziehung
- Johann Heinrich Pestalozzi (1746 - 1827)
- Johann Hinrich Wichern (1808-1881)
- Janusz Korczak (1878 - 1942)
- Bruno Bettelheim (1903 - 1990)
- August Aichhorn (1878 - 1949)
- 2. HEIMERZIEHUNG HEUTE
- 2.1. Die Adressaten der Heimerziehung
- Anlässe für Heimerziehung
- Charakterisierung der Adressaten
- 2.2. Aufgaben und Ziele der Heimerziehung
- 2.3. Wirksamkeit der Heimerziehung
- Forschungsprojekt Jugendhilfeleistungen (JULE)
- ,,Leistungen und Grenzen von Heimerziehung”
- Ergebnisse weiterer Studien
- Expertenmeinungen
- 2.4. Einrichtungsarten - Betreuungsformen der Heimerziehung
- Zentralheime
- Außenwohngruppen
- Kleinstheinne
- Betreutes Wohnen
- Erziehungsstellen
- Weitere Betreuungsformen bzw. -konzepte
- 3. RECHTLICHE GRUNDLAGEN DER HEIMERZIEHUNG
- 3.1. Heimerziehung im Kontext des KJHG
- 3.2. Rechte und Pflichten von Eltern und Kind
- Recht auf Beteiligung
- Recht auf Sozialdatenschutz
- Rechte und Pflichten der Eltern
- Weitere Rechte und Pflichten der jungen Menschen in der Heimerziehung
- 3.3. Der Hilfeplan
- Die sozialpädagogische Anamnese: „Die Feststellung des Bedarfs”
- Die sozialpädagogische Diagnose: „Die zu gewährende Hilfeart”
- Die sozialpädagogische Intervention: „Die notwendigen Leistungen”
- Die sozialpädagogische Evaluation: „Das regelmäßige Prüfen”
- 3.4. Träger und Finanzierung der Heimerziehung
- 4. QUALITÄTSENTWICKLUNG IN DER HEIMERZIEHUNG
- 4.1. Personelle Ausstattung in den stationären Erziehungshilfen
- 4.2. Qualifizierung und Professionalisierung der Mitarbeiter
- 4.3. Qualitätsmanagement in der Heimerziehung
- 4.4. Partizipation als Qualitätsmerkmal der Heimerziehung
- 5. METHODEN IN DER HEIMERZIEHUNG
- 5.1. Methodenverständnis
- 5.2. Praktizierte Methoden in der Heimerziehung - Ergebnisse einer Studie
- FAZIT
- Historische Entwicklung der Heimerziehung: Von den Anfängen bis zur Gegenwart
- Heimkritik und Reformtendenzen: Die Herausforderungen und Veränderungen der Heimerziehung
- Rechtliche Grundlagen der Heimerziehung: Das Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG) und seine Auswirkungen
- Qualitätsentwicklung in der Heimerziehung: Personelle Ausstattung, Qualifizierung und Qualitätsmanagement
- Methoden in der Heimerziehung: Praktiken und Ergebnisse einer aktuellen Studie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Diplomarbeit analysiert die Entwicklung der Heimerziehung und untersucht, inwieweit sich diese Einrichtung in Richtung mehr Qualität und Professionalität bewegt hat.
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Heimerziehung ein und beleuchtet die ambivalenten Vorstellungen und Vorurteile, die mit dieser Einrichtung verbunden sind. Sie schildert die Begriffswandel im Laufe der Geschichte und stellt die Bedeutung der Heimerziehung als Institution und Lernfeld heraus.
Das erste Kapitel beleuchtet die historische Entwicklung der Heimerziehung von der Antike bis zur Gegenwart. Es werden die verschiedenen Formen der Fürsorge für Waisen und Findelkinder in unterschiedlichen Epochen beleuchtet, die Entstehung und Entwicklung der Waisenhäuser und Heime im Kontext gesellschaftlicher und politischer Veränderungen dargestellt, sowie die Auswirkungen der Heimkritik und der Reformtendenzen auf die Heimerziehung.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Heimerziehung in der Gegenwart. Es werden die Adressaten der Heimerziehung, die Aufgaben und Ziele der Einrichtung, sowie die Wirksamkeit der Heimerziehung im Hinblick auf Forschungsergebnisse und Expertenmeinungen beleuchtet.
Das dritte Kapitel erläutert die rechtlichen Grundlagen der Heimerziehung im Kontext des Kinder- und Jugendhilfegesetzes (KJHG). Es werden die Rechte und Pflichten von Eltern und Kind, der Hilfeplanprozess sowie die Träger und Finanzierung der Heimerziehung beleuchtet.
Das vierte Kapitel befasst sich mit der Qualitätsentwicklung in der Heimerziehung. Es analysiert die personelle Ausstattung in den stationären Erziehungshilfen, die Qualifizierung und Professionalisierung der Mitarbeiter, sowie das Qualitätsmanagement in der Heimerziehung.
Das fünfte Kapitel widmet sich den Methoden in der Heimerziehung. Es untersucht das Methodenverständnis und präsentiert die Ergebnisse einer Studie über die in der Praxis eingesetzten Methoden.
Schlüsselwörter
Heimerziehung, Jugendhilfe, Heimkritik, Reformtendenzen, Kinder- und Jugendhilfegesetz (KJHG), Qualitätsentwicklung, Professionalisierung, Methoden, stationäre Erziehungshilfen.
- Quote paper
- Bettina Wagner (Author), 2006, Die Entwicklung der Heimerziehung. Auf dem Weg zu mehr Qualität und Professionalität?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65318