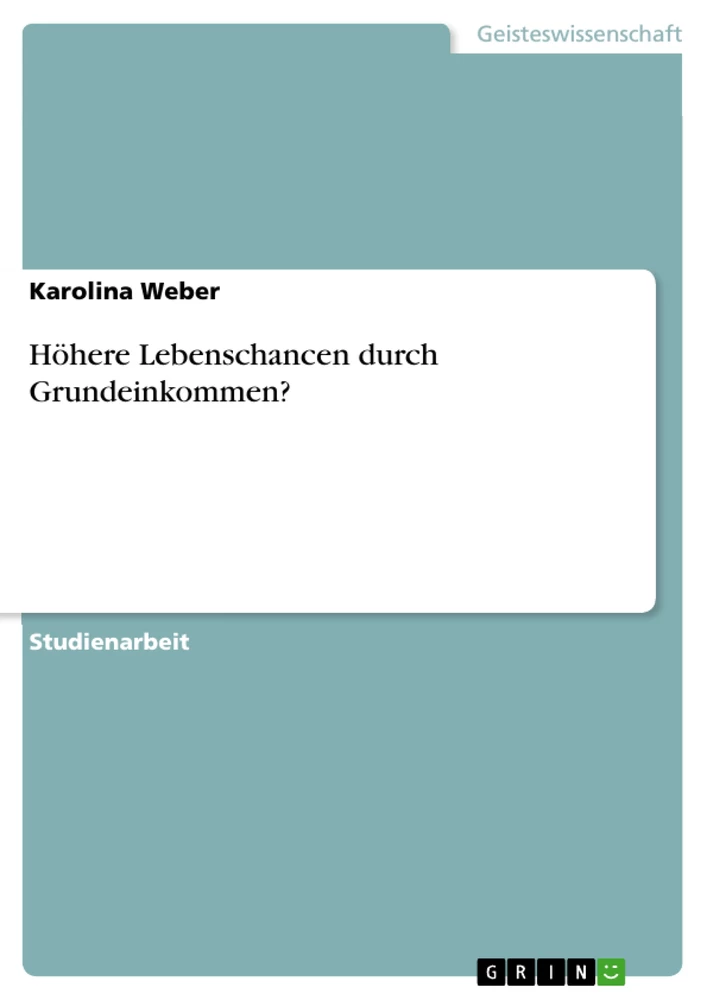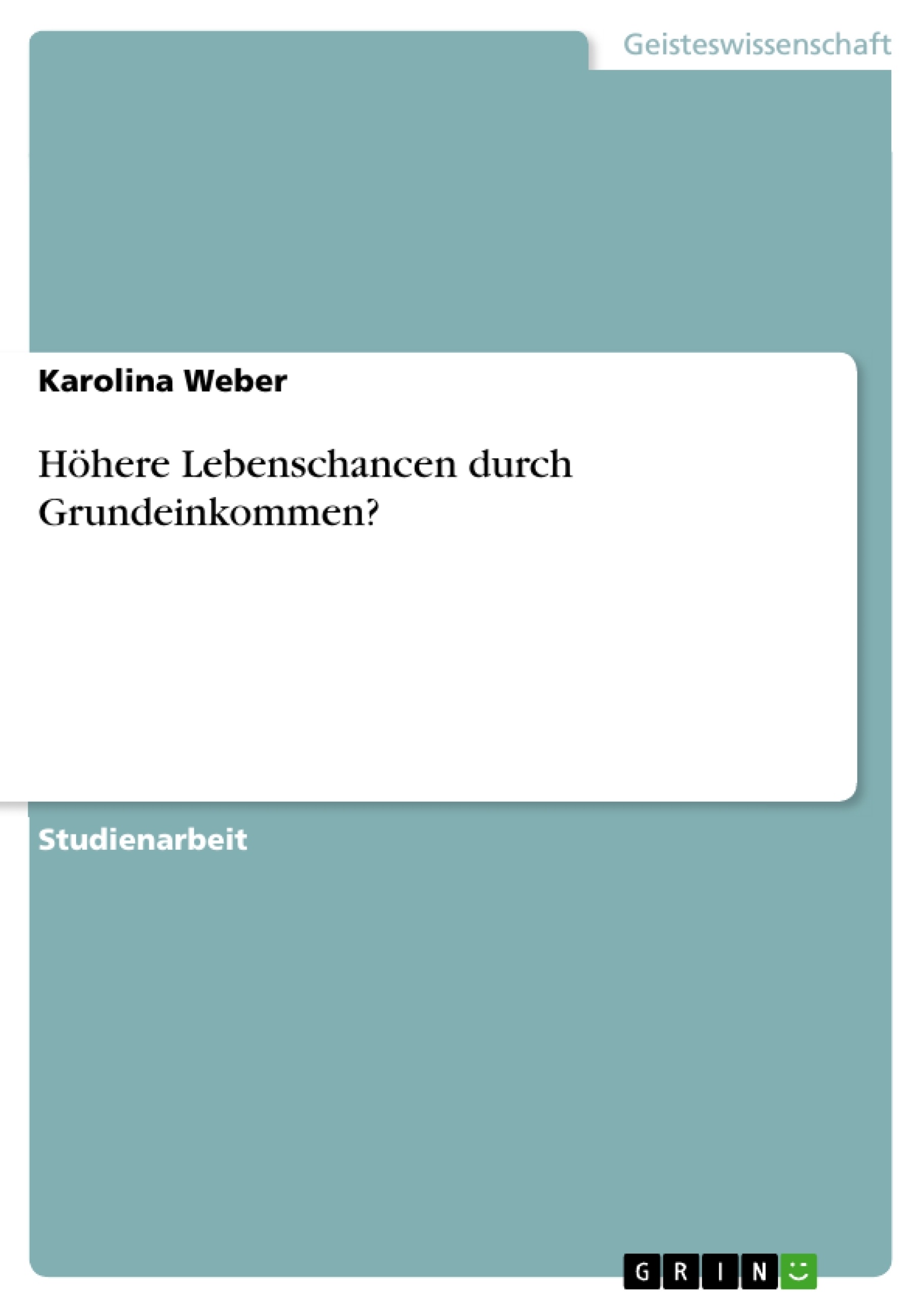Dies ist die Geschichte eines schwierigen Problems, ein Problem, dass viele Menschengeschlechter vor und wohl auch weitere Generationen nach uns beschäftigen wird. Es geht um die Frage, ob der Mensch in seinem Handeln und Denken frei ist; oder ob die ganze Welt und damit auch der Mensch durch äußere (kausale?) Ursachen determiniert werden, wie nicht erst seit dem Erfolg der Gravitationstheorie von Isaac Newton von einigen Gelehrten behauptet wurde. Neben dem physikalischen Determinismus nennt Richard Taylor auch einen ethischen, logischen, psychologischen und theologischen Determinismus, den ich um einen neurobiologischen erweitern würde. Ebenso gibt es Verfechter für die Freiheit. Die Auseinandersetzung zwischen Deterministen und Freiheitstheoretikern existiert schon seit der antiken Philosophie und ficht sich seitdem durch die gesamte Geistes- und Naturgeschichte. Der – islamische – theologische Determinismus soll uns an dieser Stelle interessieren. Wie geht der Islam mit der Frage nach Freiheit und Vorherbestimmung um? Viele nehmen ja meist an, der Islam sei von einem Fatalismus geprägt.
Während der Ausarbeitung meines Referates zur islamischen Eschatologie bin ich auf einen eklatanten Widerspruch gestoßen: Wie kann ein im wahrsten Sinne des Wortes allmächtiger Gott, der das Weltgeschehen lenkt und waltet wie es ihm in den Sinn kommt, gerecht sein? Denn der Koran lässt Allah als den absolut Mächtigen und Transzendenten auftreten, der Himmel und Erde erschaffen hat, und vor dem alle Wesen nur Staub sind. Wie das Verhältnis von Mensch und Gott aussieht und was der Mensch aus islamischer Sicht ist, werde ich im Abschnitt 2.1 zeigen. Um dem Leser die Schwierigkeit der Gerechtigkeit Gottes zu verdeutlichen, ist im Abschnitt 2.2 eine kleine Einleitung in die islamische Eschatologie enthalten. Wir werden dort sehen, dass Allah die Menschen am Jüngsten Tag nach ihrem Glauben und ihren Taten richtet. Und darin liegt auch das Problem: Wenn Allāh die Menschen nach ihren guten oder schlechten Werken beurteilt und sie damit für alle Ewigkeit in das Paradies oder in die Hölle eingehen lässt, er aber gleichzeitig seit undenklichen Zeiten die Taten der Menschen vorausbestimmt hat (determiniert hat), ist der Mensch dann im Endeffekt für seine Taten überhaupt verantwortlich?
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG
- DAS GRUNDEINKOMMEN
- BEGRIFFSKLÄRUNG
- HEUTIGE SOZIALE SICHERHEIT UND GRUNDEINKOMMEN
- Prinzipien der sozialen Sicherheit
- Grundeinkommensmodelle
- THEORETISCHER BEZUGSRAHMEN
- PIERRE BOURDIEU: KAPITALFORMEN
- REINHARD KRECKEL: AGGREGAT SZUSTÄNDE UND STRATEGISCHE RESSOURCEN
- GRUNDEINKOMMEN UND LEBENSCHANCEN
- MATERIELLE RESSOURCEN
- Bewertung
- RESSOURCE BILDUNG
- Schulbildung der Kinder
- Weiterbildung
- Bewertung
- RESSOURCE SOZIALE BEZIEHUNGEN
- Paarbeziehungen
- Ausserhäusliche soziale Beziehungen und Erwerbsarbeit
- Bewertung
- VERHÄLTNIS DER RESSOURCEN
- FAZIT
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht, ob die Einführung eines Grundeinkommens zu höheren Lebenschancen insbesondere bei den unteren Einkommensgruppen führt. Hierbei werden empirische Befunde herangezogen, um die Auswirkungen auf verschiedene Lebensbereiche zu analysieren.
- Begriffsdefinition und Abgrenzung des Grundeinkommens
- Vergleich des Grundeinkommens mit bestehenden sozialen Sicherungssystemen
- Theoretische Grundlagen zur Analyse von Lebenschancen (Bourdieu, Kreckel)
- Auswirkungen des Grundeinkommens auf materielle Ressourcen, Bildung und soziale Beziehungen
- Zusammenhang zwischen den einzelnen Ressourcen und dem Potenzial des Grundeinkommens
Zusammenfassung der Kapitel
- Kapitel 2: Das Grundeinkommen: Diese Einleitung definiert den Begriff „Grundeinkommen“ und grenzt ihn von verwandten Konzepten ab. Es werden zudem die Prinzipien der heutigen sozialen Sicherung in der Schweiz dargestellt und verschiedene Modelle des Grundeinkommens vorgestellt.
- Kapitel 3: Theoretischer Bezugsrahmen: In diesem Kapitel werden die Kapitalformentheorie von Bourdieu und die Theorie der Aggregatszustände und strategischen Ressourcen von Kreckel erläutert. Diese theoretischen Konzepte dienen als Grundlage für die Analyse der Lebenschancen im weiteren Verlauf der Arbeit.
- Kapitel 4: Grundeinkommen und Lebenschancen: Dieses Kapitel untersucht den Einfluss eines Grundeinkommens auf verschiedene Ressourcen, die für die Lebenschancen von Bedeutung sind. Dazu gehören materielle Ressourcen, Bildung und soziale Beziehungen. Es wird analysiert, wie sich ein Grundeinkommen auf die jeweiligen Ressourcen auswirken könnte und welche potenziellen Auswirkungen auf die Lebenschancen zu erwarten sind.
Schlüsselwörter
Grundeinkommen, soziale Sicherheit, Lebenschancen, Ressourcen, materielle Ressourcen, Bildung, soziale Beziehungen, Bourdieu, Kreckel, empirische Befunde, soziale Ungleichheit.
Häufig gestellte Fragen
Führt ein Grundeinkommen zu besseren Lebenschancen?
Die Arbeit untersucht anhand empirischer Befunde, ob ein Grundeinkommen die materiellen Ressourcen und Bildungschancen besonders für untere Einkommensgruppen verbessert.
Was sind "Kapitalformen" nach Pierre Bourdieu?
Bourdieu unterscheidet ökonomisches, kulturelles und soziales Kapital, die alle maßgeblich die Lebenschancen eines Individuums beeinflussen.
Wie beeinflusst ein Grundeinkommen die Ressource Bildung?
Es wird analysiert, ob finanzielle Sicherheit die Schulbildung von Kindern verbessert und den Zugang zu lebenslanger Weiterbildung erleichtert.
Welchen Einfluss hat das Grundeinkommen auf soziale Beziehungen?
Die Arbeit untersucht Auswirkungen auf Paarbeziehungen sowie auf außerhäusliche soziale Kontakte und die Einstellung zur Erwerbsarbeit.
Wie unterscheidet sich das Grundeinkommen vom heutigen Sozialsystem?
Im Gegensatz zu bedarfsorientierten Systemen (wie in der Schweiz) wird das Grundeinkommen als universelles Modell ohne Bedürftigkeitsprüfung diskutiert.
- Citar trabajo
- Karolina Weber (Autor), 2005, Höhere Lebenschancen durch Grundeinkommen?, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65321