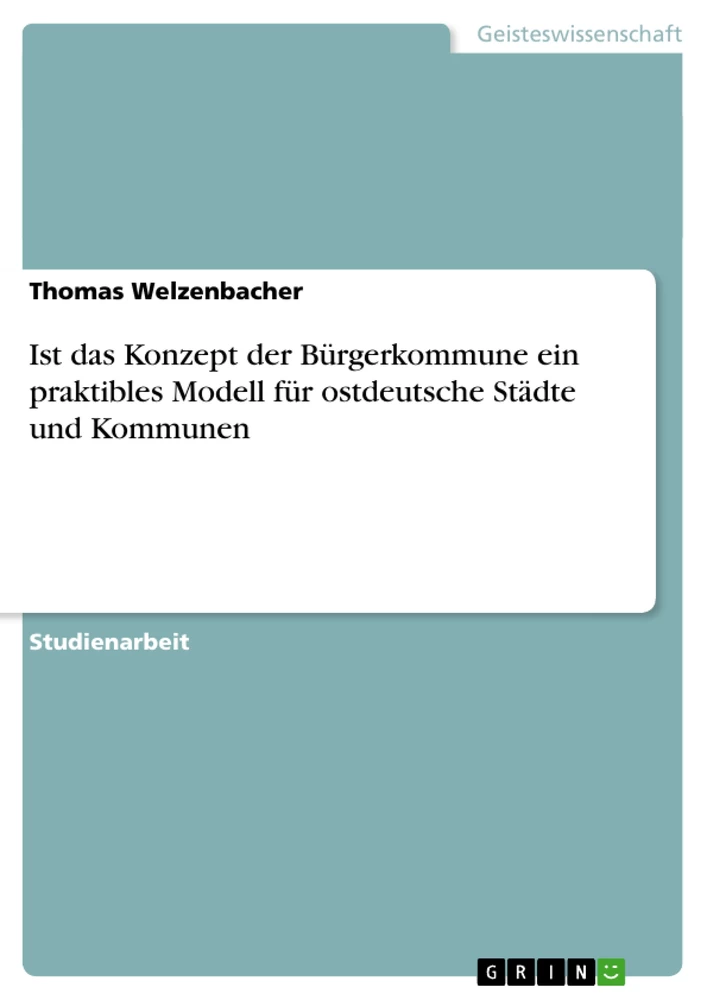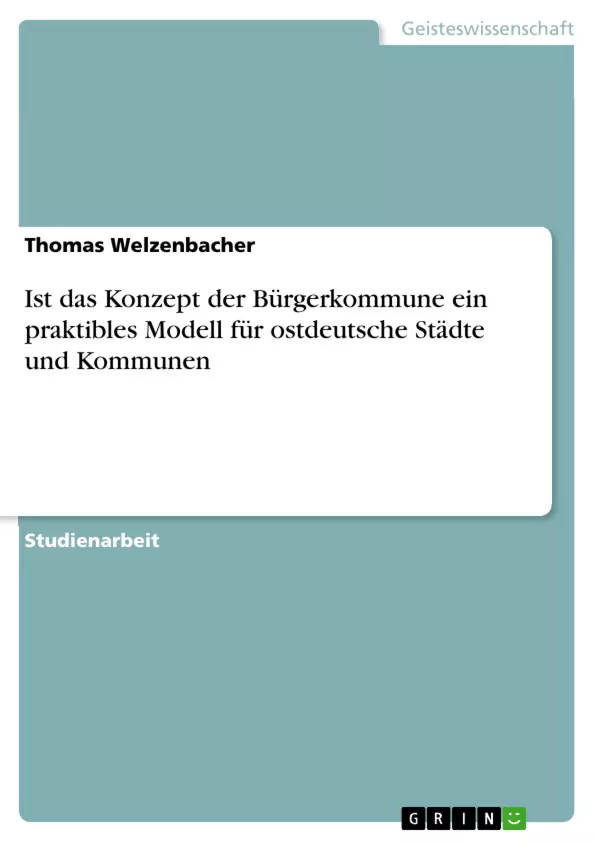′Bürgerschaftliches Engagement′ in aller Munde- dieser Terminus steht für eine neue Hoffnung im politischen Diskurs in Deutschland′ (Braun 2000: 3). Für wahr, beobachtet man den aktuellen politischen Diskurs kann man dem nur zustimmen. Bürgerengagement und Bürgerbeteiligung liegen im Trend. Vor allem Kommunalpraktiker in Wissenschaft und Politik sehen darin die Möglichkeit, die Probleme der Städte zu lösen. Die Frage ist allerdings stets, inwieweit diese Hoffnung berechtigt ist.
Das Konzept der Bürgerkommune ist wohl das aktuell am meisten diskutierte Leitbild, das Lösungsansätze in diesem Zusammenhang konzeptionalisiert hat. Im Kern geht es darum, lokales Engagement ‚jenseits′ der Erwerbsarbeit stärker als bisher zu fördern, anzuerkennen und zu stärken. Das heißt, es sollen die kommunalen, politisch administrativen System dahingehend umgestaltet werden, so dass BürgerInnen als Auftraggeber, als Mitgestalter und als Kunden agieren können (Bogumil 2001: 12). Aus dieser politischen Zielsetzung ergeben sich mehrere Fragen, die mit Blick auf die Situation in Ostdeutschland diskutiert werden sollen.
Um dem hier behandelnden Thema eine äußeren Rahmen zu geben, soll in einem ersten Schritt die Bedeutsamkeit des Bürgerschaftlichen Engagements im Zusammenhang mit der Krise der Stadt′ skizziert werden. In einem zweiten Schritt soll das Konzept der ‚Bürgerkommune′ in seinen unterschiedlichen Dimensionen (Auftraggeber -, Kunden-, und Mitgestalterrolle) vorgestellt werden. Im Anschluss daran soll untersucht werden, inwieweit die Hoffnungen, die an dieses Konzept geknüpft sind, begründet sind. Insbesondere soll die Frage interessieren, inwieweit gemeinwohlorientiertes Handeln unter allen Gruppen der Gesellschaft gleich verteilt ist. In diesem Zusammenhang sollen neuere empirische Studien herangezogen werden, die sich mit der Struktur von Bürgerschaftlichen Engagement bei Erwerbstätigen und Arbeitslosen befassen. Wenngleich eine solche Perspektive eine Geschlechterperspektive nahe legt, soll mit Blick auf die vorgegebene Länge der Arbeit auf diesen Aspekt verzichtet werden. Die Diskussion darüber wird allerdings zeigen, dass die Sozialfigur ‚Bürgerkommune′ die vollmündigen Versprechungen nicht halten kann; sie kann gar im schlimmsten Fall soziale Ungleichheit verstärken.
[...]
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Die, Bürgerkommune' als zukünftiges Leitbild der Stadt
- 1.1 Die Rückkehr der GemeindebürgerInnen
- 1.2 Die BürgerInnen als Auftragsgeber, Kunde und als Mitgestalter
- 1.2.1 Der Bürger in der Auftragsgeberrolle.
- 1.2.2 Der Bürger als Kunde..
- 1.2.3 Der Bürger in der Mitgestalterrolle
- 2. Was ist wenn...
- 2.1 Das Dilemma gesellschaftlicher Reformen- die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis
- 2.1.1 Strategien, die eine Resozialisierung von Aufgaben und Institutionen ermöglichen sollen und die den Bürger und die Bürgerinnen als politischen Partner ankennen, sind voraussetzungsvoll
- 2.1.2 Bürgerschaftliches Engagement versus korporatistische Arrangements.
- 2.2 Der Blick auf die andere Seite.
- 2.2.1 Das Problem der Arbeitslosigkeit..
- 2.2.2 Der, Erwerbsstatus' korreliert mit dem Bürgerschaftlichen Engagement
- 2.2.3 Welche Folgen können sich daraus ergeben?
- 2.1 Das Dilemma gesellschaftlicher Reformen- die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis
- 3. Das Netzwerk der Solidarität – ein frommes Heilsversprechen?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht die Praxistauglichkeit des Konzepts der ,Bürgerkommune' für ostdeutsche Städte und Kommunen. Sie analysiert die Rolle des bürgerschaftlichen Engagements in der Bewältigung städtischer Herausforderungen, insbesondere im Kontext der Krise der Stadt. Dabei werden die unterschiedlichen Dimensionen des ,Bürgerkommune'-Konzepts, wie die Rolle des Bürgers als Auftragsgeber, Kunde und Mitgestalter, beleuchtet. Der Fokus liegt auf der Frage, ob gemeinwohlorientiertes Handeln unter allen gesellschaftlichen Gruppen gleich verteilt ist, und wie sich die Arbeitslosigkeit auf das bürgerschaftliche Engagement auswirkt. Die Arbeit untersucht die Herausforderungen und Chancen des Konzepts im Kontext ostdeutscher Städte und stellt potenzielle Ungleichheiten und Schwierigkeiten dar.
- Die Rolle des bürgerschaftlichen Engagements im Kontext der ,Krise der Stadt'
- Das Konzept der ,Bürgerkommune' und seine verschiedenen Dimensionen (Auftraggeber, Kunde, Mitgestalter)
- Die Verteilung von gemeinwohlorientiertem Handeln unter verschiedenen gesellschaftlichen Gruppen
- Der Einfluss von Arbeitslosigkeit auf das bürgerschaftliche Engagement
- Potenzielle Herausforderungen und Ungleichheiten des ,Bürgerkommune'-Konzepts
Zusammenfassung der Kapitel
- Vorwort: Dieses Kapitel stellt das Thema der Arbeit, die ,Bürgerkommune', in den Kontext des aktuellen politischen Diskurses in Deutschland und die Bedeutung des bürgerschaftlichen Engagements für die Lösung städtischer Probleme.
- 1. Die, Bürgerkommune' als zukünftiges Leitbild der Stadt: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung des Begriffs ,Bürgerkommune' als Antwort auf die ,Krise der Stadt' und stellt die verschiedenen Rollen des Bürgers innerhalb dieses Konzepts vor, nämlich als Auftraggeber, Kunde und Mitgestalter.
- 2. Was ist wenn...: Dieses Kapitel diskutiert die Herausforderungen der Umsetzung des ,Bürgerkommune'-Konzepts. Es beleuchtet die Diskrepanz zwischen Theorie und Praxis bei gesellschaftlichen Reformen und setzt sich kritisch mit der Frage auseinander, inwieweit bürgerschaftliches Engagement tatsächlich zu einer gerechten Verteilung von Aufgaben und Ressourcen in der Gesellschaft führt. Der Abschnitt beleuchtet zudem den Zusammenhang zwischen Erwerbsstatus und bürgerschaftlichem Engagement und hinterfragt die Folgen dieses Zusammenhangs.
- 3. Das Netzwerk der Solidarität – ein frommes Heilsversprechen?: Dieses Kapitel analysiert kritisch die Möglichkeiten und Grenzen des ,Bürgerkommune'-Konzepts. Es hinterfragt, ob das Konzept tatsächlich zu einer Stärkung der sozialen Solidarität und Gleichheit in der Gesellschaft führt oder ob es eher zu einer Verstärkung sozialer Ungleichheiten führen könnte.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Konzept der ,Bürgerkommune' als Leitbild für ostdeutsche Städte und Kommunen. Sie analysiert die Bedeutung des bürgerschaftlichen Engagements, die Rolle des Bürgers als politischer Akteur, die Auswirkungen der Arbeitslosigkeit auf die Zivilgesellschaft und die Herausforderungen der Umsetzung dieses Konzepts in der Praxis. Wichtige Themen sind die ,Krise der Stadt', soziale Ungleichheit, die Verteilung von Aufgaben und Ressourcen, die Rolle des Staates und der Wirtschaft im Kontext des ,Bürgerkommune'-Konzepts sowie die Bedeutung der Bürgerbeteiligung und der politischen Partizipation.
Häufig gestellte Fragen
Was ist das Konzept der „Bürgerkommune“?
Es ist ein Leitbild, bei dem Bürger nicht nur Einwohner sind, sondern als Auftraggeber, Kunden und Mitgestalter aktiv an der Lösung kommunaler Probleme mitwirken.
Eignet sich dieses Modell für ostdeutsche Städte?
Die Arbeit untersucht dies kritisch und weist darauf hin, dass die spezifischen sozialen Bedingungen, wie hohe Arbeitslosigkeit, die Umsetzung erschweren könnten.
Wie beeinflusst der Erwerbsstatus das bürgerschaftliche Engagement?
Empirische Studien zeigen eine Korrelation: Erwerbstätige engagieren sich oft häufiger als Arbeitslose, was die Gefahr birgt, dass die Bürgerkommune soziale Ungleichheiten verstärkt.
Was versteht man unter der „Krise der Stadt“?
Damit sind die finanziellen Engpässe und sozialen Herausforderungen der Kommunen gemeint, für die das bürgerschaftliche Engagement als Lösung gehandelt wird.
Kann die Bürgerkommune ihre Versprechen halten?
Die Arbeit warnt davor, dass das Konzept oft ein „Heilsversprechen“ bleibt, wenn nicht sichergestellt wird, dass alle gesellschaftlichen Gruppen gleichermaßen partizipieren können.
- Quote paper
- Thomas Welzenbacher (Author), 2002, Ist das Konzept der Bürgerkommune ein praktibles Modell für ostdeutsche Städte und Kommunen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/6551