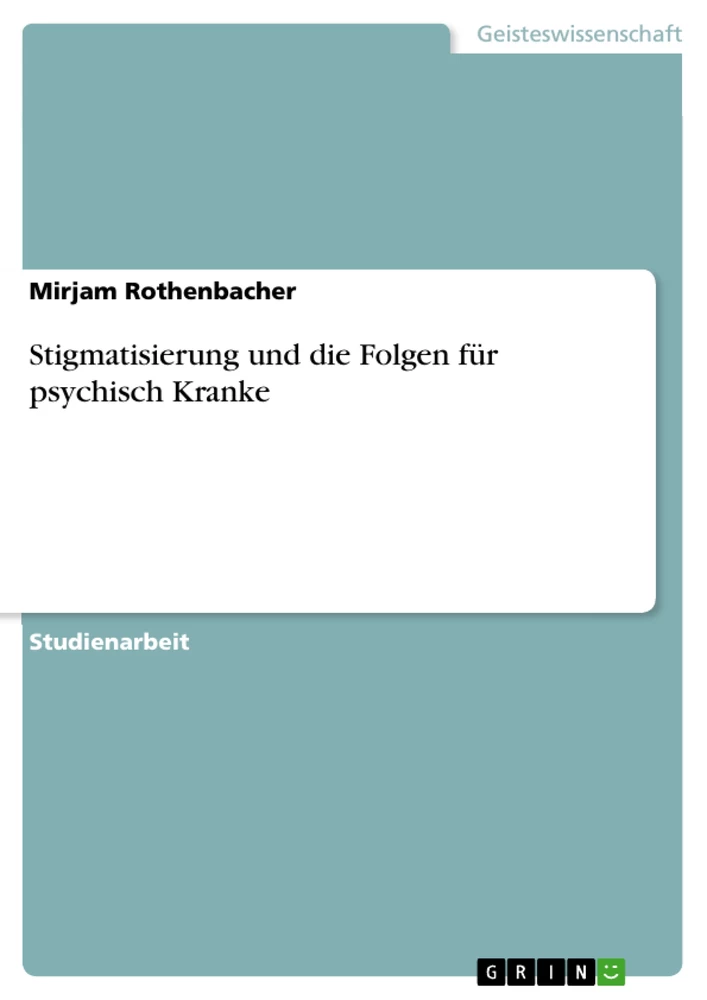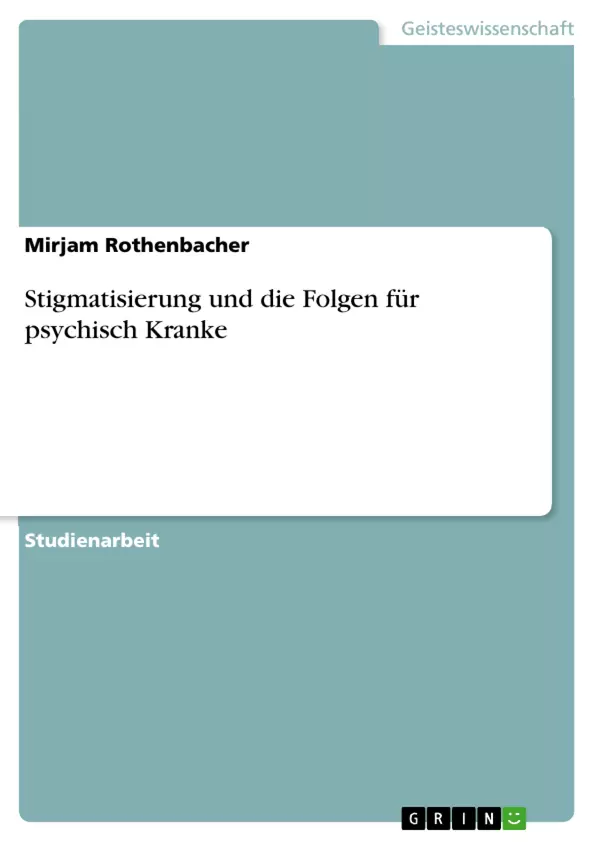Stigma und Stigmatisierung ist ein weit gefasstes Phänomen in unserer Gesellschaft. Sie begegnet einem fast täglich und in fast jeder erdenklichen Ausprägung, wobei mit dem Begriff begegnet eine wohl etwas zu euphemistische Umschreibung geliefert wird, da er Passivität impliziert, die jedoch nicht gegeben ist. Meistens ist man äußerst aktiv in den Prozess der Stigmatisierung involviert: Manchmal ist man Stigmatisierer, manchmal Stigmatisierter, meistens ist man beides gleichzeitig. Üblicherweise trifft ein Individuum im Laufe seines Lebens in einer Gesellschaft unzählige Male auf ein bzw. mehrere andere Individuen. Die Gesellschaft, der das Individuum angehört, hat im Laufe der Zeit bewusst und auch unbewusst Normen geschaffen, geschriebene und ungeschriebene, die von der Allgemeinheit angewendet werden; diese angewendeten Normen ermöglichen es, Menschen als „normal“ oder als „unnormal“ einzustufen, sie in „wir“ und „die“ zu unterscheiden und sie somit voneinander abzugrenzen: Die einen sind die „Normerfüller“, die anderen die „Normabweichler“.2Es liegt auf der Hand, dass die Grenzen bzw. das, was als Norm Anwendung findet, mehr als fließend sind und von Gesellschaft zu Gesellschaft, von Gruppe zu Gruppe, von Individuum zu Individuum, von Kontext zu Kontext unterschiedlich gehandhabt werden. Außerdem sind die Kategorisierungen äußerst anfällig für Willkür und Subjektivität. Trotzdem ist es möglich, dass ein Großteil von Individuen einer Gesellschaft oder einer Gruppe dazu tendiert, normkonformes und normabweichendes Verhalten gleich oder ähnlich zu definieren und Abweichler in „ein und dieselbe Schublade zu stecken“ - die der Stereotypen. Wir neigen dazu, jedes Individuum, dem wir begegnen, so einem bestimmten Stereotyp zuzuordnen. Stellt sich nachträglich heraus, dass der „Eingeordnete“ seiner zugedachten Rolle nicht voll entspricht und ihm ein Makel (Stigma) anhaftet, wird er stigmatisiert, d. h. spontan mit einer vorerst gedanklichen Ablehnung versehen. Erving Goffman unterscheidet zwischen der „virtuale[n] soziale[n] Identität“ und der „aktuale[n] soziale[n] Identität“.
Inhaltsverzeichnis
- Von der „,virtualen“ zur „aktualen sozialen Identität“
- Was ist ein Stigma bzw. Stigmatisierung?
- Die Stigmatisierung psychisch Kranker …
- Kampf dem Stigma „psychisch krank“
- Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit zielt darauf ab, das Phänomen der Stigmatisierung in der Gesellschaft zu beleuchten, insbesondere im Kontext psychischer Erkrankungen. Der Text analysiert die Entstehung und Auswirkungen von Stigma und untersucht, wie Stigmatisierung die soziale Identität von Individuen beeinflusst.
- Soziale Identität und Stigmatisierung
- Definition und Bedeutung des Begriffs Stigma
- Die Auswirkungen der Stigmatisierung auf psychisch Kranke
- Strategien zur Bekämpfung von Stigmatisierungen
Zusammenfassung der Kapitel
- Das erste Kapitel untersucht den Unterschied zwischen „virtueller“ und „aktueller“ sozialer Identität und zeigt auf, wie die Diskrepanz zwischen beiden zu Stigmatisierung führen kann.
- Kapitel zwei beschäftigt sich mit der Definition und dem Ursprung des Begriffs Stigma und analysiert die verschiedenen Komponenten des Phänomens.
- Kapitel drei beleuchtet die spezifische Stigmatisierung psychisch Kranker in der Gesellschaft und die damit verbundenen Auswirkungen.
- Das vierte Kapitel befasst sich mit verschiedenen Ansätzen und Strategien zur Bekämpfung von Stigmatisierungen und zur Förderung einer inklusiven Gesellschaft.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den zentralen Begriffen Stigma, Stigmatisierung, soziale Identität, psychische Krankheit, Diskriminierung, Inklusion, und gesellschaftliche Normen. Sie untersucht die Entstehung und Auswirkungen von Stigmatisierungen, insbesondere im Kontext von psychischen Erkrankungen.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht Erving Goffman unter "virtualer" und "aktualer" sozialer Identität?
Die virtuale Identität ist das Bild, das andere von uns aufgrund von Normen erwarten, während die aktuale Identität die tatsächlichen Eigenschaften einer Person umfasst. Eine Diskrepanz führt oft zu Stigmatisierung.
Wie entsteht ein Stigma in der Gesellschaft?
Ein Stigma entsteht, wenn ein Individuum von gesellschaftlichen Normen abweicht und ihm ein "Makel" zugeschrieben wird, der zu gedanklicher oder sozialer Ablehnung führt.
Welche Folgen hat Stigmatisierung für psychisch Kranke?
Sie führt zu sozialer Ausgrenzung, Diskriminierung und kann die Heilungschancen verschlechtern, da Betroffene oft als "unnormal" in Stereotypen eingeordnet werden.
Was sind Stereotypen im Kontext der Stigmatisierung?
Stereotypen sind vereinfachte Kategorisierungen ("Schubladendenken"), die wir nutzen, um Menschen schnell als "Normalerfüller" oder "Normabweichler" zu klassifizieren.
Wie kann man Stigmatisierung entgegenwirken?
Durch Aufklärung, Förderung von Inklusion und das Hinterfragen starrer gesellschaftlicher Normen, um die Akzeptanz von Vielfalt zu erhöhen.
- Quote paper
- Mirjam Rothenbacher (Author), 2006, Stigmatisierung und die Folgen für psychisch Kranke, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65567