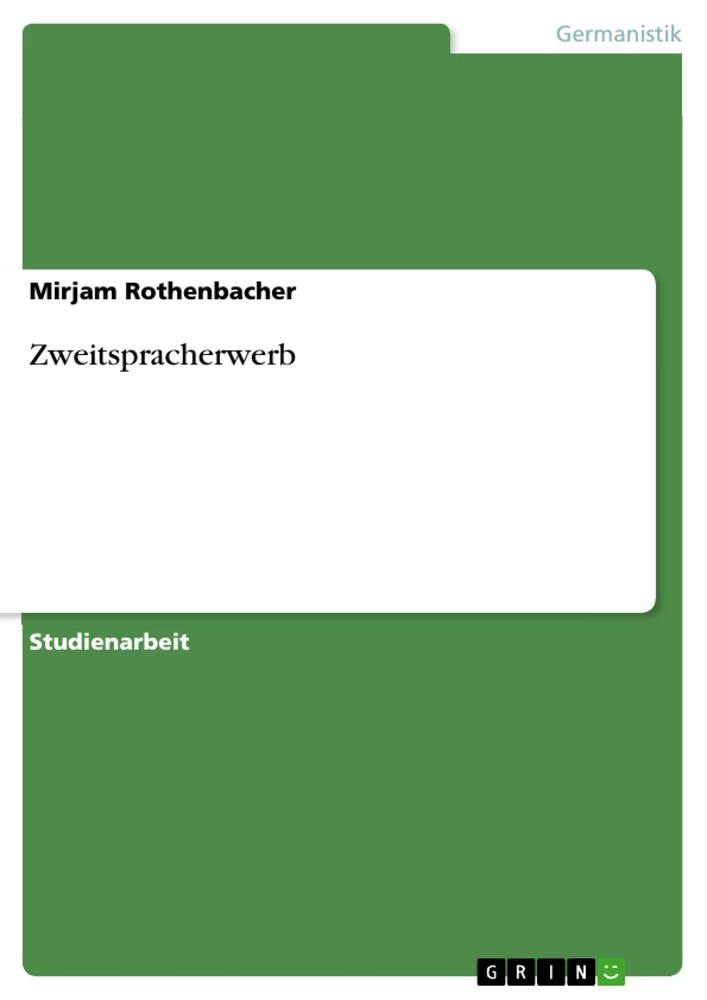„Unter dem Begriff Zweitspracherwerb wird im folgenden jede Aneignung einer weiteren Sprache (neben der Muttersprache) verstanden, wobei die einzelnen Formen dieses Aneignungsprozesses sich nach Lernalter (gleichzeitig/nachzeitig zum Erstspracherwerb) und Lernkontext (natürlich/gesteuert) weiter differenzieren lassen […] Besteht für die Lerner keine Möglichkeit, außerhalb der Schule mit Sprechern Kontakt aufzunehmen, die diese Sprache als Muttersprache sprechen, wird vom Erwerb einer Fremdsprache gesprochen“.
Die Zweitsprache ist also Sprache des Landes, in dem man zwar lebt, in dem man aber entweder selbst oder einer seiner nahen Vorfahren nicht geboren ist, was meist äußerst eingeschränkte Kenntnisse der deutschen Sprache zur Folge hat. Die komplexe Thematik Zweitspracherwerb betrifft demnach die in Deutschland lebenden „Nicht-Deutschen“ oder Ausländer,die sich auf einen längeren Aufenthalt mit ihren Familien in Deutschland eingerichtet haben und die es zu integrieren gilt. Dafür sind natürlich viele Faktoren zuständig, die hier verständlicherweise nicht alle behandelt werden können. In der folgenden Arbeit soll ausschließlich auf die sprachliche Integration eingegangen werden, also auf den Zweitspracherwerb Deutsch, u. z. insbesondere auf den nachzeitigen und den gesteuerten, da dieser einen mehr oder minder großen Bestandteil des Lehrerberufs - abhängig von der Schulart - ausmacht. Das Entstehen der Problematik soll aufgezeigt, der heutige Stand der Dinge dargelegt und Lösungsvorschläge unterbreitet werden.
Zu den Fakten: Heute leben 7,3 Mio. Ausländer in Deutschland, was bei 82,5 Mio. Einwohnern insgesamt einem Anteil von knapp 9% entspricht, davon besuchen allein ca. 960.000 deutsche Schulen, einem Anteil von knapp 10% ausgehend von einer Gesamtschülerzahl von 9,7 Mio. Schülern. Ca. 235.000 von ihnen besuchen eine Hauptschule - ein Anteil von 16% (!) gemessen an der Gesamtzahl aller Hauptschüler in Deutschland, 87.500 besuchen eine Realschule (6,8% aller Realschüler) und immerhin 90.000 besuchen ein Gymnasium, was aber lediglich einem Anteil von 3,9% bei den Gymnasiasten entspricht.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Geschichte des Zweitspracherwerbs
- „Die Ausländer“ in der Bundesrepublik Deutschland
- Deutsch als Zweitsprache (DaZ) - Die Anfänge
- DaZ in Bayern – von den 80ern bis heute
- Die wichtigsten Hypothesen der Zweitspracherwerbsforschung und die Folgerungen daraus
- Die Bedeutung der Muttersprache
- Konsequenzen für den Unterricht
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem Thema Zweitspracherwerb Deutsch, speziell im Kontext der Integration von Migranten in Deutschland. Sie untersucht die historische Entwicklung des Zweitspracherwerbs, analysiert wichtige Hypothesen der Zweitspracherwerbsforschung und zeigt die Bedeutung der Muttersprache für den Lernerfolg auf. Darüber hinaus werden Konsequenzen für den Deutschunterricht in der Grund- und Hauptschule diskutiert.
- Historische Entwicklung des Zweitspracherwerbs in Deutschland
- Bedeutung der Muttersprache für den Zweitspracherwerb
- Hypothesen und Forschungsansätze im Bereich des Zweitspracherwerbs
- Konsequenzen für den Deutschunterricht in der Grund- und Hauptschule
- Integration von Migranten durch Sprachförderung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Thematik Zweitspracherwerb in Deutschland vor und erläutert die Bedeutung von Deutsch als Zweitsprache für die Integration von Migranten. Kapitel 2 gibt einen historischen Überblick über den Zweitspracherwerb in Deutschland, beleuchtet die Situation von „Ausländern“ in der Bundesrepublik und zeigt die Entwicklung von Deutsch als Zweitsprache von den Anfängen bis heute. Kapitel 3 beleuchtet wichtige Hypothesen der Zweitspracherwerbsforschung und die daraus resultierenden Folgerungen für den Unterricht. Kapitel 4 befasst sich mit der Bedeutung der Muttersprache für den Zweitspracherwerb, und Kapitel 5 analysiert die Konsequenzen für den Deutschunterricht in der Grund- und Hauptschule.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Themen Zweitspracherwerb, Deutsch als Zweitsprache, Integration von Migranten, Muttersprache, Sprachförderung, Deutschunterricht, Grundschule, Hauptschule.
Häufig gestellte Fragen
Was ist der Unterschied zwischen Zweitsprache und Fremdsprache?
Eine Zweitsprache wird im Land der Zielsprache erworben (z. B. Deutsch in Deutschland), während eine Fremdsprache meist im schulischen Kontext ohne direkten Kontakt zur Sprachgemeinschaft gelernt wird.
Welche Rolle spielt die Muttersprache beim Lernen von Deutsch?
Die Muttersprache ist ein wichtiges Fundament; ihre Beherrschung beeinflusst den Erfolg und die Strategien beim Erwerb der Zweitsprache maßgeblich.
Wie hoch ist der Anteil von Schülern mit Migrationshintergrund?
Zum Zeitpunkt der Erhebung besuchten ca. 960.000 ausländische Schüler deutsche Schulen, wobei der Anteil an Hauptschulen mit 16 % besonders hoch war.
Was sind die wichtigsten Hypothesen der Spracherwerbsforschung?
Die Arbeit analysiert verschiedene wissenschaftliche Ansätze, wie Menschen Sprachen nachzeitig und gesteuert erlernen.
Welche Konsequenzen ergeben sich für den Unterricht?
Lehrkräfte müssen gezielte Sprachförderung betreiben und die individuellen Lernvoraussetzungen von Migrantenkindern in Grund- und Hauptschulen berücksichtigen.
- Quote paper
- Mirjam Rothenbacher (Author), 2005, Zweitspracherwerb, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65569