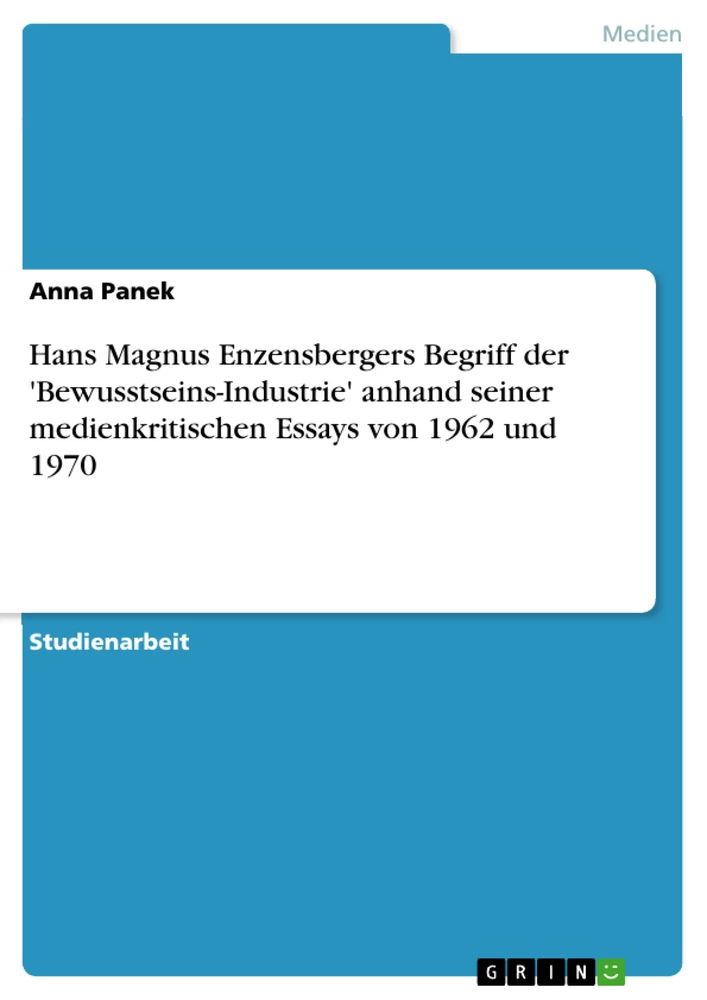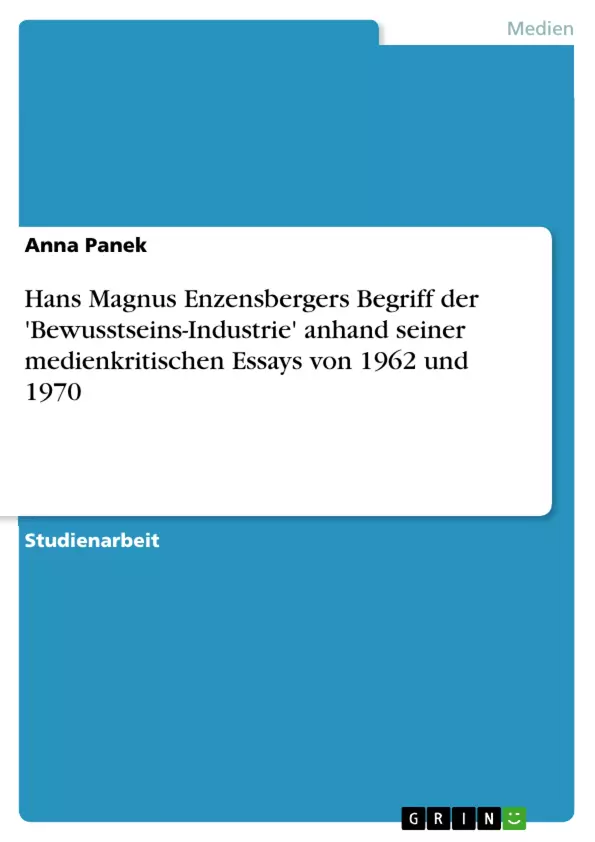Hans Magnus Enzensbergers Bewußtseinsindustrie-Begriff gilt in den Medien- und Publizistikwissenschaften als ein seminarseitig alljährlich willkommenes Thema und Anlaß zur Auffrischung eines tagesaktuell bleibenden Blickwinkels auf die Entwicklungsmöglichkeiten - aber auch auf Fallen und Gefahren - Neuer Medien und ihrem Einfluß auf den konzeptuelle Komplex, den Enzensberger in seiner einmalig weit umfassenden Definition von der Bewußtseinsindustrie umrissen hat. In den Zeiten eines neuen Booms - manche nennen es im web2.0-Zeitalter - wird auch die nächste Generation nicht aufhören können zu fragen, wo die Vorteile des neuen Netzes im Sinne von Korrekturmöglichkeiten, die sich z.B. linken Bewegungen durch open-source-publishing-Systeme bietet, beginnt und wo - an der Seite von Stasi 2.0 und in direkter Nachbarschaft zu kommerziellen trash-communities - Freiheiten wieder ihre Eingrenzungen erfahren. Eine jede junge Gesellschaft wird so die Frage nach Bewußtseinslenkungsmechanismen und die Frage nach der Verbindung zwischen Prekarisierungserscheinungen und der nie asusschließbaren Übernutzung elektronischer 'Fortschritts'möglichkeiten neu stellen und zur Debatte ausauen müssen. Diese Arbeit versteht sich als eine Stimme im Chor, der diese Debatte aus dem Inneren eines universitären Seminarraums zu begleiten versucht.
Der Chor summt.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Bewusstsein und Wissensvermittlungshierarchie
- .2
- 3
- 2. Bewusstseinsindustrie: Das Undefinierbare des Allgemeinen
- 4
- 3. Immaterialität als emanzipatorischer Wertmaßstab
- 7
- 4. Die Rolle des Produzenten
- 5. Falsche Bedürfnisse?
- Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit analysiert Hans Magnus Enzensbergers Begriff der „Bewusstseins-Industrie“ anhand seiner medienkritischen Essays aus den Jahren 1962 und 1970. Sie untersucht Enzensbergers Standpunkte, die Argumentation seiner Essays und bewertet deren Relevanz im Kontext der gegenwärtigen Medienlandschaft.
- Die Entwicklung der „Bewusstseins-Industrie“ als ein relativ neues Phänomen und die Rolle von Wissen und Urteilskraftvermittlung.
- Die Kritik an der traditionellen hierarchischen Wissensvermittlung und die Bedeutung neuer Medien für eine egalitärere Wissensgesellschaft.
- Die Analyse des medialen Industriekomplexes und die Abgrenzung von Enzensbergers „Bewusstseins-Industrie“ von der „Kulturindustrie“ der Frankfurter Schule.
- Die Frage nach der Autonomie des menschlichen Bewusstseins in einer medialen Welt.
- Die Bedeutung der „Bewusstseins-Industrie“ für die Bildung von Bedürfnissen und Meinungen.
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung: Der Essay „Bewusstseins-Industrie“ wird im Kontext von Enzensbergers medienkritischer Essayistik und seiner Auseinandersetzung mit Theodor W. Adorno eingeführt.
- 1. Bewusstsein und Wissensvermittlungshierarchie: Enzensberger argumentiert gegen ästhetisch-eskapistische Tendenzen und die traditionelle hierarchische Wissensvermittlung, die er als ein „Kind der letzten hundert Jahre“ bezeichnet.
- 2. Bewusstseinsindustrie: Das Undefinierbare des Allgemeinen: Enzensberger kritisiert die Fokussierung auf einzelne Medien und fordert eine umfassende Betrachtung des medialen Industriekomplexes, den er als „Natur der Massenmedien“ bezeichnet.
- 3. Immaterialität als emanzipatorischer Wertmaßstab: (Dieser Abschnitt wird in der Zusammenfassung ausgelassen, um Spoiler zu vermeiden)
- 4. Die Rolle des Produzenten: (Dieser Abschnitt wird in der Zusammenfassung ausgelassen, um Spoiler zu vermeiden)
- 5. Falsche Bedürfnisse?: (Dieser Abschnitt wird in der Zusammenfassung ausgelassen, um Spoiler zu vermeiden)
Schlüsselwörter
Medienkritik, Bewusstseinsindustrie, Kulturindustrie, Wissensvermittlung, Massenmedien, Neue Medien, Egalität, Autonomie, Bedürfnisse, Gesellschaft, Bildung, Adorno, Enzensberger.
- Citation du texte
- Anna Panek (Auteur), 2006, Hans Magnus Enzensbergers Begriff der 'Bewusstseins-Industrie' anhand seiner medienkritischen Essays von 1962 und 1970, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65612