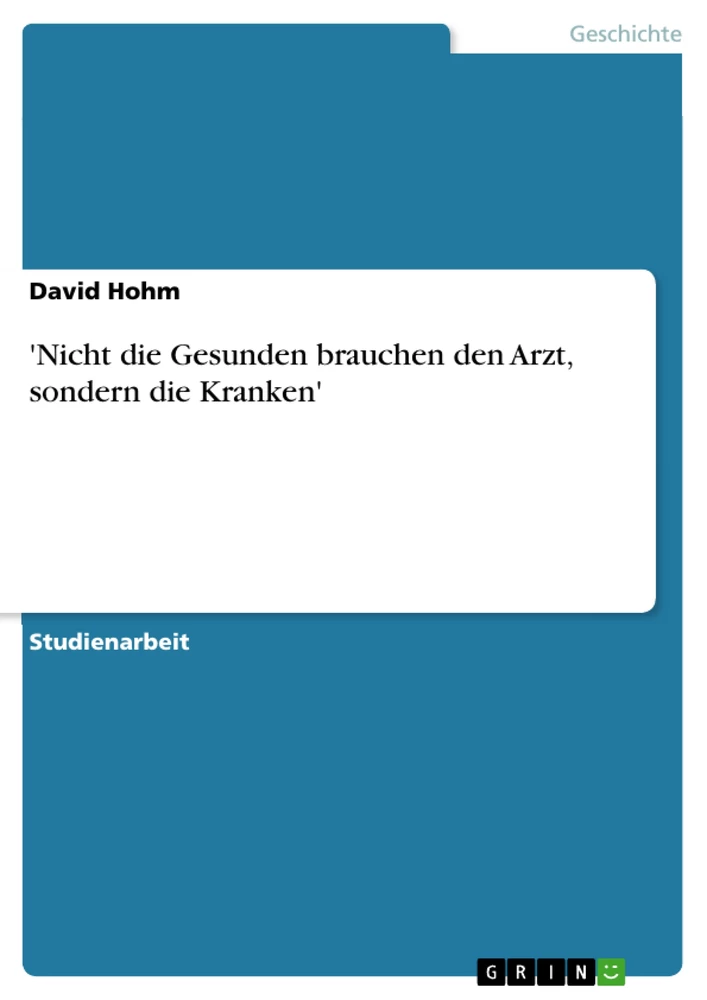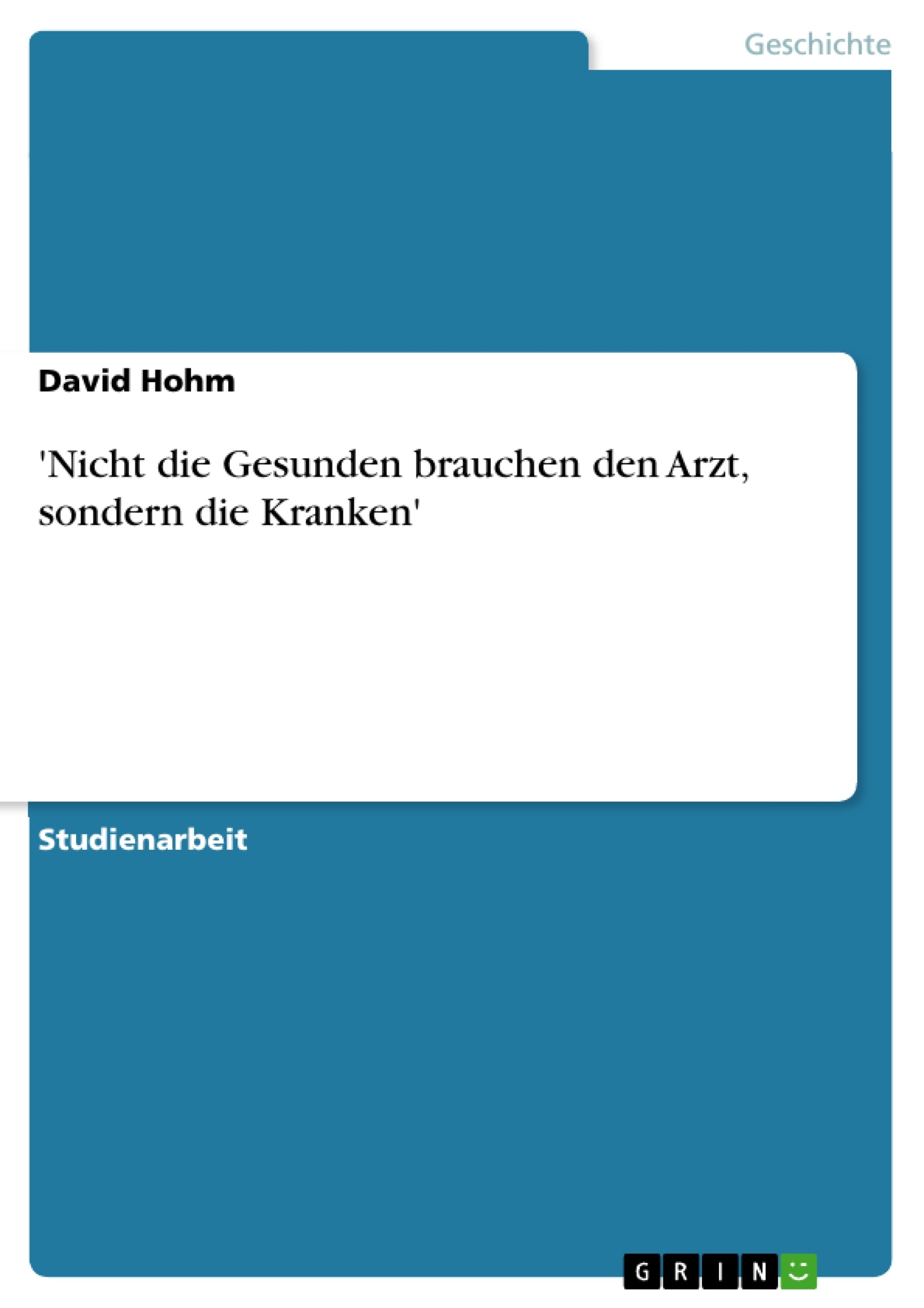Die Menschen des Mittelalters bedurften, genau wie neuzeitliche Menschen, einer gewissen medizinischen Gesundheitspflege und Fürsorge, zumal es wesentlich mehr Risikofaktoren gab zu erkranken und das Kranksein an sich eine existenzielle Bedrohung darstellte. Zudem standen für die meisten Krankheiten nur unzureichende Medikamente und Behandlungsmethoden zur Verfügung. Nicht nur die Unfälle des Alltags und leichtere Krankheiten mussten mit diesen Mitteln der einfachen Medizin bewältigt werden, sondern vor allem auch große Epidemien wie die Pestwellen zur Mitte des 14. Jahrhunderts oder die Lepra, die sich über eine sehr lange Zeit endemisch hielt und periodisch immer wieder zu einer Epidemie aufflammte. In dieser Arbeit sollen zunächst kurz die antiken und arabischsprachigen Grundlagen der mittelalterlichen Medizin dargestellt werden, und zwar anhand der Vier-Säfte-Theorie, die Hippokrates zugesprochen wird, sowie der Einbettung der Krankheit in das christliche System. Auf die Funktion der Magie im Mittelalter kann in dieser Arbeit nicht eingegangen werden. Im nächsten Schritt wird die medizinische Bedeutung der frühen Klöster gezeigt. Schon die Regel des Hl. Benedikt zeigt die medizinischen Aufgaben eines Klosters. Das Idealbild des Klosterplanes von St. Gallen stellt die verschiedenen medizinischen Einrichtungen eines Klosters sowie das Wirken von Klosterärzten dar, und weiterhin wird auf die spezielle Bedeutung der Klostergärten eingegangen.
Im zweiten Teil der Arbeit geht es um das Umfeld der Krankheit des Lazarus, den Aussatz, der im Mittelalter verallgemeinernd Lepra genannt wurde. Es sollen die mittelalterliche Wahrnehmung, die Behandlung und die Aufnahme von Leprakranken in die Leprosorien gezeigt werden, mit einer kurzen Erwähnung der Praxis der Nürnberger Siechenkobel.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Die Grundlagen der mittelalterlichen Medizin
- Säftelehre
- Diätik
- Medizinische Versorgung in den Klöstern
- Theologische Rechtfertigung der Sorge um Kranke
- Medizinische Gebäude eines mittelalterlichen Klosters
- Mönchsarzt und Klostergarten
- Das Ende der Klostermedizin
- Lepra - Der Umgang mit der Krankheit im Mittelalter
- Das Krankheitsbild des Aussatzes (Lepra) und die Wahrnehmung durch die Zeitgenossen
- Die Lepraschau - Beginn der Ausgrenzung
- Die Leprosorien und Nürnberger Siechenkobel
- Zusammenfassung
- Quellen und Literaturverzeichnis
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der medizinischen Versorgung im Mittelalter, insbesondere mit der Rolle von Klöstern und dem Umgang mit der Lepra. Sie analysiert die Grundlagen der mittelalterlichen Medizin, wie die Säftelehre und die Diätik, sowie die Integration von Krankheit in ein christliches Weltbild.
- Die Entwicklung der mittelalterlichen Medizin im Kontext antiker und arabischsprachiger Traditionen
- Die medizinische Bedeutung von Klöstern und die Rolle von Klosterärzten
- Das Krankheitsbild der Lepra und die Wahrnehmung durch die Zeitgenossen
- Die Ausgrenzung von Leprakranken und die Einrichtung von Leprosorien
- Die Bedeutung der Klostergärten für die medizinische Versorgung
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beleuchtet die Grundlagen der mittelalterlichen Medizin, indem es auf die Säftelehre des Hippokrates und die Weiterentwicklungen durch Galen eingeht. Es zeigt, wie Krankheit in ein christliches Weltbild integriert wurde und welche Rolle die Diätik spielte. Das zweite Kapitel fokussiert auf die medizinische Versorgung in Klöstern, unterstreicht die theologische Rechtfertigung für die Sorge um Kranke und beschreibt die medizinischen Einrichtungen, darunter die Rolle des Klosterarztes und die Bedeutung des Klostergartens.
Schlüsselwörter
Die Arbeit behandelt zentrale Themen der mittelalterlichen Medizin, wie die Säftelehre, Diätik, Klostermedizin, Lepra, Lepraschau, Leprosorien und Nürnberger Siechenkobel. Sie analysiert die Rolle von Klöstern in der medizinischen Versorgung und den Umgang mit der Krankheit Lepra im mittelalterlichen Kontext.
Häufig gestellte Fragen
Was war die theoretische Basis der mittelalterlichen Medizin?
Die Grundlage bildete die antike Vier-Säfte-Lehre (Humoralpathologie), die Hippokrates zugesprochen wird, sowie die Einbettung von Krankheit in das christliche Weltbild.
Welche Rolle spielten Klöster für die Krankenpflege?
Klöster waren zentrale Orte der medizinischen Versorgung. Die Regel des Hl. Benedikt verpflichtete Mönche zur Sorge um Kranke, was zur Einrichtung von Hospitälern und Klostergärten führte.
Wie wurde Lepra im Mittelalter wahrgenommen?
Lepra (Aussatz) galt als existenzielle Bedrohung und wurde oft religiös gedeutet. Kranke wurden nach einer "Lepraschau" gesellschaftlich ausgegrenzt und in Leprosorien untergebracht.
Was ist ein Siechenkobel?
Siechenkobel waren spezielle Einrichtungen zur Unterbringung von Leprakranken, wie sie beispielsweise im mittelalterlichen Nürnberg zur Isolation der Infizierten genutzt wurden.
Warum waren Klostergärten medizinisch so wichtig?
Da Medikamente unzureichend waren, dienten Klostergärten dem Anbau von Heilkräutern, die die wichtigste Grundlage für die Behandlungsmethoden der Klosterärzte darstellten.
Was versteht man unter mittelalterlicher Diätik?
Die Diätik im Mittelalter umfasste die Lehre von einer gesunden Lebensführung und Ernährung, um das Gleichgewicht der Körpersäfte aufrechtzuerhalten und Krankheiten vorzubeugen.
- Citar trabajo
- David Hohm (Autor), 2006, 'Nicht die Gesunden brauchen den Arzt, sondern die Kranken', Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65689