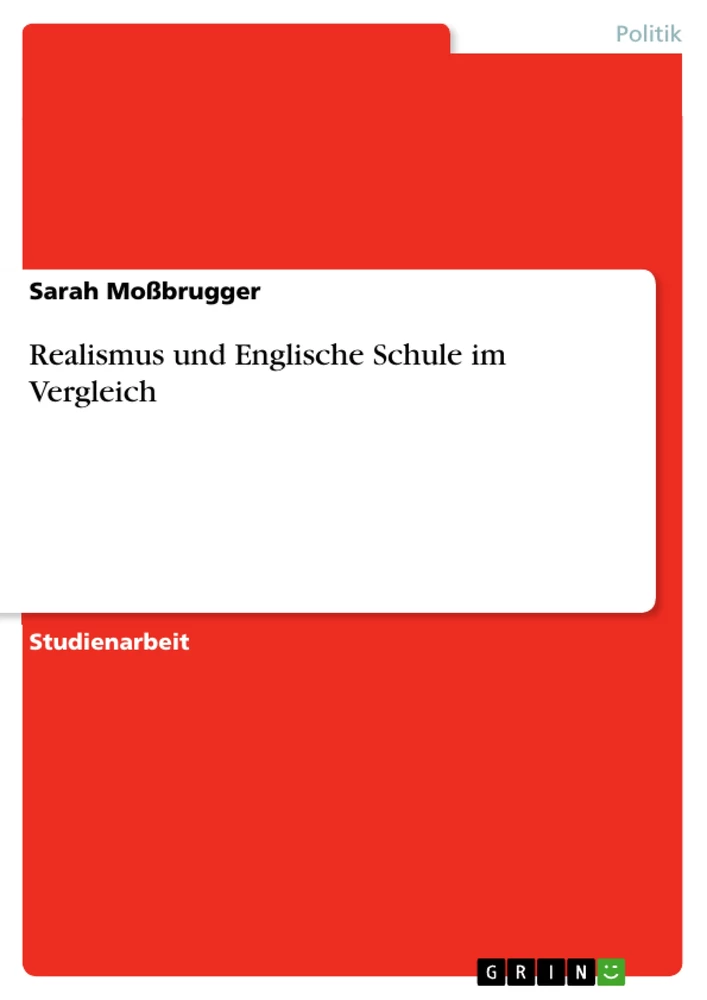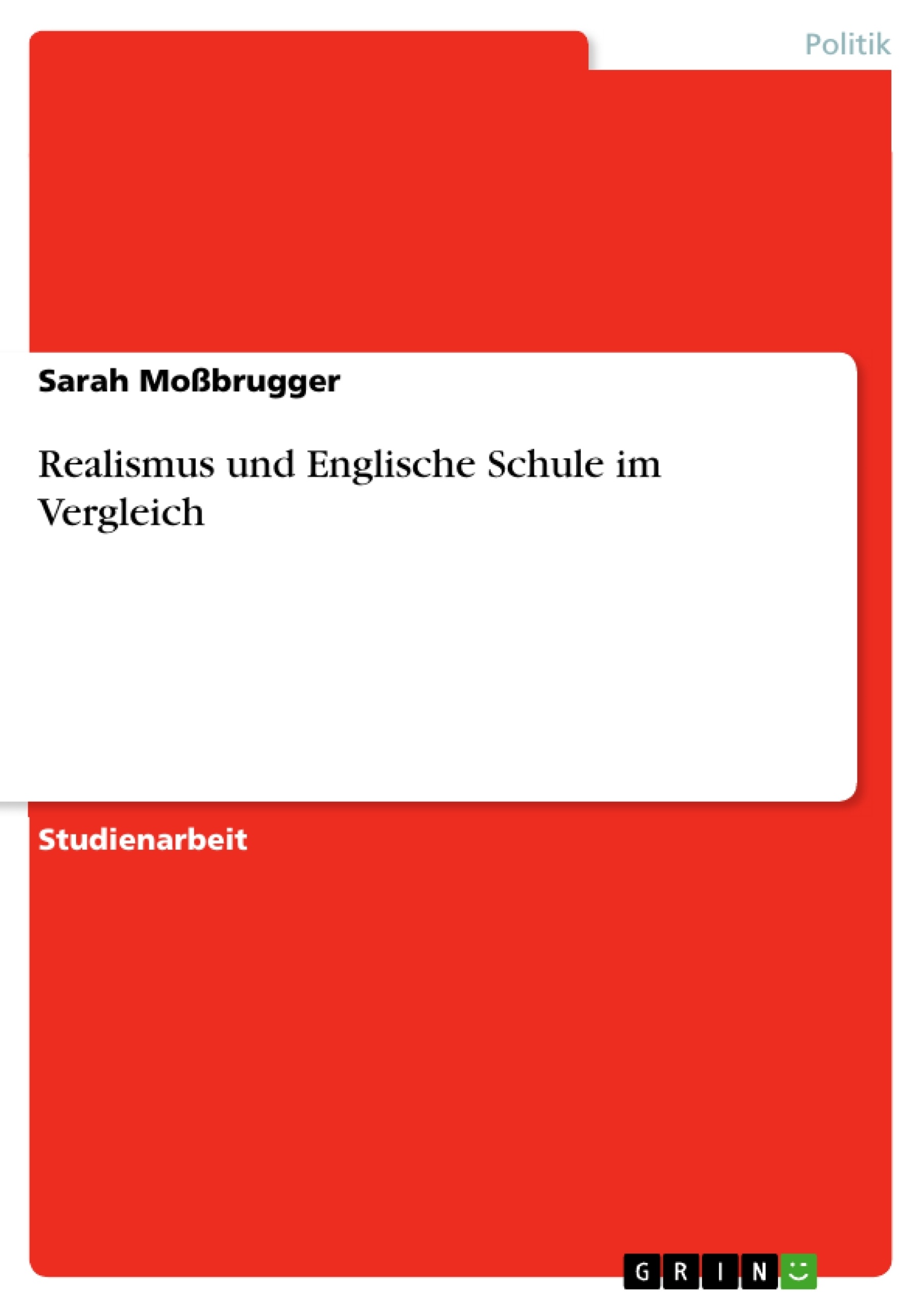In den letzten 350-360 Jahren wurde die Weltpolitik vom westfälischen Staatensystem bestimmt. Dieses markierte die sogenannte nationale Konstellation, die mit dem westfälischen Frieden 1648 ihren Ausgangspunkt hatte, und die Art und Weise klassischer Kriegsführung maßgeblich beeinflusste.
Nach Clausewitz ist Krieg ein „Akt der Gewalt, um den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen“. Dabei wurden Staaten mit einem genau zu bestimmender politischer Wille als einzige legitime Akteure vorausgesetzt. Somit ist der klassische Krieg also, „ein Krieg zwischen Staaten um ein definierbares politisches Ziel, d. h. Staatsinteresse.“ Dennoch setzte sich die Vorstellung vom Krieg als einer staatlichen Unternehmung erst gegen Ende des 18. Jahrhunderts durch. Zuvor wurden Kriege trotzdem zwischen einer Vielfalt unterschiedlicher Akteure geführt, von Kirchen über Feudalherren bis hin zu Stadtstaaten. Ziel der Theorien der Internationalen Beziehungen ist es zu erklären, wie sich die internationale Ordnung unter zeithistorischen und gesellschaftlichen Bedingungen entwickelt bzw. verändert hat. Die Internationale Beziehungen als wissenschaftliche Disziplin entwickelten sich nach dem ersten Weltkrieg, mit der Zeit entwickelten sich auch die 4 „großen Debatten“, die die Internationalen Beziehungen zu dem formten, was sie sind. Die erste Debatte begann zwischen Realisten und Idealisten in den 30er und 40er Jahren, darauf setzte die zweite Debatte in den 50er und 60er Jahren zwischen Traditionalisten und Szientiesten ein. Die dritte Debatte, zweigeteilt in die „inter-paradigm-debate“ zwischen Realisten, Pluralisten und Strukturalisten seit den 1970er Jahren und die wissenschaftstheoretische Debatte zwischen Positivisten und Postpositivisten wurde seit Ende der 1980er Jahre durch ein „sozialwissenschaftliches“ Denken in Frage gestellt, welches die vierte Debatte einleitete.
Die Anfänge der realistische Theorie begannen in den 30-er Jahren mit dem Scheiterns des Völkerbundes von Edward Hallett Carr entwickelt, das bekannteste und wegweisendeste Konzept stammt jedoch von Hans J. Morgenthau , der mit seinem Konstrukt des Realismus eine der wegweisenden Theorien der Internationalen Beziehungen schuf. Er gilt als der einflussreichste Theoretiker der realistischen Richtung.
Inhaltsverzeichnis
- A) Einleitung
- B) Hauptteil: Realismus und Englische Schule im Vergleich
- 1. Interessen und Ziele
- 1.1. Interessen und Ziele des Realismus
- 1.2. Interessen und Ziele der Englischen Schule
- 2. Menschenbild
- 2.1 Menschenbild aus realistischer Perspektive
- 2.2 Menschenbild aus der Perspektive der Englischen Schule
- 3. Akteure und Internationale Ordnung
- 4. Kriegsursache
- 5. Friedensstrategie
- 6. Gegenüberstellung der Gemeinsamkeiten und Unterschiede
- C) Fazit und Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Vergleich von Realismus und Englischer Schule, zwei bedeutenden Theorien der internationalen Politik. Die Zielsetzung ist es, die wesentlichen Prämissen beider Theorien herauszuarbeiten und deren Gemeinsamkeiten und Unterschiede in Bezug auf das Menschenbild, maßgebenden Akteure, Interessen und Ziele, Struktur, Kriegsursachen und Friedensstrategien zu analysieren.
- Das Konzept der Macht und dessen Rolle in der internationalen Politik
- Die unterschiedlichen Menschenbilder von Realismus und Englischer Schule
- Die Bedeutung von Akteuren und internationalen Ordnungen in beiden Theorien
- Die Analyse von Kriegsursachen und Friedensstrategien im Vergleich
- Die Frage der Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Realismus und Englischer Schule
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung bietet einen kurzen Überblick über die Entwicklung des westfälischen Staatensystems und die Entstehung der Theorien der internationalen Beziehungen. Anschließend werden die „großen Debatten“ der internationalen Beziehungen vorgestellt, die zur Entwicklung dieser Disziplin beigetragen haben. Der Schwerpunkt liegt dabei auf der ersten Debatte zwischen Realisten und Idealisten.
Der Hauptteil der Arbeit beschäftigt sich mit dem Vergleich von Realismus und Englischer Schule. Zunächst werden die Interessen und Ziele beider Theorien dargestellt, wobei der Realismus auf die Macht als zentrale Variable fokussiert. Anschließend werden die unterschiedlichen Menschenbilder beider Ansätze betrachtet. Im Weiteren werden die Akteure und die internationale Ordnung in den jeweiligen Theorien analysiert. Abschließend werden die Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Realismus und Englischer Schule in Bezug auf Kriegsursachen und Friedensstrategien herausgearbeitet.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter dieser Arbeit sind Realismus, Englische Schule, internationale Politik, Macht, Menschenbild, Interessen, Ziele, Akteure, internationale Ordnung, Kriegsursache, Friedensstrategie, Gemeinsamkeiten, Unterschiede.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die zentralen Unterschiede zwischen Realismus und Englischer Schule?
Der Hauptunterschied liegt im Verständnis der internationalen Ordnung: Während der Realismus Macht als zentrale Variable sieht, betont die Englische Schule die Existenz einer internationalen Gesellschaft mit gemeinsamen Normen.
Welche Rolle spielt Hans J. Morgenthau im Realismus?
Hans J. Morgenthau gilt als der einflussreichste Theoretiker des Realismus. Sein Konzept beschreibt internationale Politik als einen Kampf um Macht, basierend auf einem pessimistischen Menschenbild.
Wie definiert Clausewitz den Begriff Krieg?
Nach Clausewitz ist Krieg ein „Akt der Gewalt, um den Gegner zur Erfüllung unseres Willens zu zwingen“, wobei Staaten als legitime Akteure politische Ziele verfolgen.
Was markiert die „nationale Konstellation“ in der Weltpolitik?
Die nationale Konstellation wurde durch das westfälische Staatensystem nach dem Frieden von 1648 geprägt, das den souveränen Staat als zentralen Akteur festlegte.
Welche Debatten prägten die Internationalen Beziehungen?
Die Disziplin entwickelte sich durch vier große Debatten: Realismus vs. Idealismus, Traditionalismus vs. Szientismus, die Inter-Paradigma-Debatte und die Debatte zwischen Positivisten und Postpositivisten.
- Quote paper
- Sarah Moßbrugger (Author), 2006, Realismus und Englische Schule im Vergleich, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65783