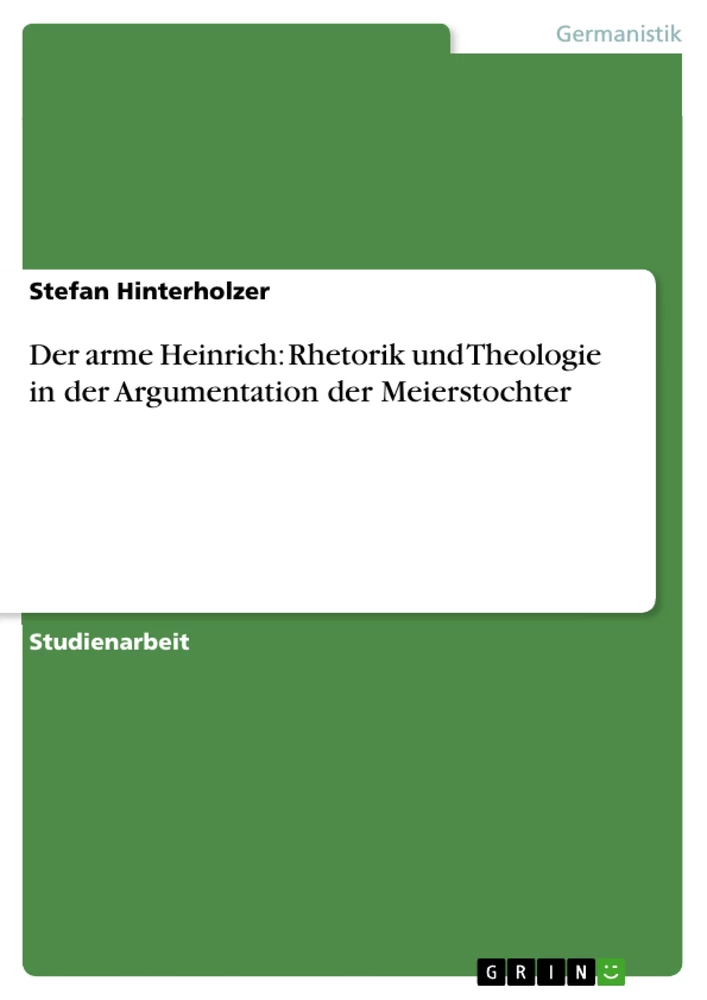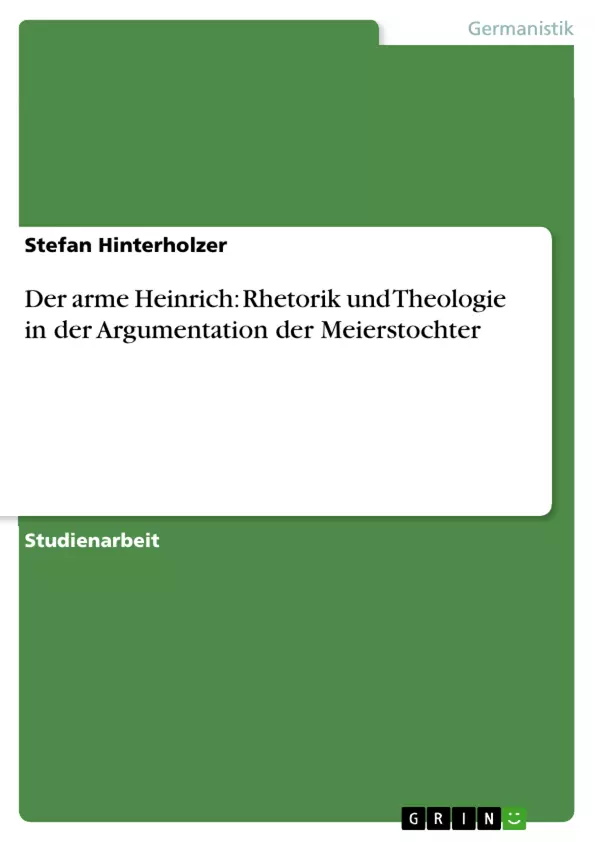„When the heroine of Der arme Heinrich opens her mouth to speak, she normally does so not simply to communicate information, but with the intention of persuading others to adopt her perspective on a situation or to comply with her wishes. In each case this centres around her desire to sacrifice herself for Heinrich.”
Diese Aussage beschreibt wohl am besten aus welcher Perspektive die Meierstochter zu betrachten ist. In der bisherigen Forschung wurde sie eher in einer passiven Situation gesehen. Sie wurde nicht als eigene Handlungsträgering, „sondern einzig und allein als Schlüssel zur Heilung Heinrichs [gesehen]: sein Geschick steht zur Debatte, sie wird ausschließlich über ihren Stellenwert in der Entwicklung des Protagonisten definiert“. Dass die Meierstochter jedoch eine wesentlich zentralere Rolle spielt, zeigt sich etwa schon durch ihren – in Relation zu den anderen Figuren – sehr großen Redeanteil. Auch werden ihre Aussagen im Gegensatz zu Heinrichs fast immer in der direkten Rede wiedergegeben.
In den folgenden Ausführungen wird die Meierstochter auf der Grundlage des Zitates von Andrea Fiddy betrachtet, nämlich als aktiv handelnde Figur, der eine zentrale Rolle in der Handlung zukommt. Sie versucht sowohl ihre Eltern, den armen Heinrich als auch den Arzt in Salerno in mehreren Reden von ihrem Vorhaben, sich zu opfern, zu überzeugen. Dabei bedient sie sich bestimmter rhetorischer Strategien und theologischer Argumente, um die Zweifel der anderen Figuren aufzuheben, ihren Widerstand zu durchbrechen und somit schließlich ihren Willen durchzusetzen.
Im folgenden werden die sieben Reden des Mädchens analysiert (hier sei bewusst der Begriff „Rede“ verwendet, da die Figuren bis auf die Ausnahme des Gesprächs zwischen Heinrich und dem Mädchen nie in Dialogform miteinander sprechen, sondern mittels Reden und Gegenreden). Hierbei stehen die rhetorischen Mittel sowie die theologischen Argumente im Fokus, mit denen das Mädchen ihren Gesprächspartner versucht zu überzeugen. Diese Analyse wird sich im weitesten mit der Gestaltung der Reden beschäftigen, wobei vereinzelt auf die Motive der Meierstochter hingewiesen werden wird. Da dies jedoch nicht Hauptgegenstand dieser Arbeit ist, soll dies auch nur in einem sehr beschränkten Rahmen geschehen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- 1. Die erste Rede an die Eltern: Verlust von Besitz und Ansehen (Verse 490-498)
- 2. Die zweite Rede an die Eltern: Der Entschluss zum Opfer (Verse 558-564)
- 3. Die Rede an den Vater: Das Wohl aller (Verse 593-628)
- 4. Die Rede an die Mutter: Die Überzeugung der Mutter (Verse 663-854)
- 5. Das Gespräch mit Heinrich: Der Wert seines Lebens (Verse 903-926)
- 6. Die Rede an den Arzt: Überzeugung des Arztes (Verse 1111-1170)
- 7. Die Rede an Heinrich: Wehklagen und Beschimpfung (Verse 1290-1304; 1310-1332d)
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Reden der Meierstochter in Hartmanns von Aues Der arme Heinrich und untersucht ihre rhetorischen Strategien und theologischen Argumente. Der Fokus liegt darauf, wie sie ihre Gesprächspartner von ihrem Vorhaben, sich für Heinrich zu opfern, zu überzeugen versucht. Dabei wird die Meierstochter nicht als passive Figur, sondern als aktiv handelnde Person betrachtet, die eine zentrale Rolle in der Handlung spielt.
- Die rhetorischen Strategien der Meierstochter
- Die theologischen Argumente, die sie einsetzt
- Die Gestaltung der Reden und ihre Wirkung auf die Gesprächspartner
- Die Motivation der Meierstochter und ihr Selbstverständnis
- Die Rolle der Meierstochter in der Handlung des Romans
Zusammenfassung der Kapitel
Die Analyse beginnt mit der ersten Rede der Meierstochter an ihre Eltern, in der sie ihren Wunsch nach dem Opfer darlegt. Sie betont dabei den Verlust von Besitz und Ansehen, der mit Heinrichs Tod einhergehen würde. Die zweite Rede an die Eltern bekräftigt ihren Entschluss zum Opfer, wobei sie sich auf die Liebe zu Heinrich und das Heil ihrer Seele beruft. Die Rede an den Vater stellt das Wohl aller in den Vordergrund, während die Rede an die Mutter die Überzeugung der Mutter durch Argumentation und Emotionalität erreicht. Das Gespräch mit Heinrich konzentriert sich auf den Wert seines Lebens und die Notwendigkeit des Opfers. In der Rede an den Arzt verwendet die Meierstochter theologische Argumente und medizinisches Wissen, um den Arzt von ihrer Position zu überzeugen. Die finale Rede an Heinrich, die vor dem Opfer stattfindet, ist geprägt von Wehklagen und Beschimpfung.
Schlüsselwörter
Die wichtigsten Schlüsselwörter der Arbeit sind: Der arme Heinrich, Hartmann von Aue, Meierstochter, Rhetorik, Theologie, Opferbereitschaft, Liebe, Selbstaufgabe, moralische Verpflichtung, gesellschaftliches Ansehen, Besitz, Heil der Seele, Argumentation, Überzeugung, Rede, Gespräch, Dialog.
Häufig gestellte Fragen
Welche Rolle spielt die Meierstochter in „Der arme Heinrich“?
Entgegen älterer Forschung wird sie hier als aktiv handelnde Figur betrachtet, die durch rhetorisches Geschick und theologische Argumente die Handlung maßgeblich vorantreibt.
Wie versucht das Mädchen, ihre Eltern zu überzeugen?
In ihren Reden thematisiert sie den drohenden Verlust von Besitz und Ansehen durch Heinrichs Tod sowie das ewige Seelenheil, das sie durch ihr Opfer zu erlangen hofft.
Welche theologischen Argumente nutzt die Meierstochter?
Sie beruft sich auf die göttliche Bestimmung, die Liebe zu Gott und die Überlegenheit des jenseitigen Lebens gegenüber der vergänglichen irdischen Welt.
Wie reagiert der Arzt in Salerno auf ihre Rede?
Das Mädchen nutzt eine Kombination aus theologischem Eifer und festem Willen, um den Arzt von der Ernsthaftigkeit und Rechtmäßigkeit ihres Opferwunsches zu überzeugen.
Warum wird in der Analyse der Begriff „Rede“ statt „Dialog“ verwendet?
Die Figuren kommunizieren im Werk meist in Form von längeren, formal gestalteten Reden und Gegenreden, was ihren persuasiven (überzeugenden) Charakter unterstreicht.
- Citation du texte
- Stefan Hinterholzer (Auteur), 2006, Der arme Heinrich: Rhetorik und Theologie in der Argumentation der Meierstochter, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65850