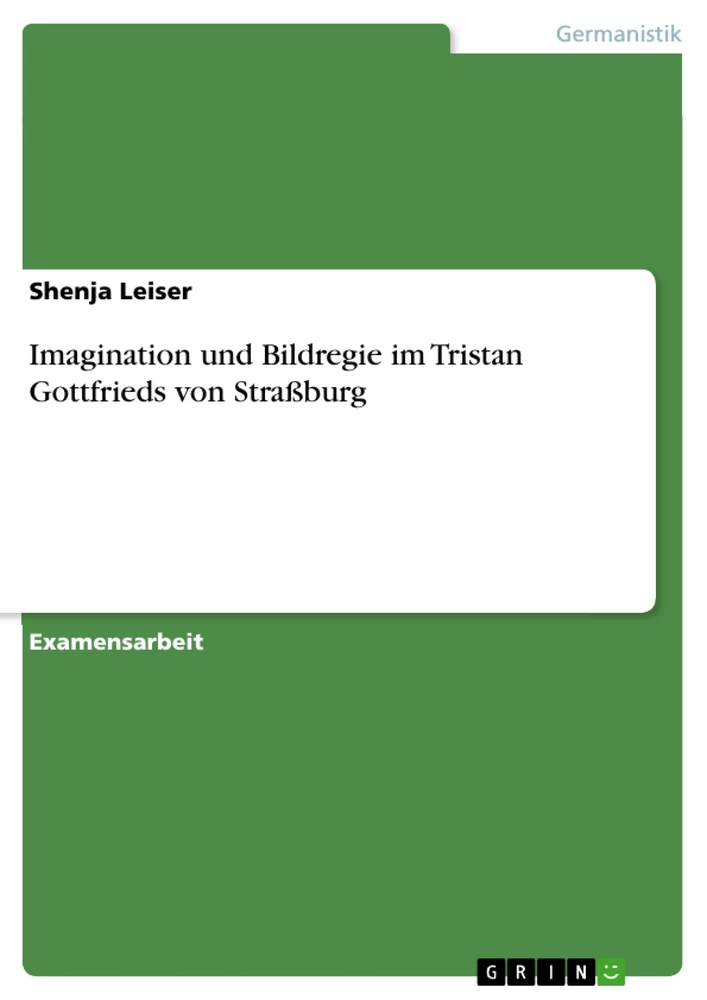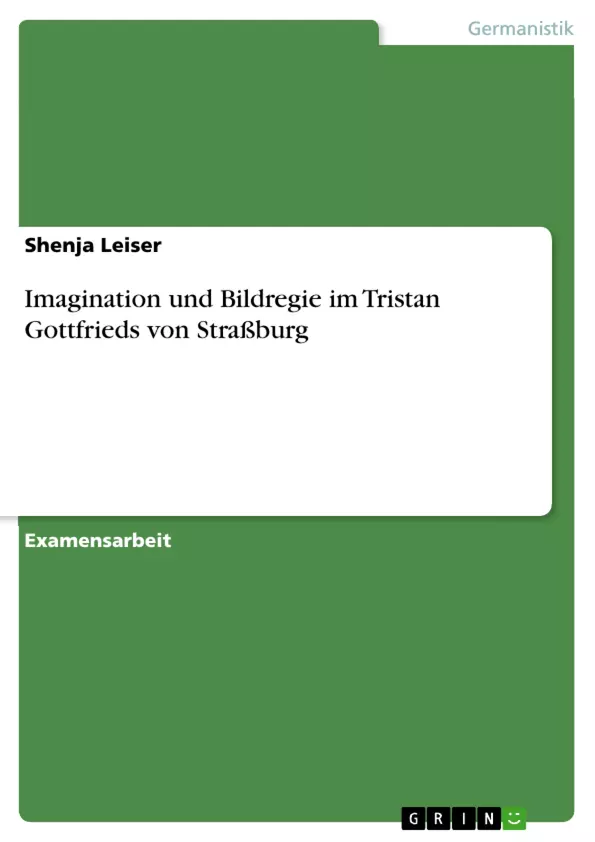Gottfrieds Dichtung genießt seit den Anfängen der Tristan-Philologie eine nahezu uneingeschränkte Wertschätzung ob ihrer ästhetischen Qualität. Hinsichtlich der Deutung und Beurteilung des bearbeiteten Geschehens selbst teilen sich jedoch nach wie vor die Meinungen. Dabei lässt sich insbesondere für die ältere Forschung verzeichnen, dass sie bei ihren Interpretationen die historischen Bedingungen der Dichtung vernachlässigt oder völlig außer Acht lässt und stattdessen aus einem jeweils gegenwärtigen Standpunkt heraus argumentiert. Die jüngere Mediävistik interessiert sich zunehmend für Funktion und Wirkungsweise mittelalterlicher Dichtung aus ihrer zeitgenössischen Perspektive. Vor allem performative Strukturen und Partizipationsmöglichkeiten der höfischen Dichtung werden verstärkt in den Blick genommen. Sinn wird in diesem Zusammenhang nicht als etwas Verborgenes verstanden, das es aufzufinden gilt, sondern als etwas, das durch Vollzug des Sinnlichen hervorgebracht, also erst erzeugt wird. Der Fragestellung dieser Arbeit liegen die Einsichten und Erkenntnisse der Rezeptionsästhetik zugrunde, die den Leser in seiner historischen Situiertheit begreift. Wahrnehmung im Allgemeinen wie in Verbindung mit der Rezeption wird nicht als unveränderlich verstanden, sondern im historischen Diskurs gesehen. Dieser Herangehensweise entsprechend wird versucht zu zeigen, dass Gottfrieds Tristan reich an perzeptiblen Strukturen ist, die einer Wahrnehmungskultur verpflichtet sind, welche sich von der heutigen in weiten Teilen erheblich unterscheidet. Der Text präsentiert sich als ein Wahrnehmungsangebot, als ein imaginierbarer Komplex von Bild- und Sinnesdaten. Dieser soll im Folgenden, untergliedert in Teilaspekte, untersucht werden. Bei den Betrachtungen ist immer zu bedenken, dass die jeweiligen Gesichtspunkte aufeinander aufbauen, einander bedingen und somit schließlich wieder als Ganzes zu sehen sind.
Die Auswahl der Textbelege ist nicht auf Vollständigkeit angelegt, sondern soll Beispielhaftes oder besonders Markantes aufzeigen. Sie richtet sich auch nicht nach der Chronologie des Textes, sondern nach den zu untersuchenden Einzelaspekten.
Insbesondere für längere Passagen wurde versucht, Redundanzen zu bereits vorliegenden Untersuchungen zu vermeiden.
Mit der Frage nach Bildregie und Imagination geht es in der Arbeit einmal mehr um den Versuch, die beeindruckende Wirkung, die die Erzählung (nicht nur) beim mittelalterlichen Rezipienten hinterlässt, zu entschlüsseln.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- I. Vorbetrachtungen
- I. 1. Wahrnehmung, Gedächtnis und Imagination
- I. 2. Bildhaftigkeit der Texte
- II. Imagination und Rezeptionsart
- III. Imagination und Augenzeugenschaft
- III. 1. Der Rezipient als Augenzeuge zweiter Ordnung
- III. 2. Implizite Augenzeugenschaft
- IV. Bildregie
- IV. 1. Erzähler und Erzählbilder
- IV. 2. Bild-Lücken – Lückenbilder
- IV. 3. Einzelbild, Bildgefüge und Bildabfolge
- IV. 3. 1. Polyfokalität
- IV. 3. 2. Filmhafte Wahrnehmung
- V. Imagination von Räumen
- V. 1. Ausgedehnte Räume
- V. 1. 1. Raum durch Bewegung
- V. 1. 2. Raum durch Blicke
- V. 2. Eingerichtete Räume
- V. 2. 1. Symbolkraft und Öffentlichkeitsrelevanz des Sichtbaren
- V. 2. 2. Heimliche Räume
- V. 2. 3. Raum der Täuschung
- V. 3. Performanz
- V. 1. Ausgedehnte Räume
- Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die wissenschaftliche Hausarbeit befasst sich mit der Untersuchung der Imagination und Bildregie in Gottfrieds von Straßburgs "Tristan". Ziel ist es, die beeindruckende Wirkung der Erzählung, die sie auf den mittelalterlichen Rezipienten ausübte, zu entschlüsseln. Der Fokus liegt dabei auf der Frage, wie Wahrnehmung, Gedächtnis und Imagination im Mittelalter miteinander zusammenhingen und wie sich dies auf die Rezeption des Textes auswirkt. Die Arbeit analysiert die Bildhaftigkeit der Texte und erörtert die Rolle des Rezipienten als Augenzeuge zweiter Ordnung.
- Wahrnehmung und Imagination im Mittelalter
- Bildhaftigkeit der Texte und ihre Rezeption
- Der Rezipient als Augenzeuge zweiter Ordnung
- Bildregie in Gottfrieds "Tristan"
- Imagination von Räumen in der Erzählung
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Fragestellung der Arbeit vor und erläutert den theoretischen Hintergrund, der auf Erkenntnisse der Rezeptionsästhetik basiert. Der erste Teil der Arbeit widmet sich den Vorbetrachtungen, indem er die Verbindung von Wahrnehmung, Gedächtnis und Imagination im Mittelalter untersucht und auf die Bildhaftigkeit mittelalterlicher Texte eingeht. Im zweiten Kapitel wird die Rezeptionsart im Mittelalter beleuchtet, während das dritte Kapitel sich mit der Imagination und Augenzeugenschaft beschäftigt. Der vierte Teil analysiert die Bildregie in Gottfrieds "Tristan", indem er die Rolle des Erzählers und die Gestaltung von Bild- und Lückenbildern beleuchtet. Das Kapitel beschäftigt sich zudem mit der Konstruktion von Einzelbildern, Bildgefügen und Bildabfolgen, wobei die Konzepte der Polyfokalität und filmhaften Wahrnehmung betrachtet werden. Der fünfte Teil der Arbeit konzentriert sich auf die Imagination von Räumen in der Erzählung, indem er ausgedehnte Räume und eingerichtete Räume im Kontext von Symbolkraft, Öffentlichkeitsrelevanz und Performanz untersucht.
Schlüsselwörter
Die Arbeit konzentriert sich auf die Bereiche der Rezeptionsästhetik, mittelalterliche Literatur, Bildregie, Imagination, Wahrnehmung, Augenzeugenschaft, Raum, Performanz und Gottfrieds von Straßburgs "Tristan". Besondere Schwerpunkte liegen auf der historischen Situiertheit des Rezipienten, der Bildhaftigkeit von Texten und der Funktionsweise von Erzählbildern im Kontext der mittelalterlichen Kultur.
Häufig gestellte Fragen
Was untersucht die Arbeit im „Tristan“ von Gottfried von Straßburg?
Die Arbeit analysiert die Bildregie und Imagination, um die ästhetische Wirkung der Erzählung auf den mittelalterlichen Rezipienten zu verstehen.
Was bedeutet „Augenzeugenschaft zweiter Ordnung“?
Es beschreibt die Position des Lesers oder Zuhörers, der durch die bildhafte Sprache des Textes das Gefühl bekommt, das Geschehen innerlich mitzuerleben.
Wie werden Räume in Gottfrieds Werk imaginiert?
Räume entstehen im Text durch die Beschreibung von Bewegungen, Blicken der Charaktere sowie durch die Symbolkraft von sichtbaren Objekten.
Was versteht man unter „filmhafter Wahrnehmung“ im Mittelalter?
Es bezieht sich auf die Abfolge von Erzählbildern und den Wechsel der Perspektiven (Polyfokalität), die eine dynamische Vorstellung beim Rezipienten erzeugen.
Welche Rolle spielen „Lückenbilder“ in der Erzählung?
Lückenbilder sind Leerstellen im Text, die der Rezipient durch seine eigene Imagination füllen muss, was die Partizipation an der Dichtung erhöht.
Wie unterscheidet sich die mittelalterliche Wahrnehmungskultur von der heutigen?
Sie war stärker auf das Gedächtnis und die innere Bildverarbeitung angewiesen, wobei Sinn oft erst durch den Vollzug des Sinnlichen erzeugt wurde.
- Citar trabajo
- Shenja Leiser (Autor), 2006, Imagination und Bildregie im Tristan Gottfrieds von Straßburg, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65981