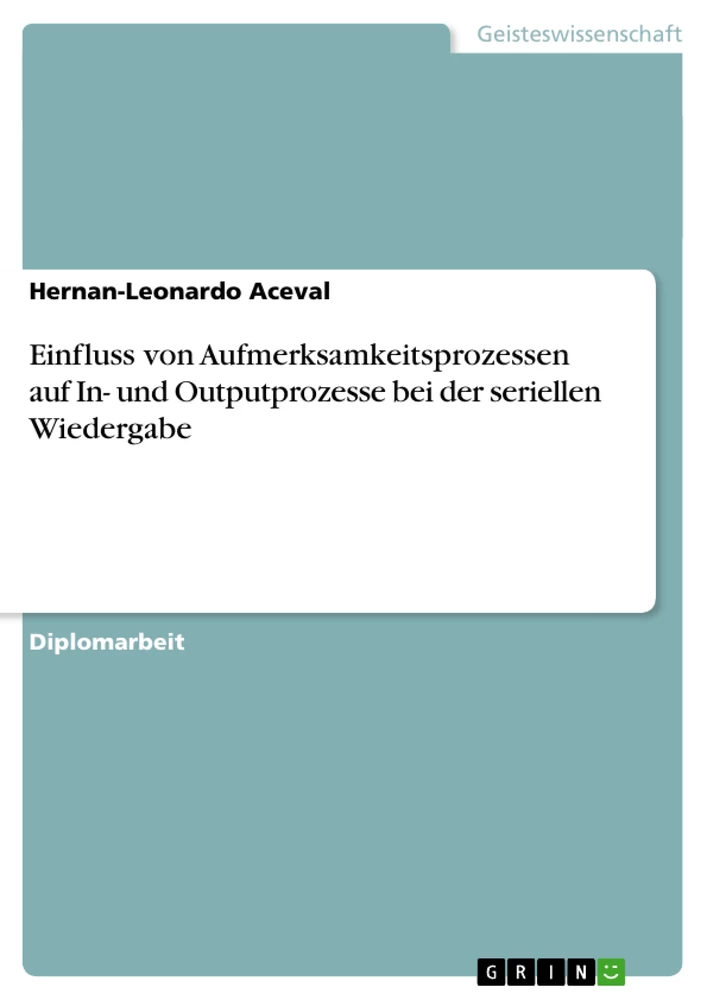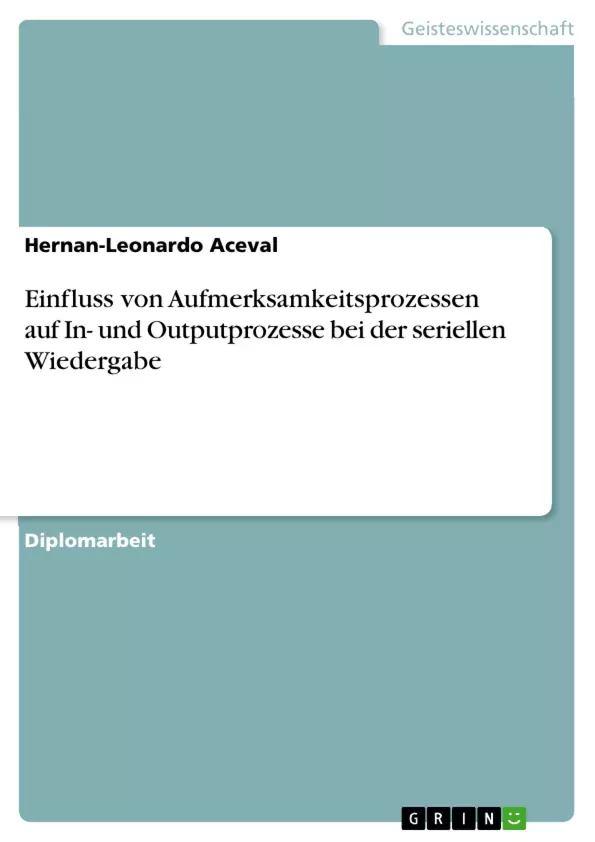Sie fangen gerade jetzt an, eine enorme Leistung zu vollbringen. Sie sitzen bequem, Sie haben vielleicht gerade den Fernseher oder das Radio ausgemacht, um sich besser zu konzentrieren und mit mehr oder weniger Aufmerksamkeit diese Arbeit zu lesen. Wie tun Sie das? Sie nehmen kleine Einheiten wahr, Buchstaben, und addieren diese zu größeren semantischen Einheiten, Silben bzw. Wörtern. Sie machen jetzt weiter, indem sie diese größeren Einheiten eine nach der anderen im Kopf behalten, so dass Sie in der Lage sind, nach ein paar Wörtern ganze Sätze zu bilden und die Aussagen dieses Textes zu verstehen.
Sie haben sich vielleicht zuerst dafür vorbereitet, indem Sie den Titel gelesen und dann einen Blick auf den Inhalt geworfen haben. Ein paar Begriffe haben Sie sich dann gemerkt, so dass Sie jetzt ungefähr eine Ahnung haben, wovon diese Arbeit handelt. Sie werden die Begriffe Gedächtnis, Aufmerksamkeit, serielle Wiedergabe, die Sie schon aus dem Titel und Inhalt dieser Arbeit kennen, jetzt wieder erkennen. Und wenn Sie diesen Punkt erreicht haben, kann es sein, wenn Sie aufmerksam genug gelesen haben, dass Sie sich immer noch an die ersten Sätze erinnern. Wodurch das, was ich bis geschrieben habe, an Sinn gewinnt.
Sie begegnen somit die scheinbare Gegenwart der Sprache. Warum scheinbare Gegenwart? Weil es unzutreffend ist, dass uns Anfang und Ende eines Wortes oder eines kurzen Satzes zur gleichen Zeit gegenwärtig sind. Wie bereits 1740 Segner für visuelle Phänomene zeigen konnte (Baddeley, 1988), sind wir imstande, einzelne hintereinander auftretende Stimuli zu addieren und als ein Ganzes wahrzunehmen. Ein glühendes Stück Kohle an einem rotierenden Rad befestigt wird, in Abhängigkeit von der Rotationsgeschwindigkeit, als ein vollständiger Kreis wahrgenommen. Das erklärt sich dadurch, dass die am Anfang der Drehung entstandene visuelle Spur noch nicht verblasst ist, wenn das Kohlestück wieder am Startpunkt ankommt. Was für das glühende Stück Kohle gilt, gilt auch, bedingt durch andere Mechanismen, für die Sprache.
Wenn wir das Lesen lernen, sammeln wir zunächst Buchstaben, um Wörter zu bilden. Danach sind wir in der Lage, einzelne Einheiten zu immer größeren Einheiten zusammen zu fügen, so dass wir zunächst Silben und dann Wörter als Einheiten betrachten und dadurch unsere Aufnahmekapazität scheinbar vergrößern können.
Inhaltsverzeichnis
- 1. EINLEITUNG
- 2. THEORETISCHER HINTERGRUND
- 2.1. WAS IST GEDÄCHTNIS?
- 2.1.1. Welche Arten von Gedächtnis gibt es?
- 2.2. ZWEI PIONIERE DER EXPERIMENTELLEN GEDÄCHTNISFORSCHUNG
- 2.2.1. Hermann Ebbinghaus
- 2.2.2. William James
- 2.3. GEDÄCHTNISMODELLE
- 2.3.1. Das Mehrspeicher-Modell (MSP) von Atkinson & Shiffrin (1968)
- 2.2.1.1. Sensory memory
- 2.2.1.2. Short term memory
- 2.2.1.3. Long term memory
- 2.3.2. Die Levels of processing Theorie
- 2.3.3. Das Working memory Modell von Alan Baddeley
- 2.3.3.1. Die phonologische Schleife
- 2.3.3.2. Der visuell-räumlicher Notizblock
- 2.3.3.3. Die zentrale Exekutive
- 2.3.3.4. Der episodische Puffer
- 2.3.4. Das Feauture Modell
- 2.3.5. Das Primacy Modell
- 2.3.6. Das ACT-R Modell
- 2.3.7. Das SAS Modell von Norman & Shallice (1986)
- 2.3.8. Das Embedded Processes Modell
- 2.3.1. Das Mehrspeicher-Modell (MSP) von Atkinson & Shiffrin (1968)
- 2.1. WAS IST GEDÄCHTNIS?
- 3. DAS PARADIGMA DER SERIELLEN WIEDERGABE
- 3.1. Serielles Lernen und serielle Wiedergabe
- 3.2. Strukturelle Faktoren bei der seriellen Wiedergabe
- 3.2.1. Inputposition und Enkodiersalienz
- 3.2.2. Outputposition und Interferenz
- 3.2.3. Response set size und Inhibition
- 3.3. Dekonfundierung der seriellen Wiedergabe
- 4. AUFMERKSAMKEIT UND SERIELLES LERNEN
- 4.1. Aufmerksamkeit
- 4.2. Aufmerksamkeit und die serielle Wiedergabe
- 4.3. Aufmerksamkeit innerhalb des working memory Modell
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Aufmerksamkeitsprozessen auf die Leistung bei seriellen Wiedergabe-Aufgaben. Ziel ist es, die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Aufmerksamkeitsmechanismen und den kognitiven Prozessen beim Enkodieren und Abrufen von Informationen im Gedächtnis zu beleuchten.
- Der Einfluss verschiedener Gedächtnismodelle auf die serielle Wiedergabe
- Die Rolle der Aufmerksamkeit beim Enkodieren und Abrufen von Informationen
- Die Bedeutung von Input- und Outputpositionen bei der seriellen Wiedergabe
- Interferenz und Inhibitionseffekte im Kontext der seriellen Wiedergabe
- Die Anwendung des Arbeitsgedächtnismodells (Working Memory) auf serielle Lernsituationen
Zusammenfassung der Kapitel
1. EINLEITUNG: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Arbeit ein und beschreibt die Forschungsfrage sowie die methodische Vorgehensweise. Es legt den Fokus auf die Bedeutung des Gedächtnisses und die Komplexität der beteiligten Prozesse, insbesondere im Kontext der seriellen Wiedergabe. Die Einleitung dient als Grundlage für die folgenden Kapitel, in denen die theoretischen Grundlagen und empirischen Befunde detailliert erläutert werden.
2. THEORETISCHER HINTERGRUND: Kapitel 2 bietet einen umfassenden Überblick über verschiedene Gedächtnismodelle, beginnend mit einer Definition von Gedächtnis und der Beschreibung verschiedener Gedächtnisarten. Es werden die Arbeiten von Ebbinghaus und James als wegweisende Beiträge zur experimentellen Gedächtnisforschung vorgestellt. Der Schwerpunkt liegt auf der Beschreibung und Analyse verschiedener Gedächtnismodelle wie dem Mehrspeichermodell, der Levels-of-Processing-Theorie und dem Working-Memory-Modell von Baddeley, einschließlich der zugehörigen Subkomponenten. Diese Modelle liefern das theoretische Fundament für die Interpretation der Ergebnisse der empirischen Untersuchung.
3. DAS PARADIGMA DER SERIELLEN WIEDERGABE: Kapitel 3 beschreibt detailliert das Paradigma der seriellen Wiedergabe, einen zentralen Bestandteil der empirischen Untersuchung. Es werden sowohl serielle Lernprozesse als auch die serielle Wiedergabe selbst beleuchtet, wobei der Fokus auf strukturellen Faktoren liegt, die die Leistung beeinflussen. Input- und Outputpositionen, Interferenzen und Inhibitionseffekte werden ausführlich diskutiert und die Schwierigkeiten der Dekonfundierung in diesem Bereich hervorgehoben. Dieses Kapitel liefert den methodischen Rahmen für die nachfolgende Diskussion der Ergebnisse.
4. AUFMERKSAMKEIT UND SERIELLES LERNEN: Kapitel 4 untersucht den Einfluss von Aufmerksamkeitsprozessen auf serielle Lern- und Wiedergabeprozesse. Es wird eine umfassende Definition von Aufmerksamkeit gegeben, gefolgt von einer detaillierten Analyse ihres Einflusses auf die Leistung in seriellen Wiedergabe-Aufgaben. Besonders wird der Bezug zur Arbeitsgedächtnistheorie hergestellt und erläutert, wie Aufmerksamkeit die verschiedenen Komponenten des Arbeitsgedächtnisses beeinflusst und somit die Effizienz der Informationsverarbeitung in seriellen Aufgaben moduliert. Dieses Kapitel verbindet die theoretischen Grundlagen mit der empirischen Fragestellung.
Schlüsselwörter
Gedächtnis, serielle Wiedergabe, Aufmerksamkeit, Arbeitsgedächtnis, Enkodierung, Abruf, Interferenz, Inhibition, Gedächtnismodelle, Mehrspeichermodell, Levels of Processing, Working Memory Modell, Inputposition, Outputposition.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zum Dokument: Einfluss von Aufmerksamkeitsprozessen auf die Leistung bei seriellen Wiedergabe-Aufgaben
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einfluss von Aufmerksamkeitsprozessen auf die Leistung bei seriellen Wiedergabe-Aufgaben. Das Hauptziel ist es, die Zusammenhänge zwischen verschiedenen Aufmerksamkeitsmechanismen und den kognitiven Prozessen beim Enkodieren und Abrufen von Informationen im Gedächtnis zu beleuchten.
Welche Themen werden im Detail behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene Gedächtnismodelle (Mehrspeichermodell, Levels of Processing, Working Memory Modell), die Rolle der Aufmerksamkeit beim Enkodieren und Abrufen, die Bedeutung von Input- und Outputpositionen, Interferenz und Inhibitionseffekte, sowie die Anwendung des Arbeitsgedächtnismodells auf serielle Lernsituationen.
Welche Gedächtnismodelle werden vorgestellt?
Das Dokument beschreibt und analysiert verschiedene Gedächtnismodelle, darunter das Mehrspeichermodell von Atkinson & Shiffrin (1968) mit seinen Komponenten (sensorisches Gedächtnis, Kurzzeitgedächtnis, Langzeitgedächtnis), die Levels-of-Processing-Theorie, das Working-Memory-Modell von Baddeley (mit phonologischer Schleife, visuell-räumlichem Notizblock, zentraler Exekutive und episodischem Puffer), das Feature Modell, das Primacy Modell, das ACT-R Modell, das SAS Modell von Norman & Shallice (1986) und das Embedded Processes Modell.
Was ist das Paradigma der seriellen Wiedergabe?
Das Paradigma der seriellen Wiedergabe ist ein zentraler Bestandteil der empirischen Untersuchung. Es beschreibt serielle Lernprozesse und die serielle Wiedergabe selbst, wobei der Fokus auf strukturellen Faktoren wie Input- und Outputpositionen, Interferenzen und Inhibitionseffekten liegt. Die Schwierigkeiten der Dekonfundierung in diesem Bereich werden ebenfalls diskutiert.
Welche Rolle spielt die Aufmerksamkeit?
Die Arbeit untersucht den Einfluss von Aufmerksamkeitsprozessen auf serielle Lern- und Wiedergabeprozesse. Es wird analysiert, wie Aufmerksamkeit die verschiedenen Komponenten des Arbeitsgedächtnisses beeinflusst und somit die Effizienz der Informationsverarbeitung in seriellen Aufgaben moduliert.
Welche Schlüsselwörter beschreiben den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Gedächtnis, serielle Wiedergabe, Aufmerksamkeit, Arbeitsgedächtnis, Enkodierung, Abruf, Interferenz, Inhibition, Gedächtnismodelle, Mehrspeichermodell, Levels of Processing, Working Memory Modell, Inputposition, Outputposition.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in vier Kapitel gegliedert: Einleitung (Einführung in die Thematik und Forschungsfrage), Theoretischer Hintergrund (Beschreibung verschiedener Gedächtnismodelle), Das Paradigma der seriellen Wiedergabe (detaillierte Beschreibung des Paradigmas und Einflussfaktoren) und Aufmerksamkeit und serielles Lernen (Einfluss von Aufmerksamkeitsprozessen auf serielle Lern- und Wiedergabeprozesse).
Wer sind wichtige Persönlichkeiten in der Gedächtnisforschung, die erwähnt werden?
Die Arbeit erwähnt Hermann Ebbinghaus und William James als Pioniere der experimentellen Gedächtnisforschung.
- Citation du texte
- Diplom Psychologe Hernan-Leonardo Aceval (Auteur), 2005, Einfluss von Aufmerksamkeitsprozessen auf In- und Outputprozesse bei der seriellen Wiedergabe, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/65994