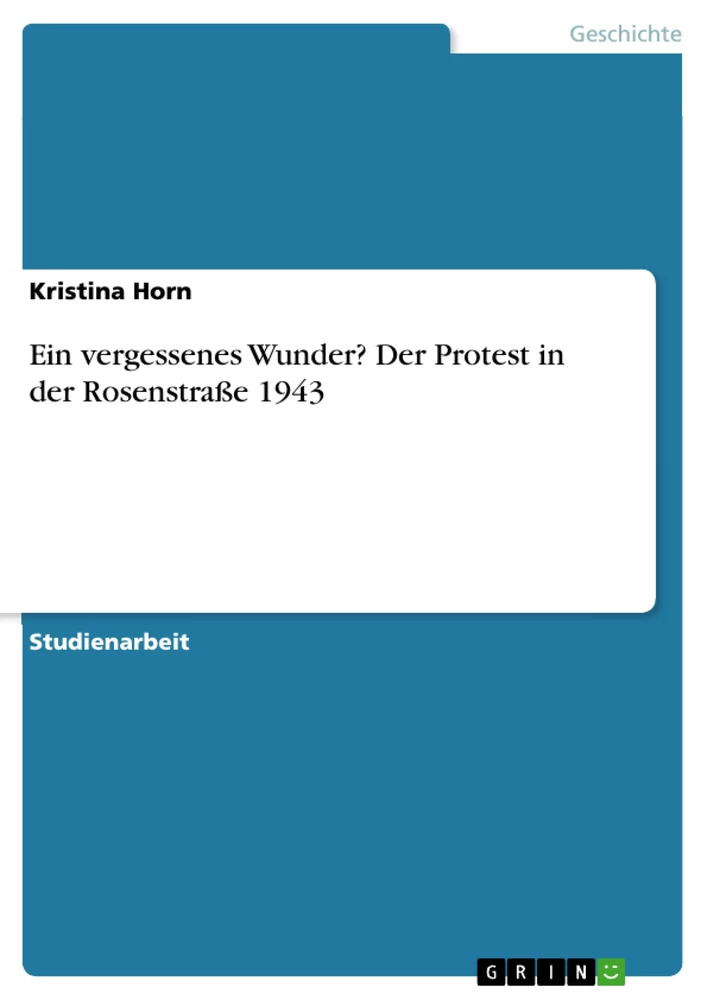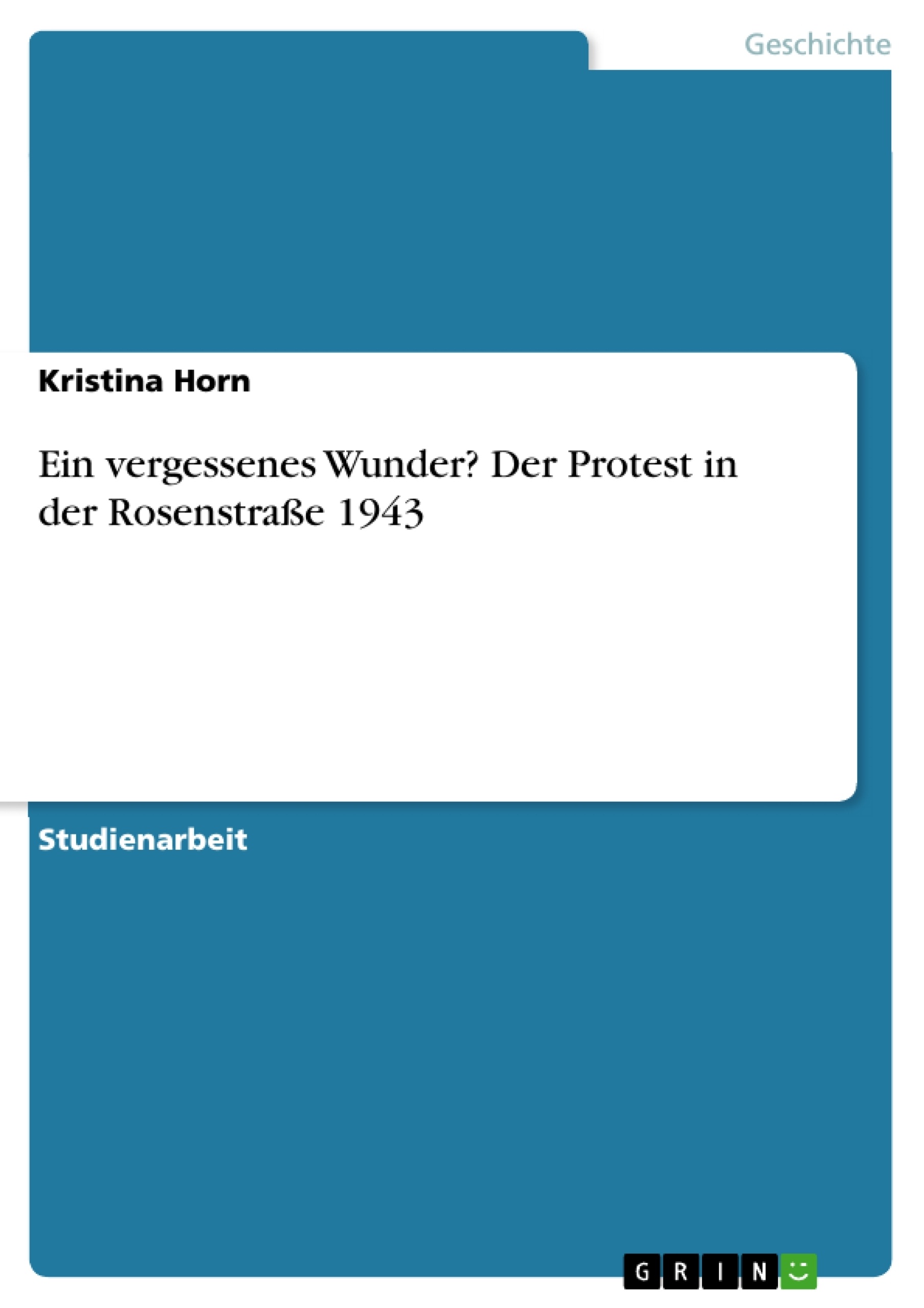„Woher die Leute alle von der Rosenstrasse wußten, weiß ich nicht. Weder ist es inszeniert worden noch sonst was. Alle sind von selbst dahin, das war das eigenartige. Es ist ja keiner aufgefordert worden. Ich bin nicht gegangen, weil irgend jemand gesagt hat: Sie müssen dort hingehen. Ich bin nicht gegangen, weil jemand sagte: Gehen wir. Das ist das Wunderbare an dieser Geschichte.“ Elsa Holzer. Am 6. März 1943 ereignete sich etwas in Berlin, was bis dahin niemand für möglich gehalten hatte. Mehr als tausend Juden, die in Konzentrationslager deportiert werden sollten und in dem Sammellager Rosenstraße 2-4 interniert waren, wurden wieder in die Freiheit entlassen. Diese Menschen verdankten ihre Rettung nicht einer spektakulären Befreiungsaktion, sondern wurden offiziell und völlig regulär entlassen. Die Freilassung dieser zum größten Teil männlichen Gefangenen war das Resultat einer eine Woche lang währenden Demonstration ihrer deutschen Ehefrauen und Mütter. Dieser Protest fand Anfang März 1943 mitten in Berlin in der Rosenstraße statt und war der einzige bis heute bekannte öffentliche Protest gegen die Judendeportation während des gesamten Nazi-Regimes. 2 Umso erstaunlicher, dass er lange Zeit von der Forschung überhaupt nicht beachtet wurde. 1943 hatte kaum jemand etwas von dem Erfolg des Protestes mitbekommen, da die Regierung mit ihrer „Niederlage“ natürlich nicht an die Öffentlichkeit ging. Bekannt wurden die Ereignisse in der Rosenstraße erst nach dem zweiten Weltkrieg durch einen Artikel in der Zeitschrift Sie. 3 Merkwürdigerweise gerieten sie aber dennoch wieder in Vergessenheit, was wohl auch daran lag, dass sich die historische Forschung lange Zeit nach dem Krieg fast ausschließlich mit dem bürgerlich-militärischen Widerstand beschäftigte. Erst Anfang der Neunziger Jahre wurden die Geschehnisse in der Berliner Rosenstraße durch das Fernsehen wieder in Erinnerung gerufen. Anlaß hierfür war der 50. Geburtstag des Protestes im Jahre 1993, an dem in der Rosenstraße ein Mahnmal von der Bildhauerin Ingeborg Hunzinger eingeweiht wurde. 4 Die vorliegende Arbeit möchte die Geschehnisse in der Rosenstraße aufnehmen und der Frage nachgehen, ob es sich bei diesem Protest und dem mit ihm verbundenen Resultat womöglich um ein vergessenes Wunder handelt? [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Der Protest in der Rosenstraße
- 2.1. Die Problematik der Mischehe
- 2.2. Die Schlussaktion der Berliner Juden
- 2.3. „Wir wollen unsere Männer!“
- 3. Das Resultat des Protests in der Rosenstraße
- 4. Der Protest in der Rosenstraße - Eine Widerstandshandlung gegen die Nationalsozialisten?
- 5. Schlussbeurteilung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Protest in der Rosenstraße im März 1943, einen weitgehend vergessenen öffentlichen Protest gegen die Deportation von Juden während des Nazi-Regimes. Ziel ist es, die Ereignisse zu rekonstruieren und zu analysieren, ob dieser Protest als Widerstandshandlung gewertet werden kann und welche Bedeutung er im Kontext des Widerstands im Dritten Reich einnimmt.
- Die Problematik der Mischehen im Nationalsozialismus
- Die Schlussaktion der Berliner Juden und die damit verbundenen Deportationen
- Der Ablauf und die Organisation des Protestes in der Rosenstraße
- Die Motivation und der Mut der protestierenden Frauen
- Die Bewertung des Protestes als Widerstandshandlung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung stellt den Protest in der Rosenstraße als ein „vergessenes Wunder“ vor und beschreibt die überraschende Freilassung von Juden aus dem Sammellager aufgrund des Protests ihrer nichtjüdischen Ehepartnerinnen. Sie hebt die Bedeutung dieses einzigartigen öffentlichen Widerstands gegen die Deportationen hervor und kündigt die weiteren Kapitel an, die die Hintergründe, den Ablauf und die Bedeutung des Protestes beleuchten sollen.
2. Der Protest in der Rosenstraße: Dieses Kapitel beschreibt den Protest der deutschen Frauen in der Rosenstraße im März 1943 und fragt nach den Ursachen für ihren Mut, sich öffentlich gegen das Regime zu stellen. Es stellt die Frage, wie es diesen Frauen gelang, trotz der immensen Risiken, gegen die Deportation ihrer jüdischen Ehemänner zu protestieren.
2.1. Die Problematik der Mischehe: Dieser Abschnitt beleuchtet den Begriff „Mischehe“ im Kontext des Nationalsozialismus, von der anfänglichen konfessionellen Bedeutung bis hin zur rassistischen Definition und der Unterscheidung zwischen privilegierten und einfachen Mischehen. Er zeigt auf, welche rechtlichen und gesellschaftlichen Schwierigkeiten Mischehen mit sich brachten und wie die betroffenen Frauen bereits vor dem Protest in der Rosenstraße Widerstand geleistet haben, indem sie zu ihren jüdischen Ehemännern standen.
2.2. Die Schlussaktion der Berliner Juden: Dieser Abschnitt beschreibt die „Schlussaktion der Berliner Juden“ im Februar/März 1943, die die Deportation der verbleibenden Juden, einschließlich derer aus Mischehen, zum Ziel hatte. Er erklärt den Kontext der Aktion im Rahmen der „Endlösung“ und zeigt auf, dass die Deportation der Juden aus Mischehen als letztes Hindernis auf dem Weg zur vollständigen „Säuberung“ Berlins von Juden galt.
3. Das Resultat des Protests in der Rosenstraße: Dieses Kapitel analysiert das überraschende Ergebnis des Protestes: die Freilassung der inhaftierten Männer. Es untersucht die Gründe für diesen Erfolg, die Rolle der beteiligten Behörden und die Bedeutung der Intervention der Frauen.
4. Der Protest in der Rosenstraße - Eine Widerstandshandlung gegen die Nationalsozialisten?: Dieses Kapitel diskutiert die Frage, ob der Protest in der Rosenstraße als Widerstandshandlung gegen das Nazi-Regime eingestuft werden kann. Es untersucht den Protest im Kontext anderer Formen des Widerstands und stellt die Frage, ob ähnliche Proteste mit dem gleichen Erfolg hätten geendet und möglicherweise viele Menschenleben hätten retten können.
Schlüsselwörter
Rosenstraße, Protest, Widerstand, Drittes Reich, Judendeportation, Mischehe, Nationalsozialismus, Frauenprotest, Zivilcourage, „Endlösung“.
Häufig gestellte Fragen zum Protest in der Rosenstraße
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Protest in der Rosenstraße im März 1943, einen weitgehend vergessenen öffentlichen Protest gegen die Deportation von Juden während des Nazi-Regimes. Die Arbeit rekonstruiert die Ereignisse und analysiert, ob dieser Protest als Widerstandshandlung gewertet werden kann und welche Bedeutung er im Kontext des Widerstands im Dritten Reich einnimmt.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Problematik der Mischehen im Nationalsozialismus, die Schlussaktion der Berliner Juden und die damit verbundenen Deportationen, den Ablauf und die Organisation des Protestes in der Rosenstraße, die Motivation und den Mut der protestierenden Frauen sowie die Bewertung des Protestes als Widerstandshandlung.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, Kapitel zum Protest in der Rosenstraße (inklusive Unterkapitel zur Problematik der Mischehe und der Schlussaktion der Berliner Juden), ein Kapitel zum Ergebnis des Protestes und ein Kapitel zur Bewertung des Protestes als Widerstandshandlung. Sie schließt mit einer Schlussbeurteilung und einer Liste von Schlüsselbegriffen.
Was ist das Hauptresultat des Protestes in der Rosenstraße?
Das überraschende Ergebnis des Protestes war die Freilassung der inhaftierten jüdischen Männer, deren nicht-jüdische Ehepartnerinnen protestiert hatten. Die Arbeit analysiert die Gründe für diesen Erfolg, die Rolle der beteiligten Behörden und die Bedeutung der Intervention der Frauen.
Kann der Protest in der Rosenstraße als Widerstandshandlung betrachtet werden?
Diese Frage wird in einem eigenen Kapitel diskutiert. Die Arbeit untersucht den Protest im Kontext anderer Formen des Widerstands und stellt die Frage, ob ähnliche Proteste mit dem gleichen Erfolg hätten geendet und möglicherweise viele Menschenleben hätten retten können.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Rosenstraße, Protest, Widerstand, Drittes Reich, Judendeportation, Mischehe, Nationalsozialismus, Frauenprotest, Zivilcourage, „Endlösung“.
Welche Bedeutung hat der Protest im Kontext des Widerstands im Dritten Reich?
Die Arbeit untersucht die Bedeutung des einzigartigen öffentlichen Widerstands gegen die Deportationen im Kontext des gesamten Widerstands während des Dritten Reichs. Sie beleuchtet den Mut der beteiligten Frauen und die Frage, ob ähnliche Aktionen hätten mehr Leben retten können.
Welche Rolle spielten die Mischehen im Nationalsozialismus?
Die Arbeit beleuchtet die Problematik der Mischehen, von der anfänglichen konfessionellen Bedeutung bis hin zur rassistischen Definition und der Unterscheidung zwischen privilegierten und einfachen Mischehen. Sie zeigt die rechtlichen und gesellschaftlichen Schwierigkeiten auf und den Widerstand, den betroffene Frauen bereits vor dem Protest in der Rosenstraße geleistet haben.
Was war die "Schlussaktion der Berliner Juden"?
Die "Schlussaktion der Berliner Juden" im Februar/März 1943 zielte auf die Deportation der verbleibenden Juden, einschließlich derer aus Mischehen, ab. Die Arbeit erklärt den Kontext dieser Aktion im Rahmen der "Endlösung".
- Citar trabajo
- Kristina Horn (Autor), 2004, Ein vergessenes Wunder? Der Protest in der Rosenstraße 1943, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66236