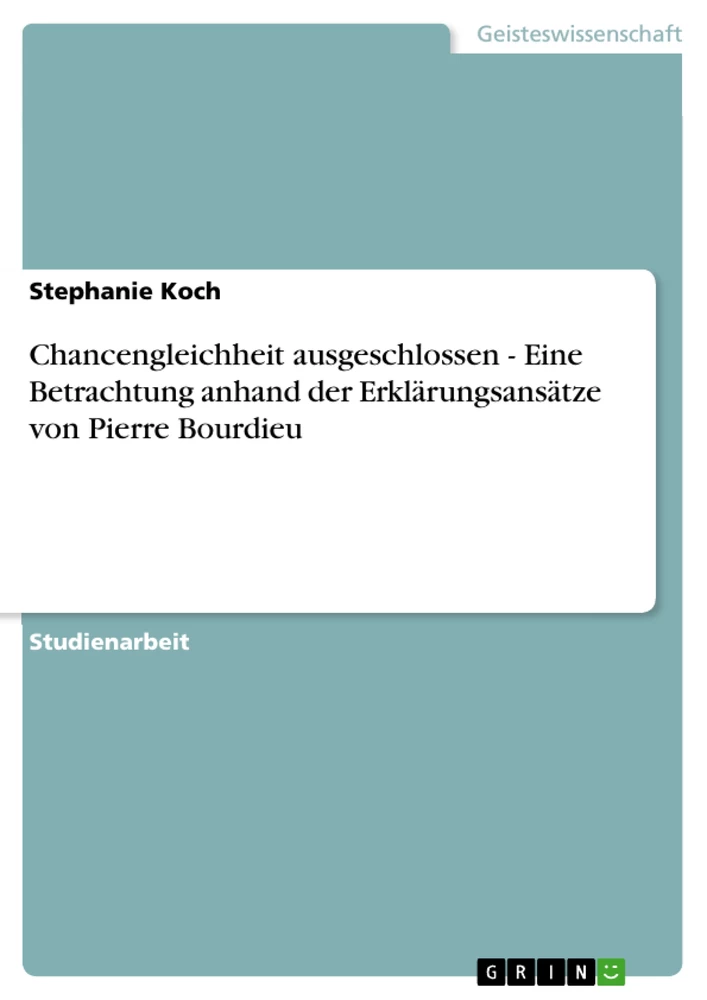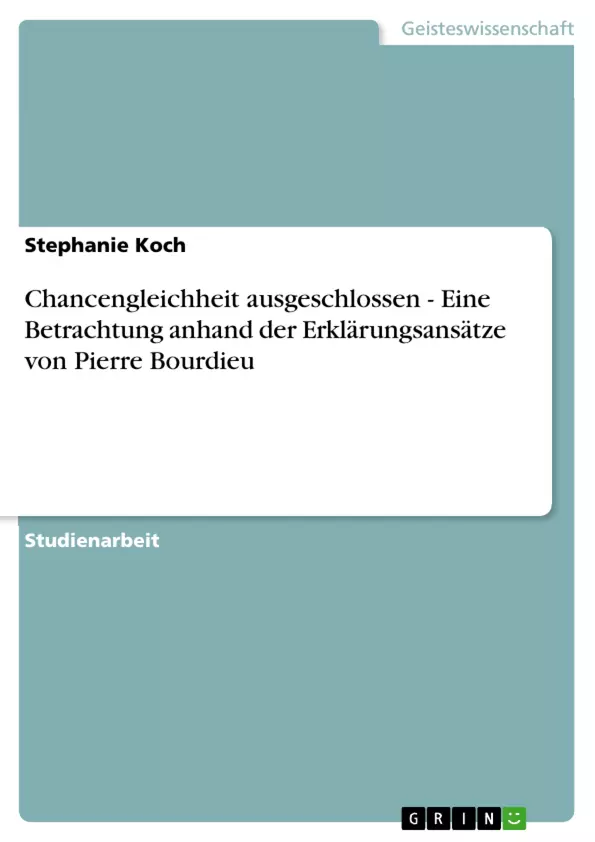Regelmäßig prägt das Thema der ungleichen Bildungschancen in Deutschland die politische und mediale Diskussion. Nicht erst seit PISA liefern zahlreiche Studien zum Thema, Ergebnisse, aus denen folgende Kausalitätsbeziehungen abgeleitet werden: soziale Herkunft eines Kindes, insbesondere Einkommen und Bildung der Eltern beeinflussen in entscheidendem Maße den Bildungswerdegang und den Bildungserfolg von Schulkindern in Deutschland. Schlagwörter, wie z.B. “Armutskarriere” und “absteigendes Prekariat”, die zum einen die Chancenungleichheit von Kindern aus sozial schwächeren Schichten verdeutlichen sollen, zum anderen auf eine eklatante Ungleichheit in der Bevölkerung hinweisen, machen die Runde.
Zusätzlich angeheizt wird die Debatte von Seiten der Bildungsökonomie, die behauptet, Wissen sei die wichtigste Ressource moderner Gesellschaften und entscheidend für wirtschaftliches Wachstum und die Innovationsfähigkeit einer Gesellschaft. Aus Sicht der Humankapitaltheorie ist Bildung ein Kapital, das die höchste Rendite abwirft, wenn es maximiert wird. Die Nicht-Ausschöpfung von Bildungsreserven ist eine Verschwendung von Humankapital und schadet der Wirtschaft und muss deshalb unbedingt vermieden werden. Es wird somit behauptet, die Bildungsproduktion sei auf den Arbeitsmarkt angepasst. Grundlegend für die Bildungsökonomie ist zudem die These, dass jeder Einzelne gewillt ist, in seine eigene Bildung zu investieren, um seine eigene Produktivität bzw. sein Einkommen zu steigern. Nach dieser Theorie gäbe es in einer Gesellschaft, in der das Bildungssystem sowie der Einzelne an die qualitatitven und quantitativen Bedürfnisse der Wirtschaft angepasst ist, eigentlich keinen Raum für Chancenungleichheit.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Das intermediäre “Theoriekonzept” Bourdieus
- Die illusionäre Chancengleichheit nach Bourdieu
- Bildungsexpansion oder Ungleichheitsexpansion?
- Chancengleicheit oder Chancengerechtigkeit?
- Die Rolle des (Bildungs-)Habitus und der Begabungsideologie
- Die rationale Pädagogik
- Schlußbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit befasst sich mit der Frage der Bildungschancengleichheit und untersucht, inwiefern diese nach Bourdieu's Theoriekonzept tatsächlich existiert. Der Fokus liegt dabei auf der Analyse der Ungleichheiten im Bildungssystem und der Rolle, die der Habitus und die Begabungsideologie dabei spielen. Ziel ist es, die wichtigsten Forschungsergebnisse Bourdieus vorzustellen und seine Argumentation für eine rationale Pädagogik zu beleuchten. Darüber hinaus werden die Ergebnisse in den aktuellen Kontext der deutschen Bildungslandschaft eingeordnet.
- Die Illusion der Chancengleichheit im Bildungssystem
- Die Bedeutung des Habitus und seiner Prägung durch die soziale Herkunft
- Die Rolle der Begabungsideologie und ihre Auswirkungen auf die Bildungschancen
- Die Notwendigkeit einer rationalen Pädagogik zur Förderung von Chancengleichheit
- Die Integration der Bourdieu'schen Ergebnisse in die deutsche Bildungswirklichkeit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des Themas Bildungschancengleichheit in Deutschland dar und beleuchtet die Diskrepanz zwischen den idealistischen Zielen der Bildungsreformen und der bestehenden Realitäten. Kapitel 2 fokussiert auf Bourdieu's Theoriekonzept und seinen Ansatz, den Gegensatz von Subjektivismus und Objektivismus in der Betrachtung sozialer Phänomene zu überwinden. Dabei wird besonders die Habitustheorie hervorgehoben, die die unbewusste Prägung des Einzelnen durch seine soziale Position in der Gesellschaft erläutert. Kapitel 3 beleuchtet die Illusion der Chancengleichheit, indem es die Mechanismen der Reproduktion von Ungleichheiten im Bildungssystem anhand von Bourdieu's Analysen aufzeigt. Kapitel 4 schließlich präsentiert die konzeptionelle Alternative von Bourdieu, die rationale Pädagogik, als Lösungskonzept zur Überwindung der Ungleichheit im Bildungssystem.
Schlüsselwörter
Die zentralen Schlüsselwörter dieser Hausarbeit sind Bildungschancengleichheit, Habitus, Kapital, Feld, Begabungsideologie, rationale Pädagogik, Pierre Bourdieu, Reproduktion von Ungleichheit, soziale Herkunft, Bildungssystem, deutsche Bildungswirklichkeit. Die Arbeit befasst sich mit der Frage, wie soziale Ungleichheit durch das Bildungssystem reproduziert wird und welche Rolle der Habitus und die Begabungsideologie in diesem Zusammenhang spielen. Dabei geht es darum, die theoretischen Konzepte Bourdieus zu erläutern und deren Relevanz für die deutsche Bildungslandschaft zu beleuchten.
Häufig gestellte Fragen
Warum ist Chancengleichheit laut Bourdieu eine Illusion?
Bourdieu argumentiert, dass das Bildungssystem soziale Ungleichheiten reproduziert, anstatt sie abzubauen, da es den kulturellen Habitus der herrschenden Klasse bevorzugt.
Was bedeutet der Begriff "Habitus" in diesem Kontext?
Der Habitus ist die unbewusste Prägung eines Menschen durch seine soziale Herkunft, die sein Verhalten, seine Sprache und seine Erfolgsaussichten im Bildungssystem bestimmt.
Was kritisiert Bourdieu an der "Begabungsideologie"?
Er kritisiert, dass schulischer Erfolg oft als natürliche Begabung getarnt wird, während er in Wahrheit auf privilegierten Startbedingungen und sozialem Kapital beruht.
Was ist die "Rationale Pädagogik"?
Es ist ein von Bourdieu vorgeschlagenes Lösungskonzept, das durch gezielte Förderung die Benachteiligung von Kindern aus bildungsfernen Schichten aktiv ausgleichen soll.
Wie beeinflusst das Einkommen der Eltern den Bildungserfolg in Deutschland?
Zahlreiche Studien (wie PISA) belegen eine starke Kausalität zwischen der sozialen Herkunft (Einkommen und Bildung der Eltern) und dem tatsächlichen Bildungserfolg der Kinder.
- Citar trabajo
- Stephanie Koch (Autor), 2006, Chancengleichheit ausgeschlossen - Eine Betrachtung anhand der Erklärungsansätze von Pierre Bourdieu, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66471