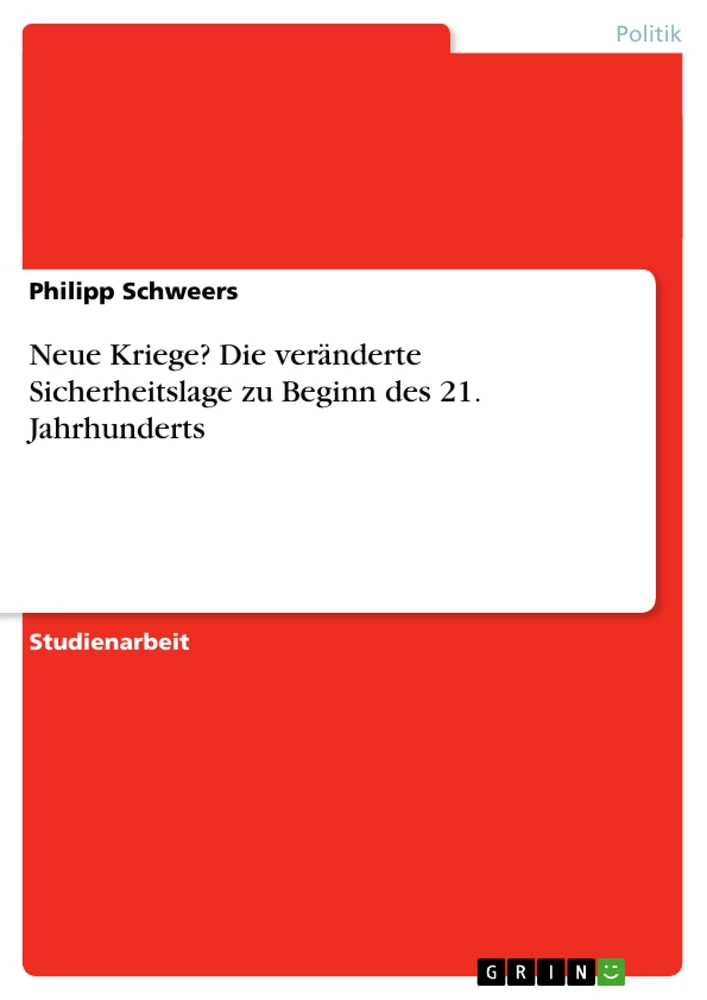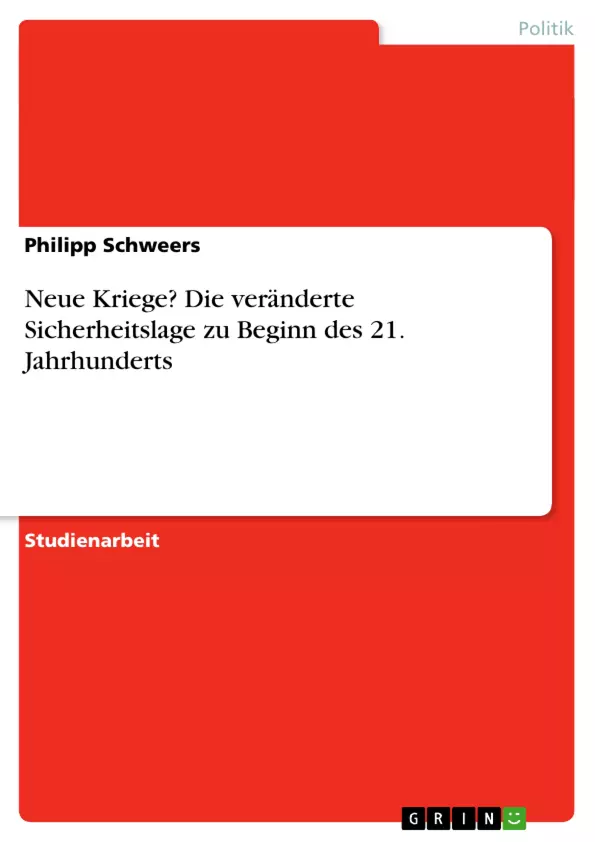Seit den Ereignissen vom 11. September 2001 und den daraus resultierten militärischen Konflikten ist auch der breiten Öffentlichkeit die veränderte globale Sicherheitslage bewusst geworden. Schon seit dem 2. Weltkrieg veränderte sich die globale Konfliktstruktur. Die bis dato im europäisch-westlichen Bewusstsein dominierende Vorstellung vom klassischen, zwischenstaatlichen Kriege ist im Vergleich zum gesamten, kontinuierlich zunehmenden Kriegsgeschehen immer seltener geworden. Bis 1990 wurden andere Konfliktdimensionen fast immer gegenüber der ideologischen unterbetont. Mit dem Ende des Kalten Krieges fiel die Systemkonkurrenz als Faktor in Regionalkonflikten weg. In der Umbruchsphase des Internationalen Systems von 1988-1992 keimte in großen Teilen der Intellektualität die Hoffnung einer neuen, friedlichen Weltordnung. Es war die Rede vom „Ende der Geschichte“, der Kant’sche „demokratische Friede“ sei zum Greifen nah und die sich stark intensivierende wirtschaftliche Globalisierung würde zu allgemeinem Wohlstand führen, die wechselseitige Interdependenz militärische Konflikte unlogisch machen. Diese Hoffnung hat sich nicht bestätigt. Die wie durch einen ideologischen Dampfkessel während des Ost-West-Konfliktes stabil gehaltene internationale Staatenwelt begann nach der Implosion der Sowjetunion massiv zu bröckeln. Entgegen vieler Erwartungen hat die stark voranschreitende wirtschaftliche Globalisierung mit ihren einhergehenden wechselseitigen Interdependenzen ein instabiles und störanfälliges Klima in den Internationalen Beziehungen geschaffen. Regional beschränkte wirtschaftliche oder politische Krisen wirken auf Grund des hohen Vernetzungs- und Abhängigkeitsgrades global. Weltweit zu beobachtende Phänomene wie die Entstehung von Kriegsökonomien, Entstaatlichung, internationalen Terrornetzwerken und die des Aufstiegs privater Konfliktakteure, haben sicherheitspolitische Folgen für die gesamte Staatenwelt. Durch den hohen Grad der wirtschaftlichen, politischen und strukturellen Abhängigkeit, der sich wandelnden Rolle des Nationalstaats sowie den neuen Informations-, Kommunikations- und High-Tech-Optionen hat sich auch die globale Sicherheitslage stark verändert, was diese Arbeit aufzeigen möchte. Neben operationalen Definitionen und ordnenden Kriterien des „Chamäleons Krieg“ möchte ich auf die Beschaffenheit und einzelnen Dimensionen des sich wandelnden Konfliktbildes eingehen, dass von diversen Autoren unter dem Begriff „neue Kriege“ subsumiert wird.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Konfliktentwicklung im 20. Jahrhundert
- Der Begriff des Krieges - Operationale Definition und Typologien
- Die Konfliktlage nach dem Zweiten Weltkrieg - Statistische Trends
- Die Neuen Kriege – Globalisierung der Sicherheitsprobleme
- Dimensionen des Wandels
- Internationalisierung und Regionalisierung der Konflikte
- Fragile Staatlichkeit und Privatisierung des Gewaltmonopols
- Kommerzialisierung und Schattenglobalisierung
- Asymmetrisierung und Irregularität
- Entregelung
- Der internationale Terrorismus
- Die veränderte Sicherheitslage – Tatsächlich ein Novum?
- Dimensionen des Wandels
- Der „Krieg von morgen“ – Mögliche Entwicklungstendenzen
- Fazit
- Literatur
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die veränderte globale Sicherheitslage und das sich wandelnde Konfliktbild im 21. Jahrhundert. Dabei fokussiert sie sich auf den Wandel von klassischen, zwischenstaatlichen Kriegen hin zu neuen Formen von Konflikten, die durch Globalisierung, Fragile Staatlichkeit und neue Akteure geprägt sind.
- Die Entstehung und Entwicklung der „Neuen Kriege“
- Die Dimensionen des Wandels in der Konfliktlandschaft
- Die Rolle von Globalisierung und Fragiler Staatlichkeit
- Die Bedeutung neuer Akteure und Konfliktformen
- Mögliche Trends und Tendenzen für zukünftige Konflikte
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung skizziert die veränderte Sicherheitslage seit dem 11. September 2001 und stellt die Dominanz innerstaatlicher Kriege in der „Dritten Welt“ im Vergleich zu klassischen zwischenstaatlichen Kriegen heraus. Kapitel 2 beschäftigt sich mit der Entwicklung von Konflikten im 20. Jahrhundert, definiert den Begriff des Krieges und betrachtet verschiedene Typologien. Das dritte Kapitel analysiert die „Neuen Kriege“ als Ergebnis der Globalisierung und widmet sich den verschiedenen Dimensionen dieses Wandels, darunter Internationalisierung, Fragile Staatlichkeit, Kommerzialisierung und Asymmetrisierung.
Schlüsselwörter
Neue Kriege, Konfliktentwicklung, Globalisierung, Fragile Staatlichkeit, Sicherheitslage, Internationale Beziehungen, Kriegsdefinitionen, Typologien, Internationalisierung, Regionalisierung, Privatisierung des Gewaltmonopols, Kommerzialisierung, Asymmetrisierung, Terrorismus, Entwicklungstendenzen.
Häufig gestellte Fragen
Was sind „Neue Kriege“?
Der Begriff beschreibt den Wandel von klassischen zwischenstaatlichen Kriegen hin zu innerstaatlichen Konflikten, die durch Entstaatlichung, asymmetrische Gewalt und private Akteure geprägt sind.
Wie hat die Globalisierung die Sicherheitslage verändert?
Durch die hohe wirtschaftliche und politische Vernetzung wirken regionale Krisen heute global; zudem entstehen globale Terrornetzwerke und Schattenglobalisierungen.
Was versteht man unter der „Privatisierung des Gewaltmonopols“?
In fragilen Staaten geht das staatliche Monopol auf Gewalt verloren und wird durch private Konfliktakteure, Warlords oder Söldner ersetzt.
Warum ist der „demokratische Friede“ nach 1990 nicht eingetreten?
Trotz Hoffnungen auf eine friedliche Weltordnung nach dem Kalten Krieg führten neue Instabilitäten und die Implosion der Sowjetunion zu zahlreichen neuen Regionalkonflikten.
Was ist eine „Kriegsökonomie“?
Es beschreibt die Kommerzialisierung von Konflikten, bei denen Akteure ein wirtschaftliches Interesse an der Fortführung des Krieges haben (z.B. durch Ressourcenraub).
Welche Rolle spielt der internationale Terrorismus?
Seit dem 11. September 2001 gilt er als zentrale Dimension der neuen Sicherheitslage, die asymmetrische Bedrohungen für die gesamte Staatenwelt schafft.
- Citar trabajo
- Philipp Schweers (Autor), 2006, Neue Kriege? Die veränderte Sicherheitslage zu Beginn des 21. Jahrhunderts, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66680