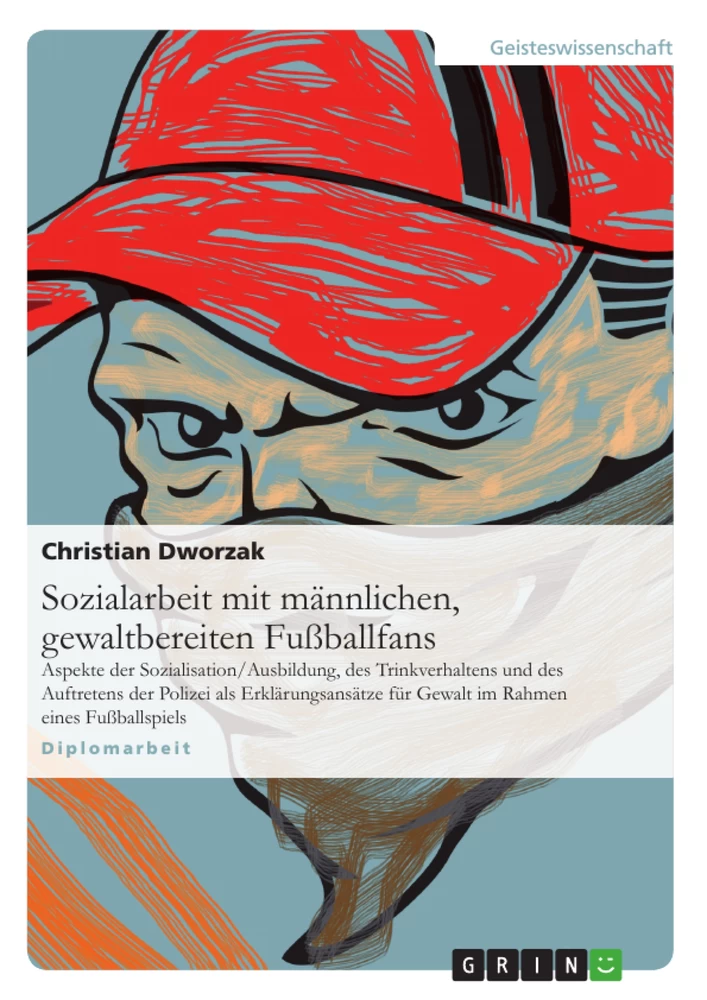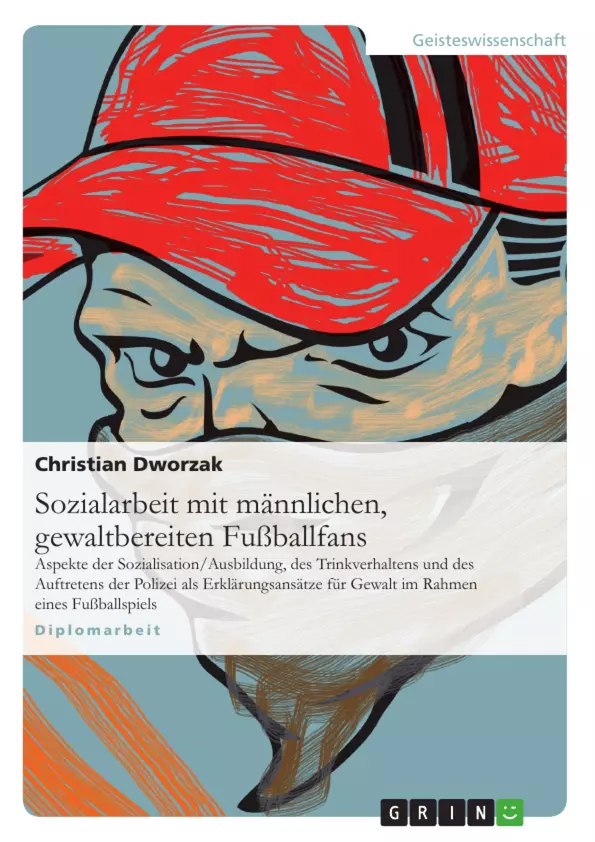Im Jahr 1846 begann, mit der Gründung des weltweit ersten Fußballvereins Sheffield
F.C, die Ära des modernen Fußballs. Seitdem ist Fußball ein wichtiger Bestandteil
unserer Gesellschaft und unseres Lebens. Mit der immer größer werdenden Popularität
des Fußballs, und der damit verbundenen Zuschauerzahlen, entwickelte sich auch das
Phänomen des Hooliganismus im Rahmen von Fußballspielen.
Heutzutage gehören Hooligans genauso zum Fußball dazu, wie der Ball, der
Schiedsrichter und die 22 Feldspieler. Die Subkultur der Hooligans wurde lange Zeit
von der Öffentlichkeit und den Medien ignoriert bzw. der Gesellschaft falsch
dargestellt, was auch der Grund war, warum es keine sozialarbeiterische Betreuung
eben dieser Subkultur gab.
In Deutschland erkannte man 1981, dass repressive Maßnahmen seitens der
Gesetzgebung, dem Fußballverband und der Vereine alleine nicht ausreichen um dem
Phänomen von gewaltbereiten Fußballfans entgegen zu wirken. Eine ganzheitliche
Betreuung von Hooligans war nur mit geeigneten Strukturellen Maßnahmen zu
realisieren.
Mit der Entstehung von sozialarbeiterischen/sozialpädagogischen angeleiteten
Fanprojekten im Jahr 1981 in Norddeutschland wurden die Voraussetzungen und
Strukturen dafür geschaffen. In Österreich bediente man sich ab dem Jahr 1979 der
Methode des Streetworks um die sozialarbeiterische Betreuung von Hooligans zu
realisieren, welche im Jahr 1996 endete und im Gegensatz zu Deutschland eher zu
repressiven Maßnahmen gegenüber Hooligans und auch nicht gewaltbereiten
Fußballfans führte.
Alleine die Tatsache,dass die kommende Fußballeuropameisterschaft 2008 unter
anderem in Österreich stattfindet und es zu erwarten ist, dass sich die gewaltbereite
Fußballszene vergrößern wird, spricht für die Notwendigkeit einer ganzheitlichen, die
Sozialarbeit mit einschließenden, Betreuung von gewaltbereiten Fußballfans.
Inhaltsverzeichnis
- Vorwort
- 1. Einleitung
- 2. Begriffserklärungen und Theoretische Grundlagen
- 2.1 Subkultur
- 2.2 Gewalt
- 2.2.1 Definition physische Gewalt
- 2.2.2 Definition strukturelle Gewalt
- 2.3 Ausdifferenzierung der Fußballfanszene
- 2.4 Hooligan/Hooliganismus
- 2.4.1 Ursprung des Wortes
- 2.4.2 Geschichte des Hooliganismus
- 2.4.3 Definition Hooligan/Hooliganismus
- 2.4.4 Gewalt im Zusammenhang mit Hooliganismus
- 3. Ursachen für Hooliganismus
- 3.1 Die Frage nach dem Warum
- 3.2 Die Rolle der Medien
- 3.3 Die Polizei als Aggressor
- 4. Spezifische Merkmale und Verhaltensweisen der Hooligansubkultur
- 5. Rechtliche Grundlagen zu diesem Thema
- 5.1 Deutschland
- 5.1.1 Nationales Konzept Sport und Sicherheit
- 5.1.2 Richtlinien des Deutschen Fußballbundes
- 5.1.2.1 Stadionverbote
- 5.1.2.2 Ordnungsdienst
- 5.1.3 Gewalttäter Sport Datei
- 5.2 Österreich
- 5.2.1 Stadionverbote
- 5.2.2 Sicherheitspolizeigesetz
- 5.1 Deutschland
- 6. Sozialarbeit mit Fußballfans und Hooligans in Deutschland
- 6.1 Fanprojekte
- 6.1.1 Geschichte der Fanprojekte
- 6.1.2 Was sind Fanprojekte
- 6.1.3 Ziele der Fanprojekte
- 6.1.4 Arbeitsweise von Fanprojekten
- 6.1.4.1 Freizeitpädagogische Arbeit
- 6.1.4.2 Aufsuchende Arbeit
- 6.1.5 Personelle Ausstattung von Fanprojekten
- 6.1.6 Fanprojekt Berlin
- 6.1 Fanprojekte
- 7. Sozialarbeit mit Fußballfans und Hooligans in Österreich
- 7.1 Geschichte von Streetwork Wien
- 7.1.1 Zielgruppe
- 7.1.2 Streetwork als Methode
- 7.2 Vereine
- 7.2.1 Fankoordinator
- 7.1 Geschichte von Streetwork Wien
- 8. Vergleich Österreich/Deutschland
- 9. Empirischer Teil
- 9.1 Hintergründe, Hypothesen und empirische Herangehensweisen
- 9.1.1 Hypothesen
- 9.1.2 Empirische Herangehensweisen
- 9.1.2.1 Auswahl der InterviewpartnerInnen
- 9.1.2.2 Interviewleitfaden
- 9.2 Forschungsergebnisse
- 9.2.1 Sozialisation/Ausbildung
- 9.2.2 Trinkverhalten
- 9.2.3 Politische Orientierung von gewaltbereiten Fußballfans
- 9.2.4 Auftreten der Polizei im Rahmen eines Fußballspiels
- 9.1 Hintergründe, Hypothesen und empirische Herangehensweisen
- 10. Resümee
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Diplomarbeit untersucht die Subkultur gewaltbereiter männlicher Fußballfans und die Möglichkeiten sozialarbeiterischer Intervention. Ziel ist es, die Ursachen für Gewalt im Fußballkontext zu analysieren und bestehendes sozialarbeiterisches Engagement in Deutschland und Österreich zu beleuchten.
- Gewalt im Fußball und Hooliganismus
- Sozialisation und Einflussfaktoren auf das Verhalten von Fußballfans
- Rolle der Medien und der Polizei
- Analyse bestehender sozialarbeiterischer Ansätze (Fanprojekte, Streetwork)
- Vergleich der Situation in Deutschland und Österreich
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Dieses Kapitel führt in die Thematik der Diplomarbeit ein und beschreibt den persönlichen Hintergrund des Autors, der ihn zu dieser Forschungsarbeit bewogen hat. Es wird die Relevanz des Themas herausgestellt und die Forschungsfragen skizziert, die im weiteren Verlauf der Arbeit beantwortet werden sollen. Die Verbindung des persönlichen Interesses an Fußball und der beruflichen Tätigkeit im Bereich der Sozialarbeit wird deutlich.
2. Begriffserklärungen und Theoretische Grundlagen: Dieses Kapitel liefert die notwendigen theoretischen Grundlagen für die Arbeit. Es definiert zentrale Begriffe wie Subkultur, Gewalt (physisch und strukturell), Hooliganismus und beschreibt die Ausdifferenzierung der Fußballfanszene. Die historischen und soziologischen Hintergründe des Hooliganismus werden beleuchtet, um ein umfassendes Verständnis für die Thematik zu schaffen. Diese Kapitel dient der konzeptionellen Einordnung des Themas.
3. Ursachen für Hooliganismus: Dieses Kapitel befasst sich eingehend mit den Ursachen von Hooliganismus. Es hinterfragt die verschiedenen Gründe für gewalttätiges Verhalten von Fußballfans und analysiert die Rolle der Medien und der Polizei. Die Kapitel erörtert kritische Aspekte, die zu Eskalationen beitragen können und differenziert zwischen individuellen und gesellschaftlichen Faktoren.
4. Spezifische Merkmale und Verhaltensweisen der Hooligansubkultur: In diesem Kapitel werden die spezifischen Merkmale und Verhaltensweisen der Hooligansubkultur untersucht. Die Analyse konzentriert sich auf Aspekte wie Identifikation mit dem Verein, äußere Erscheinung, Ehrenkodex, Solidarität, Anerkennung und den Konsum von Alkohol und Drogen. Das Kapitel zeigt die komplexen sozialen Dynamiken innerhalb der Hooligangruppen auf.
5. Rechtliche Grundlagen zu diesem Thema: Hier werden die rechtlichen Grundlagen in Deutschland und Österreich bezüglich Gewalt im Fußball behandelt. Es wird auf nationale Konzepte, Richtlinien des DFB, Stadionverbote, Ordnungsdienste und Gewalttäter-Datenbanken eingegangen. Der Vergleich der rechtlichen Rahmenbedingungen in beiden Ländern verdeutlicht Unterschiede und Gemeinsamkeiten in der Prävention und Ahndung von Gewalt.
6. Sozialarbeit mit Fußballfans und Hooligans in Deutschland: Dieses Kapitel konzentriert sich auf die Sozialarbeit mit Fußballfans und Hooligans in Deutschland. Es beschreibt die Geschichte und die Arbeitsweise von Fanprojekten, deren Ziele und die verschiedenen Methoden der Sozialarbeit (z.B. Freizeitpädagogische Arbeit, aufsuchende Arbeit). Das Kapitel beleuchtet den erfolgreichen Ansatz von präventiven Maßnahmen.
7. Sozialarbeit mit Fußballfans und Hooligans in Österreich: Ähnlich dem vorherigen Kapitel, konzentriert sich dieser Abschnitt auf die Sozialarbeit in Österreich. Es wird die Geschichte von Streetwork Wien analysiert, sowie die Zielgruppen und Methoden der Streetwork erläutert. Der Fokus liegt auf den Unterschieden und Gemeinsamkeiten der sozialarbeiterischen Ansätze in Österreich im Vergleich zu Deutschland.
8. Vergleich Österreich/Deutschland: Dieses Kapitel vergleicht die Situation der Sozialarbeit mit gewaltbereiten Fußballfans in Deutschland und Österreich. Es werden Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Ansätzen, den rechtlichen Rahmenbedingungen und der Wirksamkeit der Maßnahmen herausgearbeitet. Die vergleichende Perspektive ermöglicht eine umfassendere Bewertung der jeweiligen Strategien.
Schlüsselwörter
Hooliganismus, Fußballgewalt, Sozialarbeit, Fanprojekte, Streetwork, Prävention, Subkultur, Sozialisation, Alkohol, Drogen, Medien, Polizei, Deutschland, Österreich, Gewaltprävention, empirische Forschung.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Diplomarbeit: Gewaltbereite Fußballfans in Deutschland und Österreich
Was ist der Gegenstand dieser Diplomarbeit?
Die Diplomarbeit untersucht die Subkultur gewaltbereiter männlicher Fußballfans und die Möglichkeiten sozialarbeiterischer Intervention in Deutschland und Österreich. Sie analysiert die Ursachen von Gewalt im Fußballkontext und beleuchtet das bestehende sozialarbeiterische Engagement in beiden Ländern.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Gewalt im Fußball und Hooliganismus, Sozialisation und Einflussfaktoren auf das Verhalten von Fußballfans, die Rolle der Medien und der Polizei, bestehenden sozialarbeiterischen Ansätze (Fanprojekte, Streetwork), und einen Vergleich der Situation in Deutschland und Österreich.
Welche theoretischen Grundlagen werden verwendet?
Die Arbeit definiert zentrale Begriffe wie Subkultur, Gewalt (physisch und strukturell), Hooliganismus und beschreibt die Ausdifferenzierung der Fußballfanszene. Die historischen und soziologischen Hintergründe des Hooliganismus werden beleuchtet.
Welche Ursachen für Hooliganismus werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Ursachen für gewalttätiges Verhalten von Fußballfans, analysiert die Rolle der Medien und der Polizei und differenziert zwischen individuellen und gesellschaftlichen Faktoren.
Welche spezifischen Merkmale der Hooligansubkultur werden beschrieben?
Die Arbeit untersucht Aspekte wie Identifikation mit dem Verein, äußere Erscheinung, Ehrenkodex, Solidarität, Anerkennung und den Konsum von Alkohol und Drogen, um die komplexen sozialen Dynamiken innerhalb der Hooligangruppen aufzuzeigen.
Welche rechtlichen Grundlagen werden betrachtet?
Die Arbeit behandelt die rechtlichen Grundlagen in Deutschland und Österreich bezüglich Gewalt im Fußball. Es werden nationale Konzepte, Richtlinien des DFB, Stadionverbote, Ordnungsdienste und Gewalttäter-Datenbanken verglichen.
Wie wird die Sozialarbeit mit Fußballfans und Hooligans in Deutschland dargestellt?
Die Arbeit beschreibt die Geschichte und Arbeitsweise von Fanprojekten in Deutschland, deren Ziele und Methoden der Sozialarbeit (z.B. Freizeitpädagogische Arbeit, aufsuchende Arbeit).
Wie wird die Sozialarbeit mit Fußballfans und Hooligans in Österreich dargestellt?
Die Arbeit analysiert die Geschichte von Streetwork Wien, Zielgruppen und Methoden der Streetwork und vergleicht die sozialarbeiterischen Ansätze mit denen in Deutschland.
Wie werden Deutschland und Österreich verglichen?
Die Arbeit vergleicht die Situation der Sozialarbeit mit gewaltbereiten Fußballfans in Deutschland und Österreich. Gemeinsamkeiten und Unterschiede in den Ansätzen, rechtlichen Rahmenbedingungen und der Wirksamkeit der Maßnahmen werden herausgearbeitet.
Wie sieht der empirische Teil der Arbeit aus?
Der empirische Teil beinhaltet die Beschreibung der Hintergründe, Hypothesen und empirischen Herangehensweisen (z.B. Auswahl der InterviewpartnerInnen, Interviewleitfaden) sowie die Darstellung der Forschungsergebnisse zu Sozialisation/Ausbildung, Trinkverhalten, politischer Orientierung gewaltbereiter Fußballfans und dem Auftreten der Polizei.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Hooliganismus, Fußballgewalt, Sozialarbeit, Fanprojekte, Streetwork, Prävention, Subkultur, Sozialisation, Alkohol, Drogen, Medien, Polizei, Deutschland, Österreich, Gewaltprävention, empirische Forschung.
- Citation du texte
- Mag(FH) Christian Dworzak (Auteur), 2006, Sozialarbeit mit männlichen, gewaltbereiten Fußballfans, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66683