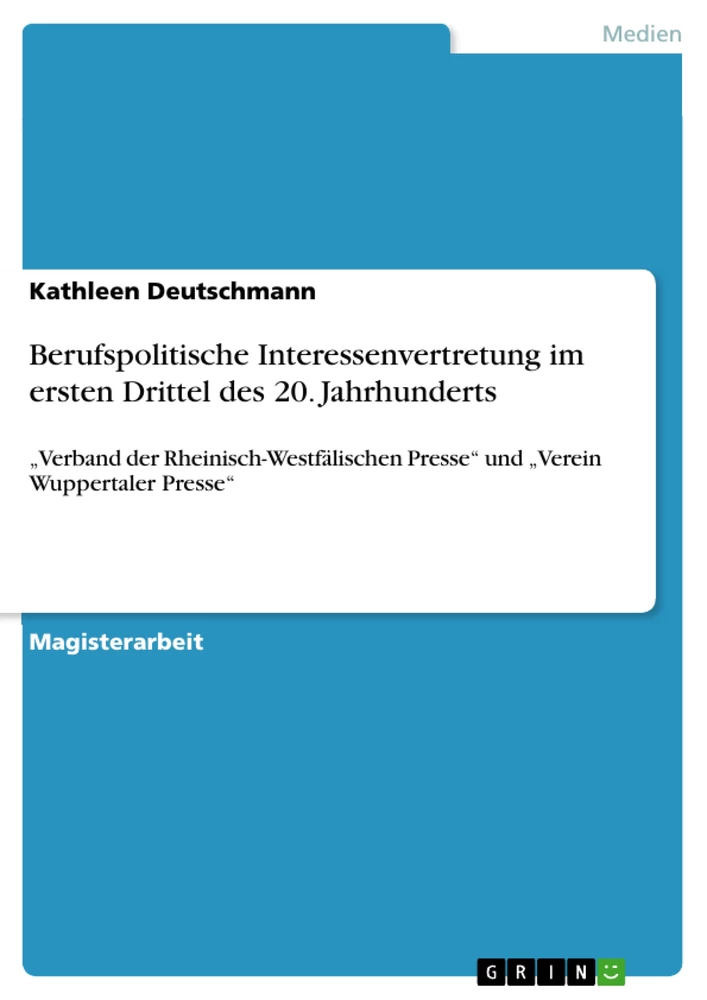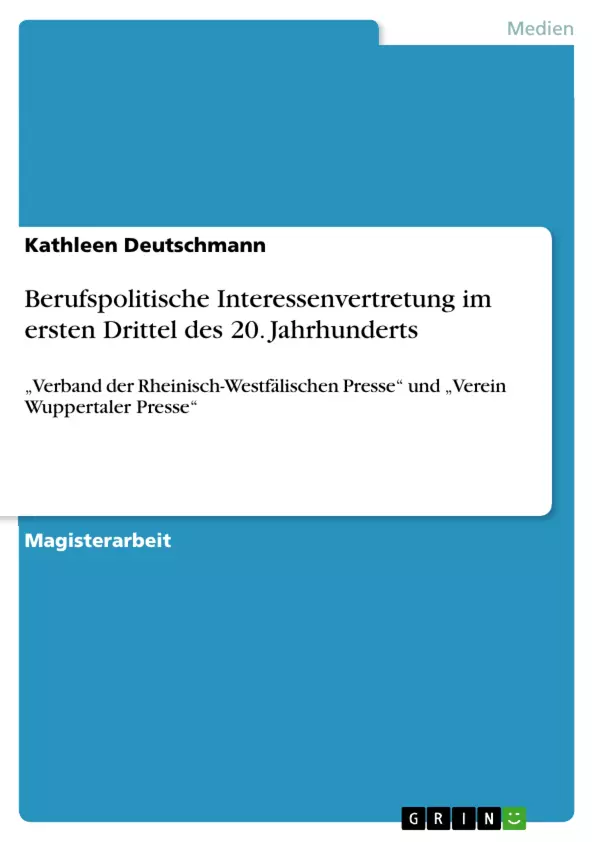Journalismus ist in Deutschland ein freier Beruf mit einem offenen Zugang; eine vorgeschriebene Ausbildung gibt es nicht, dennoch wird eine gute Ausbildung verlangt. Diese Zwangslage ist kein neues Problem, sondern existiert, seit sich der Journalismus im 19. Jahrhundert zur hauptberuflichen Tätigkeit entwickelte. Eine standardisierte wissenschaftliche Ausbildung ist wesentliches Merkmal der Professionalisierung eines Berufes. Darunter ist ganz allgemein der „Prozess der Verfeinerung, Anhebung, Aufwertung einer Berufsposition“ zu verstehen. In dieser Arbeit soll das soziologische Konzept der Professionalisierung als Paradigma für die Untersuchung der Entwicklung des journalistischen Berufs im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts benutzt werden. Das Hauptaugenmerk liegt dabei auf den Berufsvereinigungen des Journalismus, zumal die Gründung solcher Organisationen sowohl Merkmal als auch Antriebsfaktor eines Professionalisierungsprozesses ist. Konkret soll in der vorliegenden Magisterarbeit der Frage nachgegangen werden, welche berufspolitischen Aufgaben (regionalen) Journalistenverbänden im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts zukamen und welchen Beitrag sie damit zur Professionalisierung bzw. Institutionalisierung ihres Berufes geleistet haben.
Inhaltsverzeichnis
- Einführung
- Ausgangssituation und Problemstellung der Arbeit
- Forschungsstand
- Forschungszusammenhänge
- Kommunikationsgeschichte
- Professionalisierungsforschung
- Verbandsforschung
- Funktionen von Berufsverbänden
- Erkenntnisinteresse
- Herangehensweise: Quellen und Methoden
- Journalisten im 19. und beginnenden 20. Jahrhundert
- Entstehung der Massenpresse
- Ausdifferenzierung des Journalistenberufes und seiner Merkmale
- Stellung im Zeitungsbetrieb
- Sozioökonomische Lage
- Bildungsstand
- Arbeitsrechtliche Stellung
- Selbstverständnis und Ansehen des Standes
- Organisationen der Journalisten und Verleger
- Entwicklung und Probleme journalistischer Berufsorganisationen
- „Reichsverband der deutschen Presse“
- „Verein Deutscher Zeitungs-Verleger“ und „Arbeitgeberverband für das deutsche Zeitungsgewerbe“
- Das ungelöste Problem der Journalistenausbildung
- Auswertung der Quellen
- Aussagewert benutzter und potenzieller Quellen
- „Verband der Rheinisch-Westfälischen Presse“ und „Verein Wuppertaler Presse“
- Konkrete Ergebnisse der Quellenauswertung
- Sozialpolitische Forderungen
- Rechtliches
- Professionalisierung
- Standesbewusstsein
- Berufsethik
- Ausbildung
- Kontrolle des Berufszugangs
- Normen der Berufsausübung
- Gesellschaftlicher Status
- Autonomie
- Schutz der Berufsinteressen
- Verbandsleben und organisatorische Probleme
- Beziehungen zum Reichsverband
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht die berufspolitischen Aufgaben von regionalen Journalistenverbänden im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts am Beispiel des „Verbandes der Rheinisch-Westfälischen Presse“ und des „Vereins Wuppertaler Presse“. Sie zielt darauf ab, den Beitrag dieser Verbände zur Professionalisierung und Institutionalisierung des Journalismus in dieser Epoche zu beleuchten.
- Entwicklung des Journalismus im 19. und 20. Jahrhundert
- Professionalisierung des Journalismus und die Rolle von Berufsvereinigungen
- Berufspolitische Aufgaben von regionalen Journalistenverbänden
- Die Bedeutung von Ausbildung und Standesbewusstsein für die Professionalisierung
- Der Einfluss von Berufsverbänden auf den gesellschaftlichen Status des Journalismus
Zusammenfassung der Kapitel
Die Arbeit beginnt mit einer Einführung in die Problemstellung und erläutert den Forschungsstand zur Professionalisierung des Journalismus sowie die Funktionen von Berufsverbänden. Sie beschreibt anschließend die Entstehung und Entwicklung des Journalismus im 19. und frühen 20. Jahrhundert, wobei sie die sozioökonomische Lage, den Bildungsstand und die Arbeitsbedingungen von Journalisten beleuchtet. Im Anschluss untersucht die Arbeit die Entwicklung und Struktur von journalistischen Berufsorganisationen, insbesondere die „Reichsverband der deutschen Presse“ und den „Verein Deutscher Zeitungs-Verleger“, und diskutiert das Problem der Journalistenausbildung. Der Fokus der Arbeit liegt dann auf der Analyse des „Verbandes der Rheinisch-Westfälischen Presse“ und des „Vereins Wuppertaler Presse“. Dabei werden die Sozialpolitischen Forderungen, die rechtlichen Aspekte, die Herausforderungen bei der Professionalisierung und das Verbandsleben analysiert. Die Arbeit untersucht auch die Beziehungen dieser Verbände zum „Reichsverband der deutschen Presse“.
Schlüsselwörter
Journalismus, Professionalisierung, Berufsverbände, Standesbewusstsein, Ausbildung, Journalisten, Verleger, „Verband der Rheinisch-Westfälischen Presse“, „Verein Wuppertaler Presse“, Reichsverband der deutschen Presse, 20. Jahrhundert, Deutschland
Häufig gestellte Fragen
Wie entwickelte sich der Journalistenberuf im frühen 20. Jahrhundert?
Der Beruf wandelte sich von einer freien Tätigkeit zu einem professionalisierten Stand mit eigenen Verbänden, ethischen Normen und dem Streben nach Ausbildungskriterien.
Welche Rolle spielten regionale Journalistenverbände?
Sie vertraten sozialpolitische Forderungen, förderten das Standesbewusstsein und setzten sich für den Schutz der Berufsinteressen gegenüber Verlegern ein.
Was bedeutet "Professionalisierung" im Journalismus?
Darunter versteht man die Aufwertung der Berufsposition durch standardisierte Ausbildung, Kontrolle des Berufszugangs und die Etablierung einer Berufsethik.
Welche Verbände werden in der Arbeit untersucht?
Im Fokus stehen der „Verband der Rheinisch-Westfälischen Presse“, der „Verein Wuppertaler Presse“ sowie der „Reichsverband der deutschen Presse“.
War die Journalistenausbildung damals bereits geregelt?
Nein, die Ausbildung blieb im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts ein ungelöstes Problem, obwohl eine standardisierte Qualifikation als wesentliches Merkmal des Standes gefordert wurde.
- Citation du texte
- M.A. Kathleen Deutschmann (Auteur), 2006, Berufspolitische Interessenvertretung im ersten Drittel des 20. Jahrhunderts, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66705