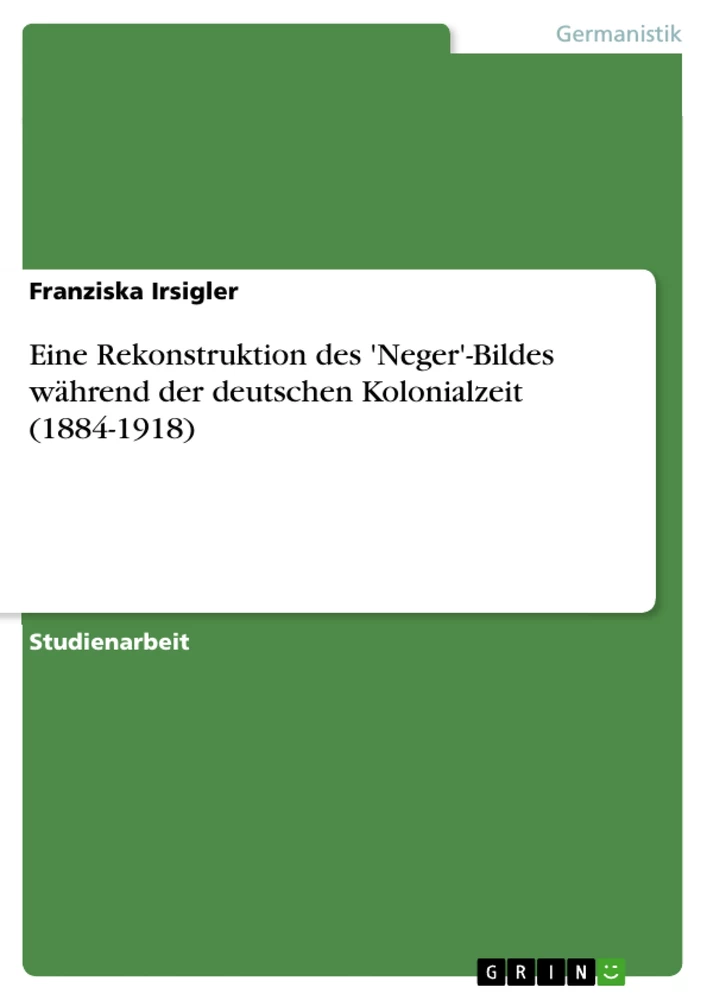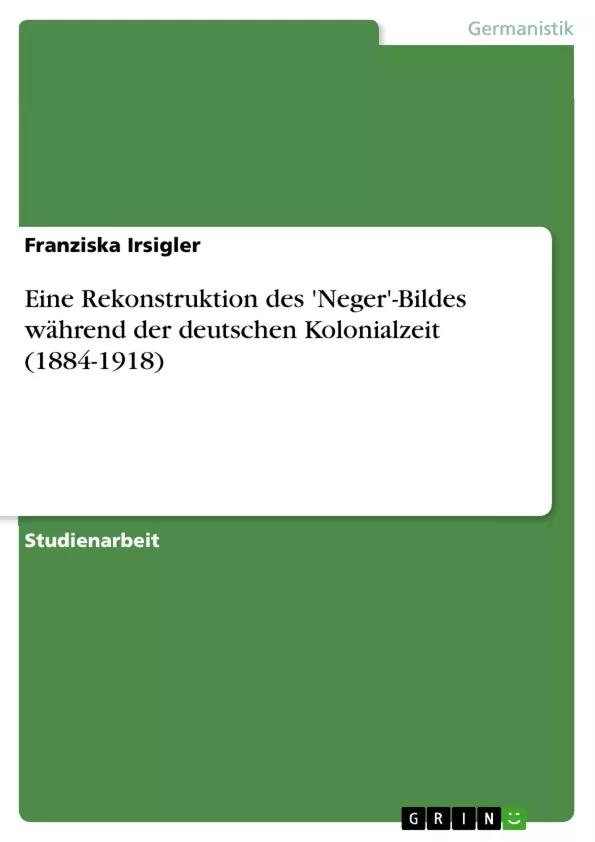In der heutigen Gegenwart existieren noch immer Vorurteile, Stereotype und Wertbilder von 'Negern', (oder als Intensivum: von 'Niggern') – obgleich der Begriff an sich veraltet ist. Woher stammen diese Klischees? Und warum verbinden wir – unfreiwillig oder freiwillig – diskriminierende und beleidigende Begriffe mit dunkelhäutigen Menschen?
Um diesen Fragen nachzugehen, beschäftigte sich die Autorin mit der deutschen Kolonialzeit (1884-1918) – jenen 40 Jahren deutscher Geschichte, als der Kontakt zwischen Afrikanern und Deutschen intensiver und eindringlicher war, als er in den Jahrhunderten davor und auch in den Jahrzehnten danach je möglich war.
Das Thema dieser Arbeit soll somit eine Rekonstruktion des 'Neger'-Bildes während der deutschen Kolonialzeit darstellen. Diese Aufgabe basiert auf der These, dass die Bezeichnungen und Zuschreibungen dunkelhäutiger Menschen – welche ja bereits vor dieser Zeit in mannigfaltiger Form existierten, sich durch den vermehrten Kontakt zwischen Deutschen und Afrikanern und die Beschäftigung der Deutschen mit den Afrikanern in den unterschiedlichsten Formen zum einen festigten, zum anderen veränderten. So wurden verschiedene Zuschreibungen, Klischees und Vorurteile, welche über die Jahrhunderte entstanden, durch die in dieser Zeit neu entstehende Rassenkunde erneut aufgerufen oder 'wissenschaftlich' belegt.
Diese Rekonstruktion speist sich aus folgenden Quellen: Zum einen wird sozialhistorisch untersucht, durch welche Quellen, geschichtliche Ereignisse und Einstellungen die Zu- und Beschreibungen des Negers entstanden sind. Die Adjektive und Synonyme werden dann onomasiologisch und semantisch analysiert.
Dann werden die verschiedenen Zuschreibunge hinsichtlich ihres Ursprungs, Bestands und Wandels untersucht.
Es liegt auf der Hand, Quellen für diese Untersuchung in der Rassenkunde zu suchen.Joseph Arthur Comte de Gobineauwird dabei besonders intensiv betrachtet, da er die Zivilisations- und Kulturunfähigkeit der 'Neger' besonders hervorhob und sich somit von anderen Rassenkundlern unterschied.
Schließlich folgt noch ein Exkurs über die Zuschreibungen der 'Negerin', entwickelt anhand von Quellen der Bildenden Kunst. Diese nichtlinguistische Untersuchung soll die zuvor entwickelten Ergebnisse aus einem anderen Sichtwinkel bestätigen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- a) Zur Zugangsmethode
- b) Zum Forschungsstand
- 2. Geschichtliche Grundlagen: Der deutsche Kolonialismus
- 3. Die Grundlagen der Diskriminierung
- 4. Sprache als Herrschaftsmittel – Bezeichnungen des Negers
- 5. Die Rassenforschung – Zuschreibungen des Negers
- a) Joseph Arthur Comte de Gobineau
- b) Geistige Merkmale
- c) Körperliche Merkmale
- d) Zivilisation und Kultur
- e) Textverlaufsanalyse: De Gobineaus Theoriebekräftigung und seine Abgrenzungsbereiche
- 6. Wandlungen und Veränderungen während und durch die deutsche Kolonialzeit
- 7. Exkurs: Die Negerin
- 8. Schlussbetrachtung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit rekonstruiert das "Neger"-Bild während der deutschen Kolonialzeit (1884-1918). Die Arbeit untersucht, wie der vermehrte Kontakt zwischen Deutschen und Afrikanern bestehende Vorurteile festigte und veränderte, und wie die damalige Rassenkunde diese beeinflusste. Der Fokus liegt auf der Analyse von Bezeichnungen und Zuschreibungen, ihrer Entstehung, ihrem Wandel und ihrer Fortwirkung bis in die Gegenwart.
- Entwicklung und Wandel des "Neger"-Bildes während der deutschen Kolonialzeit
- Analyse von Bezeichnungen und Synonymen für "Neger" unter onomasiologischen und semantischen Aspekten
- Einfluss der Rassenforschung auf die Konstruktion des "Neger"-Bildes
- Rolle der Sprache als Herrschaftsmittel im Kontext des Kolonialismus
- Untersuchung der Zuschreibungen an "Negerinnen" im Kontext bildender Kunst
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema ein und beschreibt die Forschungsfrage: Woher stammen die Klischees über "Neger", und warum sind diese bis heute präsent? Die Autorin benennt die deutsche Kolonialzeit als zentralen Untersuchungszeitraum und legt ihre methodische Vorgehensweise dar. Es wird eine sozialhistorische Untersuchung mit onomasiologischer und semantischer Analyse der Bezeichnungen und Zuschreibungen angekündigt. Die Rassenforschung, insbesondere die Theorien von Gobineau, und die Darstellung von "Negerinnen" in der bildenden Kunst werden als wichtige Quellen genannt. Die methodische Herangehensweise wird durch die Verwendung des Frege'schen Beispiels von Abendstern und Morgenstern verdeutlicht, um die Differenzierung von Wort, Begriff, Bedeutung und Sache zu erklären. Der Forschungsstand wird kurz umrissen, wobei die fehlende direkte Auseinandersetzung mit dem "Negerbild" während der deutschen Kolonialzeit hervorgehoben wird.
2. Geschichtliche Grundlagen: Der deutsche Kolonialismus: Dieses Kapitel beschreibt den deutschen Kolonialismus von 1884 bis 1918. Es thematisiert die Berliner Kongokonferenz und den Erwerb der deutschen Kolonien in Afrika und dem Pazifik. Der Fokus liegt auf der offiziellen Begründung der Kolonisierung mit dem Schutz der "Neger" vor Sklaverei und deren "Verfleißigung", welche in Realität die Unterdrückung der afrikanischen Bevölkerung durch Steuern und Strafmaßnahmen bedeutete. Das Kapitel endet mit dem Verlust der deutschen Kolonien nach dem Ersten Weltkrieg.
3. Die Grundlagen der Diskriminierung: Dieses Kapitel behandelt den Wandel des Bildes des Afrikaners im Laufe der Geschichte. Es legt den Grundstein für das Verständnis, dass viele heutige Stereotype über Afrikaner ihren Ursprung in vergangenen Epochen haben und der Kontext der deutschen Kolonialzeit hier eingeordnet werden muss.
4. Sprache als Herrschaftsmittel – Bezeichnungen des Negers: Dieses Kapitel analysiert die sprachliche Konstruktion des „Neger“-Bildes. Es untersucht die verschiedenen Bezeichnungen und Synonyme, die während der Kolonialzeit verwendet wurden, und analysiert deren semantische und onomasiologische Aspekte. Der Fokus liegt darauf, wie Sprache zur Konstruktion und Reproduktion von Vorurteilen und Diskriminierung eingesetzt wurde.
5. Die Rassenforschung – Zuschreibungen des Negers: Dieses Kapitel widmet sich der Rassenforschung und ihren Auswirkungen auf das "Neger"-Bild. Es analysiert die rassistischen Theorien von Joseph Arthur Comte de Gobineau, seinen Einfluss auf die Zuschreibung geistiger, körperlicher und kultureller Merkmale an "Neger", und ordnet diese in eine rassistische Hierarchie ein. Eine Textverlaufsanalyse von Gobineaus Schriften verdeutlicht die Argumentationsstruktur und die Abgrenzungsstrategien seiner Theorie.
6. Wandlungen und Veränderungen während und durch die deutsche Kolonialzeit: Dieses Kapitel untersucht die Veränderungen im „Neger“-Bild während der Kolonialzeit, inwiefern sich die Zuschreibungen unter dem Einfluss des direkten Kontakts und der Rassenforschung verändert haben, und wie sich die schon existierenden Stereotypen gefestigt oder transformiert haben.
7. Exkurs: Die Negerin: Dieser Exkurs betrachtet die Darstellung von "Negerinnen" aus der Perspektive der bildenden Kunst. Die visuelle Darstellung soll die Ergebnisse der linguistischen Analyse ergänzen und aus einer anderen Perspektive beleuchten.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Hausarbeit: Das "Neger"-Bild während der deutschen Kolonialzeit
Was ist das Thema der Hausarbeit?
Die Hausarbeit untersucht das "Neger"-Bild während der deutschen Kolonialzeit (1884-1918). Sie analysiert, wie der Kontakt zwischen Deutschen und Afrikanern bestehende Vorurteile beeinflusste und wie die damalige Rassenkunde diese prägte. Der Fokus liegt auf der Analyse von Bezeichnungen und Zuschreibungen, ihrer Entstehung, ihrem Wandel und ihrer Fortwirkung bis in die Gegenwart.
Welche Forschungsfragen werden behandelt?
Die zentrale Forschungsfrage lautet: Woher stammen die Klischees über "Neger", und warum sind diese bis heute präsent? Die Arbeit untersucht die Entwicklung und den Wandel des "Neger"-Bildes während der Kolonialzeit, analysiert Bezeichnungen und Synonyme unter onomasiologischen und semantischen Aspekten, untersucht den Einfluss der Rassenforschung und die Rolle der Sprache als Herrschaftsmittel im Kontext des Kolonialismus. Zusätzlich wird die Darstellung von "Negerinnen" in der bildenden Kunst analysiert.
Welche Methoden werden angewendet?
Die Arbeit verwendet eine sozialhistorische Untersuchungsmethode in Kombination mit einer onomasiologischen und semantischen Analyse der Bezeichnungen und Zuschreibungen. Die Rassenforschung, insbesondere die Theorien von Gobineau, und die Darstellung von "Negerinnen" in der bildenden Kunst dienen als wichtige Quellen. Die methodische Herangehensweise wird durch die Verwendung des Frege'schen Beispiels von Abendstern und Morgenstern verdeutlicht, um die Differenzierung von Wort, Begriff, Bedeutung und Sache zu erklären.
Welche Kapitel umfasst die Hausarbeit?
Die Hausarbeit gliedert sich in folgende Kapitel: Einleitung, Geschichtliche Grundlagen: Der deutsche Kolonialismus, Die Grundlagen der Diskriminierung, Sprache als Herrschaftsmittel – Bezeichnungen des Negers, Die Rassenforschung – Zuschreibungen des Negers, Wandlungen und Veränderungen während und durch die deutsche Kolonialzeit, Exkurs: Die Negerin, und Schlussbetrachtung. Die Einleitung beschreibt die Forschungsfrage und die methodische Vorgehensweise. Die Kapitel 2-6 analysieren verschiedene Aspekte des "Neger"-Bildes, während Kapitel 7 einen Exkurs zu "Negerinnen" in der bildenden Kunst bietet.
Welche Rolle spielt die Rassenforschung?
Die Rassenforschung, insbesondere die Theorien von Joseph Arthur Comte de Gobineau, spielt eine zentrale Rolle in der Hausarbeit. Die Arbeit analysiert Gobineaus rassistische Theorien und ihren Einfluss auf die Zuschreibung geistiger, körperlicher und kultureller Merkmale an "Neger" und ordnet diese in eine rassistische Hierarchie ein. Eine Textverlaufsanalyse von Gobineaus Schriften verdeutlicht die Argumentationsstruktur und die Abgrenzungsstrategien seiner Theorie.
Wie wird Sprache als Herrschaftsmittel dargestellt?
Die Hausarbeit analysiert, wie Sprache während der Kolonialzeit zur Konstruktion und Reproduktion von Vorurteilen und Diskriminierung eingesetzt wurde. Es werden verschiedene Bezeichnungen und Synonyme für "Neger" untersucht und deren semantische und onomasiologische Aspekte analysiert.
Was ist der Fokus des Exkurses "Die Negerin"?
Der Exkurs betrachtet die Darstellung von "Negerinnen" aus der Perspektive der bildenden Kunst. Die visuelle Darstellung soll die Ergebnisse der linguistischen Analyse ergänzen und aus einer anderen Perspektive beleuchten.
Welche Bedeutung hat der deutsche Kolonialismus für die Hausarbeit?
Der deutsche Kolonialismus (1884-1918) bildet den zentralen Untersuchungszeitraum der Hausarbeit. Die Arbeit untersucht, wie die Kolonialzeit das "Neger"-Bild prägte und beeinflusste, sowohl durch den direkten Kontakt zwischen Deutschen und Afrikanern als auch durch die damalige Rassenforschung.
Welche Quellen werden verwendet?
Die Hausarbeit nutzt verschiedene Quellen, darunter Schriften der Rassenforschung (z.B. Gobineau), bildende Kunst und sprachliche Analysen von Bezeichnungen und Synonymen für "Neger".
- Quote paper
- Franziska Irsigler (Author), 2006, Eine Rekonstruktion des 'Neger'-Bildes während der deutschen Kolonialzeit (1884-1918), Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66723