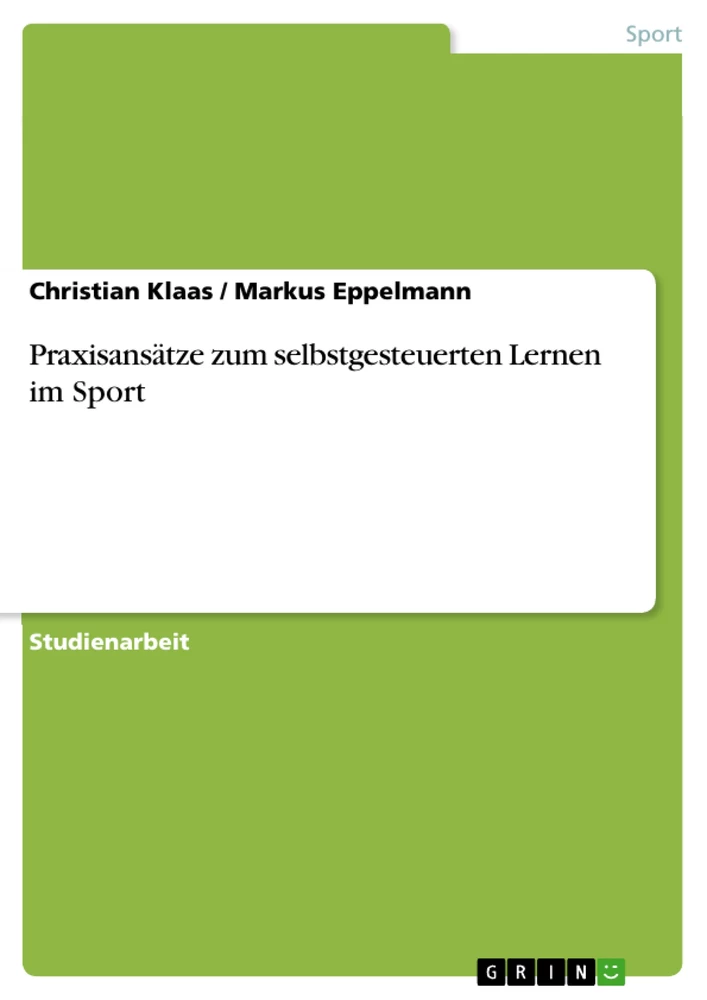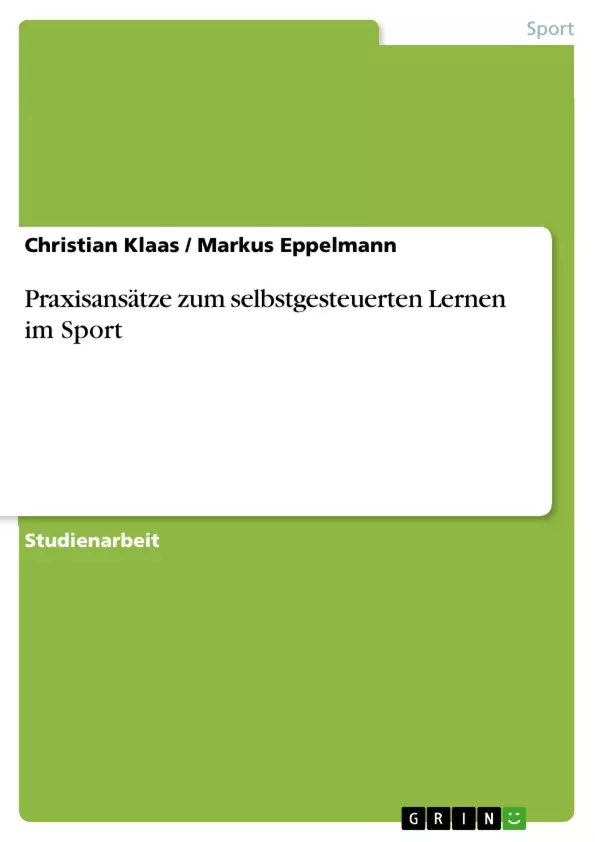In diesem Seminar wird das selbstgesteuerte Bewegungslernen inhaltlich vertieft erschlossen, wobei dieses Referat, im Rahmen der Bewegungswissenschaft, die Praxisansätze zum selbstgesteuerten Lernen im Sport aufzeigen wird. Dabei wird die Praxis (des selbstgesteuerten Bewegungslernens) im Spannungsfeld von Bewegungswissenschaft und Sportpädagogik beleuchtet.
Auch wenn sich beide sportwissenschaftlichen Teildisziplinen der Praxis widmen, wird diese jedoch durch die Sportpädagogik dominiert.
Die Begründung ist darin zu sehen, dass die Bewegungswissenschaft sich vorwiegend der Entwicklung der motorischen Leistung zuwendet und sich dabei fast ausschließlich auf Einzelaspekte konzentriert, was zur Folge hat dass die Praxis in stark verkürzter Sichtweise betrachtet wird (vgl. Bund S. 44f).
Die in der Bewegungswissenschaft verkürzte Sichtweise ist in der sportpädagogischen Praxis aufgehoben, wenn sie dem Sportunterricht eine erzieherische Funktion zuspricht. Diese berücksichtigt nach Bund (2004, S. 44) über die motorische Leistung hinausgehend auch emotional-motivationale Aspekte sowie:
•Förderung von Selbständigkeit
•und Eigenverantwortlichkeit,
•sowie die Entwicklung sozialer Kompetenz.
Sie sehen den Auftrag des Sportunterrichts darin, Schüler zu einer sportlich aktiven und gesundheitsorientierten Lebensführung zu motivieren (vgl. Bund 2004, S.44). Wir wollen im Folgenden die Praxis weniger aus Sicht der Bewegungswissenschaft, als aus der sportpädagogischen Perspektive betrachten.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung - Bewegungswissenschaft vs. Sportpädagogik?
- Transfer des selbstgesteuerten Bewegungslernens in die Praxis
- Konzeptioneller Vergleich - fremdgesteuert vs. selbstgesteuert
- Wie soll offener Unterricht aussehen?
- Offener Unterricht - ein Beispiel
- Offener Unterricht - das Maß aller Dinge?
- Integration von offenem und geschlossenem Unterrichtskonzept – das Konzept von Proẞnigg
- Unterrichtsstart
- Prozessbegleitung während der Lösungsfindung
- Präsentation der Lösungen
- Reflexion und Angebot situativer Lernziele
- Überführung in den geschlossenen Lernweg
- Zusammenfassung und Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Dieses Seminar befasst sich mit dem selbstgesteuerten Bewegungslernen, insbesondere mit dessen praktischen Anwendung im Sport. Es beleuchtet dabei die Beziehung zwischen Bewegungswissenschaft und Sportpädagogik und zeigt auf, wie selbstgesteuertes Lernen in der Sportpädagogik umgesetzt werden kann.
- Das Spannungsfeld von Bewegungswissenschaft und Sportpädagogik
- Die Praxisansätze zum selbstgesteuerten Lernen im Sport
- Die verschiedenen Unterrichtskonzepte, die selbstgesteuertes Bewegungslernen ermöglichen
- Der konzeptionelle Vergleich von fremdgesteuertem und selbstgesteuertem Lernen
- Die Integration von offenem und geschlossenem Unterrichtskonzept
Zusammenfassung der Kapitel
- Einleitung - Bewegungswissenschaft vs. Sportpädagogik?: Dieses Kapitel stellt den Fokus des Seminars auf das selbstgesteuerte Bewegungslernen dar, insbesondere im Kontext der Sportpädagogik. Es wird die Beziehung zwischen den beiden sportwissenschaftlichen Disziplinen Bewegungswissenschaft und Sportpädagogik beleuchtet, wobei die Praxisorientierung der Sportpädagogik hervorgehoben wird.
- Transfer des selbstgesteuerten Bewegungslernens in die Praxis: Dieses Kapitel beleuchtet die Anforderungen an einen Unterricht, der das selbstgesteuerte Bewegungslernen berücksichtigt. Dabei werden die Eigenschaften eines selbstbestimmten Lerners und die verschiedenen Bezugspunkte der Selbstbestimmung im Unterricht, wie z.B. Lernzielbestimmung, Lernorganisation und Lernerfolgskontrolle, dargestellt.
- Konzeptioneller Vergleich – fremdgesteuert vs. selbstgesteuert: Dieses Kapitel vergleicht die beiden Unterrichtskonzepte des fremdgesteuerten und selbstgesteuerten Lernens. Es wird die Geschichte und Einordnung der beiden Konzepte beleuchtet und die Unterschiede im Hinblick auf die Ziele, Methoden und Kontrollen des Unterrichts sowie die Art und Weise der Schülerbeteiligung dargestellt.
- Wie soll offener Unterricht aussehen?: In diesem Kapitel werden die Merkmale und Vorteile von offenem Unterricht beschrieben, der als eine Möglichkeit zur Umsetzung des selbstgesteuerten Lernens im Sport angesehen wird. Dabei werden die Aspekte der Individualisierung, der methodischen Differenzierung und der Schülerpartizipation hervorgehoben.
Schlüsselwörter
Die zentralen Begriffe und Themen des Seminars sind selbstgesteuertes Bewegungslernen, Sportpädagogik, Bewegungswissenschaft, Unterrichtskonzepte, offener Unterricht, fremdgesteuerter Unterricht, genetisches Lehren, Schülerpartizipation, Individualisierung, methodische Differenzierung, Lernerfolgskontrolle.
Häufig gestellte Fragen
Was ist selbstgesteuertes Bewegungslernen im Sport?
Es ist ein Lernansatz, bei dem Schüler oder Sportler den Lernprozess (Ziele, Methoden, Erfolgskontrolle) weitgehend selbst organisieren und Verantwortung für ihren Fortschritt übernehmen.
Worin unterscheiden sich Bewegungswissenschaft und Sportpädagogik?
Die Bewegungswissenschaft fokussiert oft auf motorische Einzelleistungen, während die Sportpädagogik den ganzen Menschen betrachtet und Ziele wie Selbstständigkeit und soziale Kompetenz verfolgt.
Was kennzeichnet "offenen Unterricht" im Sport?
Offener Unterricht bietet Raum für Individualisierung, methodische Differenzierung und Schülerpartizipation. Die Lehrkraft fungiert eher als Prozessbegleiter denn als strenger Instrukteur.
Was ist das Konzept von Proßnigg?
Es ist ein integratives Konzept, das offene und geschlossene Unterrichtsphasen verbindet: von der freien Lösungsfindung über die Präsentation bis hin zur Reflexion und gezielten Lernzielvorgabe.
Welches Ziel verfolgt die Sportpädagogik primär?
Sie soll Schüler zu einer sportlich aktiven und gesundheitsorientierten Lebensführung motivieren und dabei Eigenverantwortlichkeit fördern.
- Citation du texte
- Christian Klaas (Auteur), Markus Eppelmann (Auteur), 2006, Praxisansätze zum selbstgesteuerten Lernen im Sport, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66750