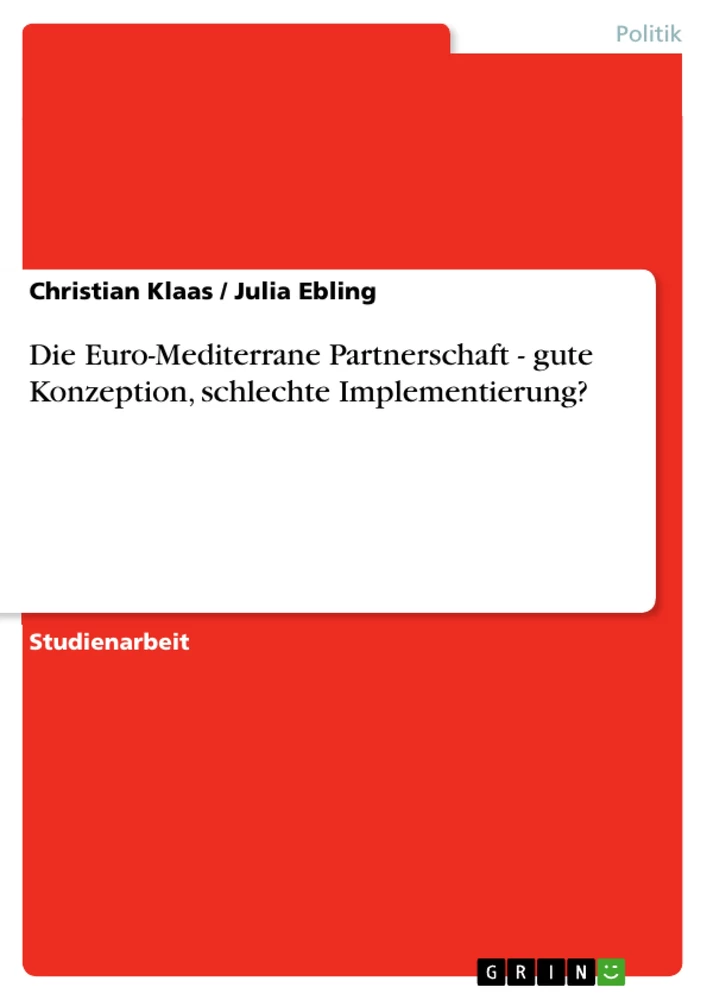Während die europäischen Außenbeziehungen zu den Mittelmeer-Drittländern (MDL) bis Mitte der 90er Jahre stets im Schatten der oft historisch gewachsenen und vorwiegend ökonomisch motivierten bilateralen Beziehungen einiger Mitgliedsstaaten standen, änderte sich dies mit Begründung der Euro-Mediterranen Partnerschaft (EMP) 1995 in Barcelona schlagartig. Eine Neugestaltung der EU-Mittelmeerpolitik war aufgrund der als bedrohlich wahrgenommenen Destabilisierung des südlichen Mittelmeerraums, die sich u.a. in der Ausbreitung militant-islamistischer Bewegungen, sowie der Zunahme von Drogenhandel, organisierter Kriminalität und internationalem Terrorismus offenbarte, nach dem Ende des Ost-West-Konflikts notwendig geworden (Jünemann 2000:65). Die EMP bot hierzu einen Lösungsansatz, der statt auf Konfrontation auf partnerschaftliche Kooperation setzte. In ihr wurden drei eng miteinander verwobene Körbe verankert, eine Politische und Sicherheitspartnerschaft (Korb 1), eine Wirtschafts- und Finanzpartnerschaft (Korb 2), die im wesentlichen die Errichtung einer Freihandelszone bis 2010 vorsah und eine Partnerschaft im sozialen, kulturellen und menschlichen Bereich (Korb 3) (Philippart 2003:201). Als normative Ziele aller drei Körbe galten die Demokratisierung und Stabilisierung der gesamten Region.
Den substanziellen Kern der EMP bilden die pluri-bilateralen Euro-Med-Assoziationsabkommen, die zwischen der europäischen Union und ihren Mitgliedsstaaten auf der einen und jeweils einem MDL auf der anderen Seite abgeschlossen werden und die zusammengenommen bis 2010 besagte euro-mediterrane Freihandelszone begründen sollen. Finanziert wird die EMP über das MEDA-Programm, dessen Budget unter den MDL aufgeteilt wird. Von besonderer Bedeutung ist dabei die politische Konditionalisierung, die in Form einer Suspensionsklausel in den Assoziationsabkommen enthalten ist und die Summe der jedem MDL zugeteilten MEDA-Mittel unter anderem von den Fortschritten im politischen Reformprozess abhängig machen kann. Bei groben Verstößen gegen die demokratischen Spielregeln oder bei schwerwiegenden Menschenrechtsverletzungen kann die Union auf diese Weise die MEDA-Mittel für den betreffenden Staat verringern oder sogar komplett aussetzen (Jünemann 2001:43).
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Implementierungshürden von Seiten der EU
- Divergierende Interessen der EU-Akteure
- Institutionelle und verfahrensmäßige Probleme
- Externer Faktor: Der Konfliktherd ,,Naher Osten"
- Die Nahostpolitik der EU
- Die EU und die Palästinensische Autonomiebehörde (PA)
- Die EMP und der Nahostkonflikt
- Die Nahostpolitik der EU
- Die Implementierung und Wirkung der EMP im ,,Musterland" Marokko
- Die politische Entwicklung
- Regionale Konflikte
- Defizit: Marokko = parlamentarische Demokratie?
- Die wirtschaftliche Entwicklung
- Defizit: Wirtschaftliche Liberalisierung = Bekämpfung der Armut?
- Die sozio-kulturelle Entwicklung
- Defizit: Marokko = ein sozio-kulturelles Pulverfass?
- Die politische Entwicklung
- Résumé
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit analysiert die Euro-Mediterrane Partnerschaft (EMP) und hinterfragt die Diskrepanz zwischen ihrer guten Konzeption und ihrer schlechten Implementierung. Sie untersucht die Ursachen für dieses Scheitern der Umsetzung, indem sie sowohl EU-interne Implementierungshürden als auch den Einfluss des Nahostkonflikts und MDL-bedingte Hürden am Beispiel Marokkos beleuchtet.
- Divergierende Interessen der EU-Akteure und ihre Auswirkungen auf die EMP-Implementierung
- Institutionelle und verfahrensmäßige Probleme im EU-Mehrebenensystem, die die EMP-Umsetzung erschweren
- Der Einfluss des Nahostkonflikts auf die EMP und die Herausforderungen, die er für die Partnerschaft mit sich bringt
- Die Implementierung der EMP in Marokko und die Analyse der Herausforderungen in den Bereichen Politik, Wirtschaft und Soziokultur
- Die Diskrepanz zwischen den normativen Zielen der EMP und der realen Situation in den Mittelmeerländern
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die EMP als Reaktion auf die Destabilisierung des südlichen Mittelmeerraums vor und erläutert die drei Säulen der Partnerschaft: Politische und Sicherheitspartnerschaft (Korb 1), Wirtschafts- und Finanzpartnerschaft (Korb 2) und Partnerschaft im sozialen, kulturellen und menschlichen Bereich (Korb 3). Sie hebt die politische Konditionalisierung und das MEDA-Programm als zentrale Elemente der EMP hervor.
Kapitel 2 beleuchtet die Implementierungshürden von Seiten der EU, indem es die divergierenden Interessen der EU-Akteure und die institutionellen und verfahrensmäßigen Probleme im EU-Mehrebenensystem analysiert.
Kapitel 3 untersucht den Einfluss des Nahostkonflikts auf die EMP-Implementierung und beleuchtet die Nahostpolitik der EU, insbesondere im Hinblick auf die Palästinensische Autonomiebehörde.
Kapitel 4 analysiert die Implementierung und Wirkung der EMP im „Musterland“ Marokko. Es untersucht die politische, wirtschaftliche und sozio-kulturelle Entwicklung und zeigt die Defizite auf, die trotz der weit entwickelten Implementierung in Marokko bestehen.
Schlüsselwörter
Euro-Mediterrane Partnerschaft (EMP), Implementierung, Mittelmeerländer, EU-Akteure, Nahostkonflikt, Marokko, politische Konditionalisierung, MEDA-Programm, Demokratie, Menschenrechte, Wirtschaft, Politik, Soziokultur, Freihandelszone, Partnerschaft, Dominanz, Interessenkonflikte, Destabilisierung, Stabilität.
Häufig gestellte Fragen
Was ist die Euro-Mediterrane Partnerschaft (EMP)?
Die EMP, begründet 1995 in Barcelona, ist ein Kooperationsrahmen zwischen der EU und Mittelmeer-Drittländern (MDL), der auf Stabilität, Demokratisierung und wirtschaftliche Zusammenarbeit abzielt.
Welche Ziele verfolgen die drei Säulen (Körbe) der EMP?
Die drei Körbe umfassen: 1. Eine Politische und Sicherheitspartnerschaft, 2. Eine Wirtschafts- und Finanzpartneschaft (Freihandelszone) und 3. Eine Partnerschaft im sozialen, kulturellen und menschlichen Bereich.
Was ist das MEDA-Programm?
MEDA ist das zentrale Finanzierungsinstrument der EMP, über das Mittel an die Mittelmeer-Drittländer verteilt werden, oft gekoppelt an politische Reformfortschritte.
Warum gilt die Implementierung der EMP oft als mangelhaft?
Hürden sind divergierende Interessen der EU-Mitgliedsstaaten, institutionelle Probleme im EU-Mehrebenensystem sowie externe Faktoren wie der ungelöste Nahostkonflikt.
Welche Rolle spielt Marokko in der EMP?
Marokko gilt als „Musterland“ der Implementierung, zeigt jedoch trotz Fortschritten weiterhin Defizite in den Bereichen parlamentarische Demokratie, Armutsbekämpfung und sozio-kulturelle Stabilität.
- Citation du texte
- Christian Klaas (Auteur), Julia Ebling (Auteur), 2004, Die Euro-Mediterrane Partnerschaft - gute Konzeption, schlechte Implementierung? , Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66752