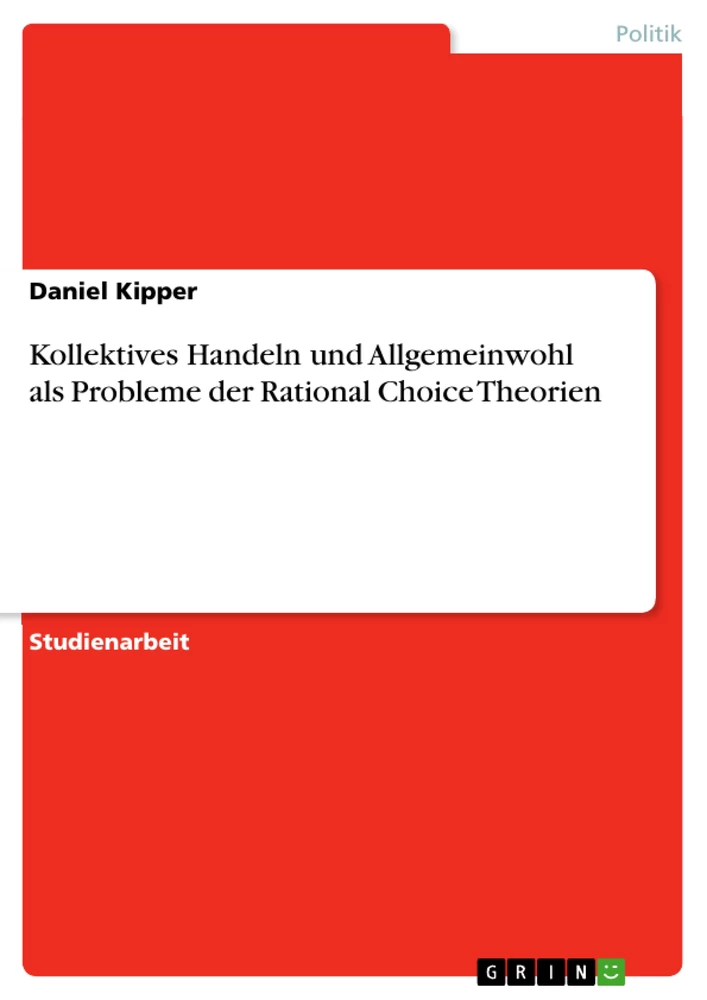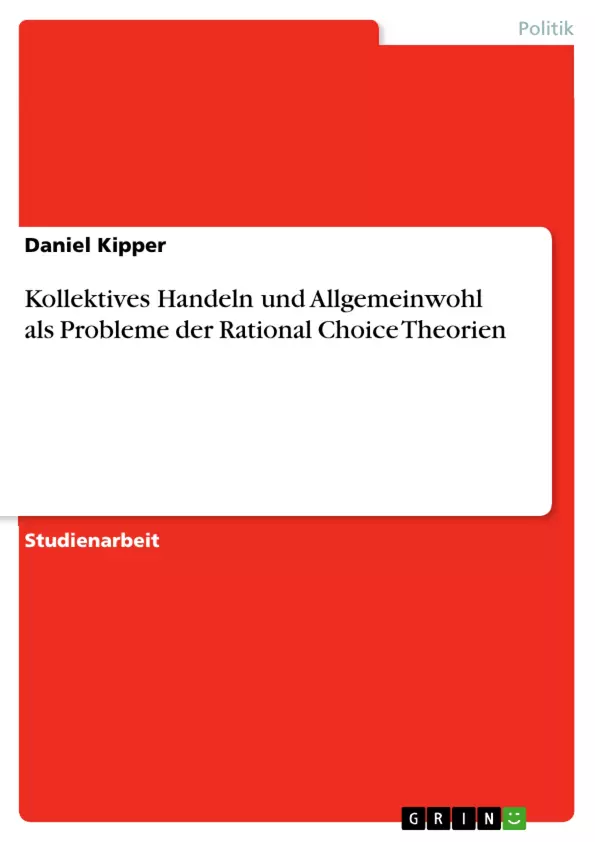Seit den 50er Jahren des 20. Jahrhunderts erlebten die ökonomischen Modelle vor allem in den Vereinigten Staaten einen enormen Aufschwung. Bis zu diesem Zeitpunkt beschränkte sich das Interesse der Forschung meist auf Meinungen, Werte und die politischen Kulturen. Die Modelle rationaler Wahlhandlung propagierten nun die Erforschung der Politik anhand von bereits bekannten, wirtschaftswissenschaftlichen Erkenntnissen. Im Laufe der Zeit behandelte die „Neue Politische Ökonomie“ oder auch „Public Choice“, wie die ökonomischen Modelle rationaler Wahlhandlung auch genannt werden, ein breites Spektrum an Forschungsfeldern. Neben den Hauptthemenfeldern wie dem Wählerverhalten, der Parteipolitik, den Regierungskoalitionen und der politischen Administration beschäftigte sich die Neue Politische Ökonomie mit nunmehr allen Themenbereichen der Politik. 1 Die Neue Politische Ökonomie nutzte die einst in der Wirtschaftswissenschaft entwickelte Theorie zur Erforschung und Beschreibung der Politik und der Handlungen der Akteure.2 Bis zum heutigen Zeitpunkt hat sich die einst starre ökonomische Herangehensweise etwas abgeschwächt. Das geänderte Paradigma der „eingeschränkten Rationalität“ bietet laut Dietmar Braun ein realistischeres Bild menschlichen Entscheidens und Handelns als die strikt auf Marktanalogie fußenden traditionellen ökonomischen Theorien.3
In dieser Hausarbeit soll zunächst die ökonomische Theorie vorgestellt werden. Dabei werde ich explizit auf Anthony Downs eingehen, der dieses Modell der rationalen Wahlhandlung entscheidend geprägt hat. Des Weiteren werde ich mich der Fragestellung widmen, inwieweit die Verwirklichung des Allgemeinwohls sowie kollektives Handeln durch die auf Individualwohl basierenden ökonomischen Theorien erklärt werden können.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 Einführung in die Theorien rationalen Handelns
- 2.1 Grundlagen
- 2.2 Joseph Schumpeters Kritik an der klassischen Demokratie
- 2.3 Anthony Downs Modell des rationalen Wählers
- 2.3.1 Die Weiterentwicklung des Modells von Schumpeter
- 2.3.2 Das Paradox des Wählens
- 2.3.3 Charakterisierung des rationalen Wählers
- 3 Das Problem des kollektiven Handelns
- 3.1 Grundlagen der Fragestellung
- 3.2 Kollektive Dilemmata
- 3.3 Downs Erklärungsansatz für die Existenz des Gemeinwohls
- 3.4 TIT-FOR-TAT als Lösung der kollektiven Dilemmata
- 4 Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Hausarbeit untersucht die ökonomischen Theorien rationalen Handelns, insbesondere im Hinblick auf ihre Erklärungskraft für kollektives Handeln und die Verwirklichung des Allgemeinwohls. Sie analysiert kritisch, inwieweit individualwohlbasierte Modelle diese Phänomene adäquat beschreiben können.
- Einführung in die Rational-Choice-Theorien und deren methodologischen Individualismus.
- Kritik von Schumpeter an der klassischen Demokratietheorie und dessen alternativer Ansatz.
- Downs' Modell des rationalen Wählers und das Paradox des Wählens.
- Das Problem des kollektiven Handelns und die Herausforderungen für Rational-Choice-Modelle.
- Möglichkeiten und Grenzen der Erklärung des Gemeinwohls im Rahmen ökonomischer Theorien.
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung skizziert den Aufschwung ökonomischer Modelle in der Politikwissenschaft seit den 1950er Jahren, insbesondere der „Neuen Politischen Ökonomie“ oder „Public Choice“. Sie beschreibt die Verschiebung vom Fokus auf Meinungen und Werte hin zur Anwendung wirtschaftswissenschaftlicher Erkenntnisse auf politische Phänomene. Die Arbeit kündigt die Vorstellung der ökonomischen Theorie, eine detaillierte Auseinandersetzung mit Anthony Downs' Modell und die Untersuchung der Erklärungskraft dieser Modelle für kollektives Handeln und Allgemeinwohl an. Die Entwicklung von starren ökonomischen Ansätzen hin zu einem Paradigma der „eingeschränkten Rationalität“ wird erwähnt.
2 Einführung in die Theorien rationalen Handelns: Dieses Kapitel bietet eine Einführung in die Rational-Choice-Theorien, die neben Systemtheorie und Marxismus zu den zentralen sozialwissenschaftlichen Theorien zählen. Es erläutert den methodologischen Individualismus als Grundlage dieser Modelle, wonach soziale Handlungen auf individuelle Handlungen zurückgeführt werden können. Das Kapitel diskutiert die klassische Vorstellung von Vernunft als am Gemeinwohl orientiertes Handeln im Gegensatz zum Verständnis der Rational-Choice-Theoretiker, die rationale Entscheidungen als die Wahl der Handlungsalternative definieren, die nach Abwägung aller Vor- und Nachteile den eigenen Präferenzen am besten entspricht. Schließlich werden die Überlegungen von Joseph Schumpeter und Anthony Downs als Basis der ökonomischen Theorien in der Politikwissenschaft vorgestellt.
2.2 Joseph Schumpeters Kritik an der klassischen Demokratie: Dieses Unterkapitel präsentiert Schumpeters Kritik an der klassischen Demokratietheorie, die von der Existenz eines Allgemeinwohls ausgeht. Schumpeter argumentiert, dass ein eindeutig bestimmbares Allgemeinwohl aufgrund der menschlichen Natur nicht existiert. Er beschreibt den Bürger als rational handelnd, aber schlecht informiert und anfällig für irrationale Triebe in politischen Fragen. Diese negative Sicht des Bürgers bildet die Basis für Schumpeters Kritik an der klassischen Demokratie. Er betont die Unmöglichkeit einer Einigung auf Mittel zur Erreichung eines hypothetischen Allgemeinwohls aufgrund mangelnder Information und rationaler Entscheidungsfindung. Schumpeter definiert die Demokratie als einen Wettbewerb um Stimmen und rückt die politischen Akteure in den Mittelpunkt seiner Betrachtung, analog zum Marktmechanismus. Er unterscheidet somit zwischen demokratischen und nicht-demokratischen Regierungen und betont die Rolle der Führungseliten.
3 Das Problem des kollektiven Handelns: Dieses Kapitel befasst sich mit dem Problem des kollektiven Handelns im Kontext der Rational-Choice-Theorien. Es untersucht, wie kollektive Dilemmata entstehen und wie schwer es ist, das Allgemeinwohl im Rahmen individualistisch geprägter Modelle zu erklären. Das Kapitel beleuchtet die Herausforderungen, die sich aus dem Fokus auf individuelle Nutzenmaximierung für die Erklärung von Kooperation und gemeinschaftlichem Handeln ergeben. Die Schwierigkeiten der Erklärung von Altruismus und gemeinwohlorientiertem Verhalten werden diskutiert, möglicherweise im Zusammenhang mit Downs' Erklärungsansatz und Strategien wie "Tit-for-Tat" zur Lösung kollektiver Dilemmata.
Schlüsselwörter
Rational Choice Theorien, Kollektives Handeln, Allgemeinwohl, Methodologischer Individualismus, Schumpeter, Downs, Demokratietheorie, Neue Politische Ökonomie, Public Choice, Kollektive Dilemmata, Eingeschränkte Rationalität.
Häufig gestellte Fragen zu: Ökonomische Theorien rationalen Handelns und ihre Erklärungskraft für kollektives Handeln und Allgemeinwohl
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Die Arbeit untersucht ökonomische Theorien rationalen Handelns, insbesondere ihre Fähigkeit, kollektives Handeln und die Verwirklichung des Allgemeinwohls zu erklären. Sie analysiert kritisch, ob individualwohlbasierte Modelle diese Phänomene angemessen beschreiben können.
Welche Theorien werden behandelt?
Die Arbeit konzentriert sich auf Rational-Choice-Theorien und ihren methodologischen Individualismus. Im Detail werden die Ansätze von Joseph Schumpeter (Kritik an der klassischen Demokratietheorie) und Anthony Downs (Modell des rationalen Wählers) analysiert. Das Problem des kollektiven Handelns und die Herausforderungen für Rational-Choice-Modelle werden ebenfalls ausführlich diskutiert.
Was ist Schumpeters Kritik an der klassischen Demokratietheorie?
Schumpeter kritisiert die Annahme der klassischen Demokratietheorie von einem eindeutig bestimmbaren Allgemeinwohl. Er argumentiert, dass aufgrund der menschlichen Natur kein solches Allgemeinwohl existiert und dass Bürger rational handeln, aber schlecht informiert und anfällig für irrationale Triebe sind. Er sieht die Demokratie als Wettbewerb um Stimmen und betont die Rolle politischer Eliten.
Was ist Downs' Modell des rationalen Wählers?
Downs' Modell des rationalen Wählers ist ein zentraler Bestandteil der Arbeit. Es wird untersucht, wie dieses Modell das Paradox des Wählens erklärt und welche Charakteristika den rationalen Wähler ausmachen. Die Weiterentwicklung dieses Modells im Kontext von Schumpeters Kritik wird ebenfalls beleuchtet.
Was ist das Problem des kollektiven Handelns?
Das Kapitel zum kollektiven Handeln untersucht, wie kollektive Dilemmata entstehen und wie schwierig es ist, das Allgemeinwohl in individualistisch geprägten Modellen zu erklären. Die Herausforderungen, die sich aus der Fokussierung auf individuelle Nutzenmaximierung für die Erklärung von Kooperation und gemeinschaftlichem Handeln ergeben, werden diskutiert. Die Arbeit untersucht mögliche Lösungsansätze wie "Tit-for-Tat".
Welche Rolle spielt das Allgemeinwohl in der Arbeit?
Das Allgemeinwohl ist ein zentrales Thema. Die Arbeit untersucht, inwieweit ökonomische Theorien das Allgemeinwohl erklären können und welche Grenzen diese Erklärungen haben. Die Schwierigkeiten, altruistisches und gemeinwohlorientiertes Verhalten im Rahmen individualistischer Modelle zu erklären, werden diskutiert.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Rational Choice Theorien, Kollektives Handeln, Allgemeinwohl, Methodologischer Individualismus, Schumpeter, Downs, Demokratietheorie, Neue Politische Ökonomie, Public Choice, Kollektive Dilemmata, Eingeschränkte Rationalität.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in eine Einleitung, ein Kapitel zur Einführung in die Theorien rationalen Handelns (inkl. Schumpeters Kritik und Downs' Modell), ein Kapitel zum Problem des kollektiven Handelns und ein Fazit. Die Kapitelzusammenfassungen bieten detaillierte Einblicke in die einzelnen Abschnitte.
Welche Zielsetzung verfolgt die Arbeit?
Die Arbeit zielt darauf ab, die ökonomischen Theorien rationalen Handelns kritisch zu untersuchen und ihre Erklärungskraft für kollektives Handeln und Allgemeinwohl zu bewerten. Sie will aufzeigen, inwieweit individualwohlbasierte Modelle adäquat sind.
- Quote paper
- Daniel Kipper (Author), 2006, Kollektives Handeln und Allgemeinwohl als Probleme der Rational Choice Theorien, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/66799