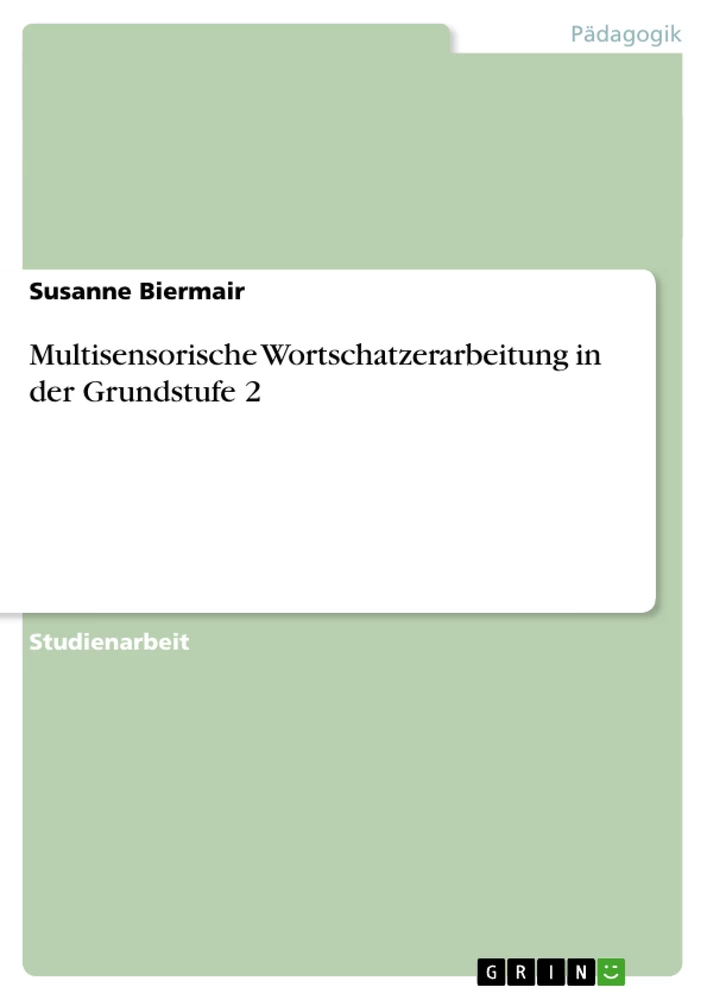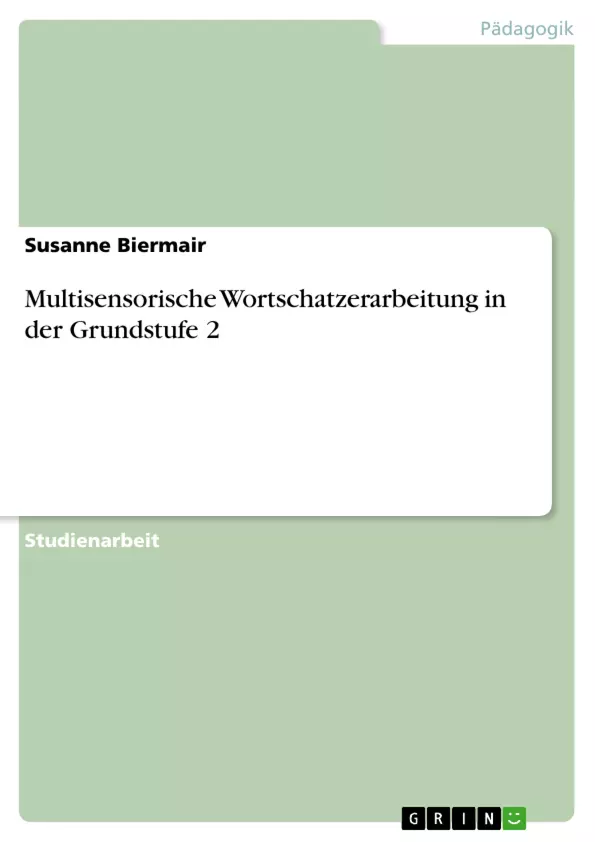Sprachpädagog/innen unserer Zeit können gegenüber ihren früheren Kolleg/innen bereits Erkenntnisse aus verschiedenen Bezugswissenschaften, wie Linguistik, und Psycholinguistik, Lern- und Wahrnehmungspsychologie, Neurologie, Neurobiologie und Soziologie, in ihre Arbeit integrieren und dadurch didaktische Vorgangsweisen nicht mehr ausschließlich nach persönlichen Vorstellungen und Vorlieben erarbeiten, sondern auch nach wissenschaftlich fundierten Kriterien (vgl. Macedonia-Oleinek, 1999, S. 6). Die Methode des ganzheitlichen sensomotorischen Fremdsprachenlernens wird dabei immer interessanter. Sie hat ihre Hauptquelle in der neurologischen Forschung, die heutzutage im Stande ist, über viele Gehirnfunktionen Aufschluss zu geben. Unterstützt durch Erkenntnisse aus der Wahrnehmungs- und der Lernpsychologie wird die Entwicklung gezielter Vermittlungsstrategien in der Fremdsprachendidaktik möglich. Nicht nur der Fremdsprachenunterricht macht sich das Lernen mit allen Sinnen zunutze, sondern auch mit legasthenen Kindern und schwachen Rechtsschreiben wird nach der „Lernen mit allen Sinnen“ - Methode gearbeitet. Dies weiß ich aufgrund meiner Erfahrung als soziale Lernbetreuerin, meiner Ausbildung als Legasthenietrainerin und aufgrund meines persönlichen Bezuges zu diesem Thema (meine Schwester ist Legasthenikerin). Das Thema „Mit allen Sinnen lernen“ stellte daher schon immer eine Faszination für mich dar. Ich empfinde es besonders sinnvoll, im gesamten Unterrichtsgeschehen (nicht nur in der Fremdsprachendidaktik) alle Wahrnehmungen und Sinne zu schärfen. Inzwischen ist nämlich unumstritten, dass neben den körperlichen und geistigen Lernvoraussetzungen die unterschiedlichen Qualitäten der Wahrnehmung (Hören, Sehen, Fühlen usw.) und der Motorik, d.h. der groben und der feinen Bewegungsabläufe, sowie verschiedener anderer Bereiche maßgeblich über den Erfolg einer zu erbringenden Lernleistung mitentscheiden (vgl. Schwark/Laue, 2001, S. 19). [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Der Mutterspracherwerb
- Englischunterricht bei Kindern in der Volksschule
- Österreichischer Lehrplan - Englisch in der Grundstufe 2
- Integrativer Englischunterricht
- Lernen mit allen Sinnen - eine lernpsychologische Erklärung
- TPR - Total Physical Response
- Multisensorische Wortschatzerarbeitung
- Praktische Beispiele
- Zusammenfassung
- Bibliographie und Webliographie
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Seminararbeit widmet sich dem Thema der multisensorischen Wortschatzerarbeitung im Englischunterricht in der Grundstufe 2. Sie beleuchtet die Bedeutung des ganzheitlichen sensomotorischen Fremdsprachenlernens und untersucht dessen Potenzial für die Entwicklung von effizienten Lernstrategien. Im Mittelpunkt steht dabei die Nutzung aller Sinne und motorischer Fähigkeiten im Lernprozess, um den Wortschatz nachhaltig zu verankern und die Sprachentwicklung zu fördern.
- Der Erwerb der Muttersprache als Basis für den Fremdsprachenunterricht
- Der Einsatz von multisensorischen Methoden im Englischunterricht der Grundstufe 2
- Die Bedeutung des integrativen Englischunterrichts
- Die neurologische Grundlage des Lernens mit allen Sinnen
- Die Vorteile des frühen Fremdsprachenlernens
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt die Relevanz des ganzheitlichen sensomotorischen Fremdsprachenlernens im Kontext der heutigen Sprachpädagogik dar. Es wird erläutert, wie Erkenntnisse aus verschiedenen Bezugswissenschaften, wie Linguistik, Psycholinguistik und Lernpsychologie, für die Entwicklung didaktischer Methoden genutzt werden können. Das Kapitel „Der Mutterspracherwerb“ befasst sich mit den Mechanismen des natürlichen Spracherwerbs beim Kleinkind und betont die Wichtigkeit von auditiven und visuellen Reizen für die Sprachentwicklung.
Im Kapitel „Englischunterricht bei Kindern in der Volksschule“ wird die Einführung der verbindlichen Übung „Lebende Fremdsprache“ in Österreich diskutiert und die Bedeutung des frühen Fremdsprachenlernens hervorgehoben. Es wird auf die Vorteile des integrativen Englischunterrichts und die neurologischen Grundlagen des Fremdsprachenlernens eingegangen. Darüber hinaus werden altersspezifische Unterschiede im Spracherwerb und die Rolle der Sprachplastizität betrachtet.
Schlüsselwörter
Fremdsprachendidaktik, ganzheitliches Lernen, sensomotorisches Lernen, multisensorische Wortschatzerarbeitung, Englischunterricht, Grundstufe 2, integrativer Englischunterricht, neurologische Forschung, Lernpsychologie, Mutterspracherwerb, Sprachplastizität, Bilingualität, TPR (Total Physical Response), didaktische Methoden, Lernstrategien.
Häufig gestellte Fragen
Was bedeutet "Lernen mit allen Sinnen" im Fremdsprachenunterricht?
Es handelt sich um eine multisensorische Methode, bei der auditive, visuelle, haptische und motorische Reize kombiniert werden, um den Wortschatz besser im Gehirn zu verankern.
Was ist die TPR-Methode (Total Physical Response)?
TPR ist eine Methode, bei der sprachliche Einheiten mit körperlichen Bewegungen verknüpft werden, was besonders im frühen Englischunterricht effektiv ist.
Warum ist multisensorisches Lernen für die Grundstufe 2 wichtig?
In diesem Alter ist die Sprachplastizität hoch; durch die Einbeziehung der Motorik und aller Sinne wird der Wortschatzerwerb nachhaltiger und motivierender gestaltet.
Welche Rolle spielt die Neurologie in dieser Didaktik?
Die moderne Hirnforschung zeigt, dass Lernen erfolgreicher ist, wenn verschiedene Areale des Gehirns (Wahrnehmung und Bewegung) gleichzeitig aktiviert werden.
Hilft multisensorisches Lernen auch Kindern mit Legasthenie?
Ja, die Arbeit betont, dass diese Methode besonders bei legasthenen Kindern und schwachen Rechtschreibern erfolgreich zur Unterstützung eingesetzt wird.
- Citation du texte
- Mag. Susanne Biermair (Auteur), 2004, Multisensorische Wortschatzerarbeitung in der Grundstufe 2, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/67034