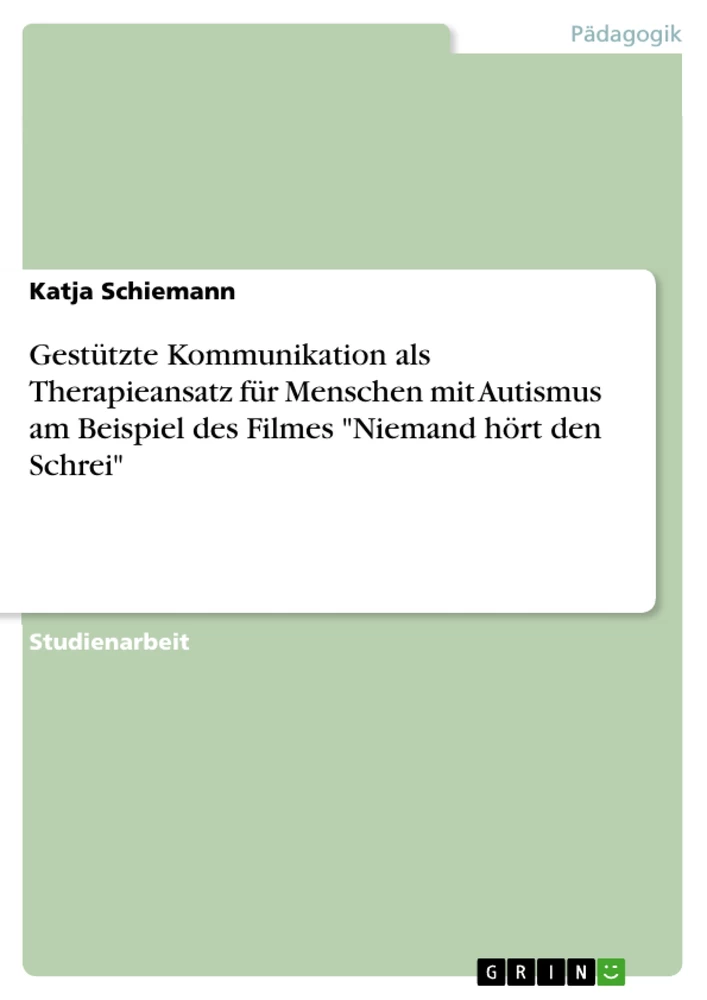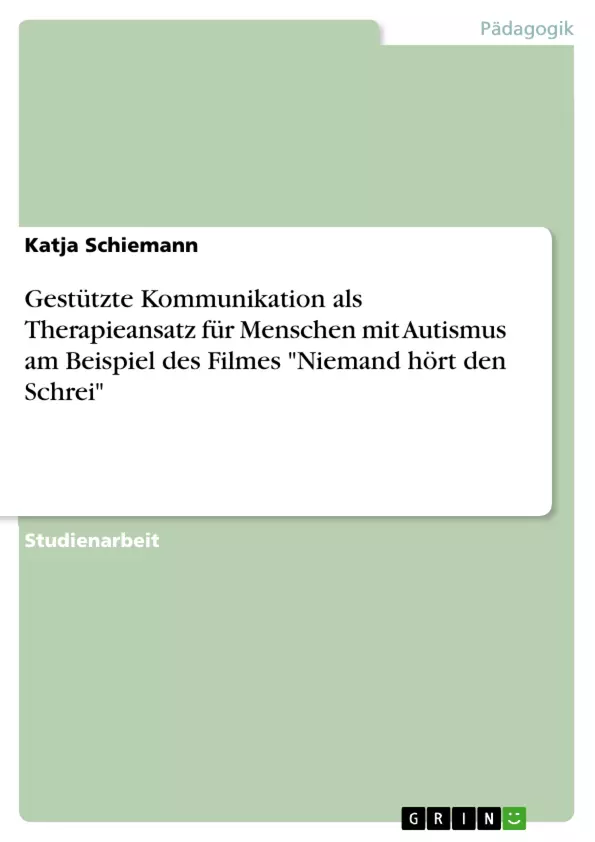Insbesondere Menschen mit autistischen Störungen leben aufgrund ihrer Beziehungs- und Kommunikationsschwierigkeiten häufig in völliger sozialer Isolation, was wiederum weitere Entwicklungsdefizite und schwerwiegende Verhaltensauffälligkeiten zur Folge hat. Um diesen Teufelskreis zu durchbrechen, ist es dringend erforderlich, nach alternativen Kommunikationswegen für autistische Menschen mit zu suchen. Die Gestützte Kommunikation (FC) hat das Ziel, Menschen mit eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten einen zusätzlichen Weg der Verständigung mit anderen Menschen zu eröffnen. An den Beginn dieser Arbeit stelle ich einen kurzen Handlungsabriss des Filmes „Niemand hört den Schrei“, da ich mich im weiteren Verlauf immer wieder auf diesen Film beziehen werde.
Darauf folgt eine kurze, aber prägnante Darstellung der verschiedenen Formen des Autismus einschließlich spezifischer Symptomatik. Daraus wird hervorgehen, dass der Bedarf einer Therapierung autistischer Menschen, unter anderem in Bezug auf ihre kommunikativen Fähigkeiten, vorhanden ist. Als eine Möglichkeit möchte ich die Methode der Gestützten Kommunikation (FC) vorstellen. Ich werde die Grundsätze, den Aufbau und die speziellen Techniken dieser Interventionsmaßnahme erklären. Ziel dieser Arbeit ist es also, die Gestützte Kommunikation als Therapieansatz für Menschen mit Autismus vorzustellen. Theoretische Grundlagen möchte ich, aus Gründen der Anschaulichkeit und des besseren Verständnisses, im Anschluss der jeweiligen Passagen, auf den Film „Niemand hört den Schrei“ beziehen, und an diesem Beispiel erklären. Zu guter Letzt möchte ich in meinem Fazit sowohl Vorteile als auch Probleme der Gestützten Kommunikation nennen können und die Auswirkungen der FC auf das Leben autistischer Menschen kennzeichnen.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 2. Handlungsabriss „Niemand hört den Schrei“
- 3. Autismus
- 3.1 Definition
- 3.2 Hauptformen des Autismus
- 3.3 Die Form des Autismus im Film „Niemand hört den Schrei“
- 4. Gestützte Kommunikation
- 4.1 Definition und Bedeutung von Kommunikation
- 4.2 Die Methode der Gestützten Kommunikation
- 4.3 Techniken der Gestützten Kommunikation
- 4.3.1 Die körperliche Stütze und ihre Ausblendung
- 4.3.2 Die „emotionale“ Stütze
- 4.3.3 Vom „setwork“ zur freien Kommunikation
- 4.4 Anwendung Gestützter Kommunikation im Film
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Gestützte Kommunikation (GK) als Therapieansatz für Menschen mit Autismus, anhand des Films „Niemand hört den Schrei“. Ziel ist es, die GK vorzustellen, ihre Prinzipien und Techniken zu erläutern und ihre Anwendung im Film zu analysieren. Die Arbeit beleuchtet sowohl die Vorteile als auch die Herausforderungen dieser Methode.
- Gestützte Kommunikation als Therapiemethode für Autismus
- Analyse der Kommunikationsschwierigkeiten von Menschen mit Autismus
- Anwendung und Effektivität der Gestützten Kommunikation im Filmbeispiel
- Herausforderungen und Grenzen der Gestützten Kommunikation
- Der Film „Niemand hört den Schrei“ als Fallbeispiel
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung betont die lebenswichtige Bedeutung von Kommunikation und hebt die Kommunikationsdefizite bei Menschen mit Autismus hervor. Sie beschreibt die daraus resultierenden Probleme und die Notwendigkeit alternativer Kommunikationswege. Die Arbeit wird als Untersuchung der Gestützten Kommunikation als Therapieansatz vorgestellt, wobei der Film „Niemand hört den Schrei“ als illustratives Beispiel dient. Das Ziel ist, die Methode zu präsentieren und ihre Vor- und Nachteile zu beleuchten, sowie ihren Einfluss auf das Leben autistischer Menschen zu untersuchen.
2. Handlungsabriss „Niemand hört den Schrei“: Dieser Abschnitt fasst die Handlung des Films zusammen, in dem ein autistischer Junge namens Michael dargestellt wird. Es werden seine Schwierigkeiten im Umgang mit Kommunikation und seine Verhaltensauffälligkeiten beschrieben, sowie der schwierige Umgang seiner Mutter damit. Michaels Schulzeit und die Einführung der Gestützten Kommunikation als Therapiemethode werden geschildert. Der Handlungsabriss endet mit dem sexuellen Missbrauch, den Michael durch seinen Betreuer erlebt, und der anschließenden Gerichtsverhandlung, die auf der Anwendung der Gestützten Kommunikation basiert.
3. Autismus: Dieses Kapitel bietet eine Definition von Autismus als tiefgreifende Entwicklungsstörung mit komplexen Störungen des zentralen Nervensystems. Es werden die vielfältigen Auswirkungen auf Beziehungen, die Teilnahme am gesellschaftlichen Leben und die Integration in die Gesellschaft beschrieben, die sowohl kognitive als auch sprachliche, motorische, emotionale und interaktionale Funktionen betreffen. Der Begriff „Autismus“ wird etymologisch erklärt, und es wird auf das Autismusspektrum und die internationalen Klassifikationssysteme (ICD-10 und DSM-IV) eingegangen. Dieses Kapitel liefert den notwendigen Hintergrund, um die Notwendigkeit einer Therapie wie der Gestützten Kommunikation zu verstehen.
4. Gestützte Kommunikation: Dieses Kapitel widmet sich der Gestützten Kommunikation (GK) als Methode, Menschen mit eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten zusätzliche Wege der Verständigung zu eröffnen. Es wird die Bedeutung von Kommunikation erläutert und die Methode der GK detailliert beschrieben. Die verschiedenen Techniken der GK werden vorgestellt, darunter die körperliche Stütze und ihre Ausblendung, die „emotionale“ Stütze und der Übergang vom „Setwork“ zur freien Kommunikation. Schließlich wird die Anwendung der GK im Film „Niemand hört den Schrei“ analysiert und in diesem Zusammenhang diskutiert.
Häufig gestellte Fragen zu „Niemand hört den Schrei“: Eine Seminararbeit über Gestützte Kommunikation bei Autismus
Was ist der Gegenstand dieser Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Gestützte Kommunikation (GK) als Therapieansatz für Menschen mit Autismus, anhand des Films „Niemand hört den Schrei“. Sie erläutert die Prinzipien und Techniken der GK und analysiert deren Anwendung im Film, beleuchtet Vor- und Nachteile und untersucht deren Einfluss auf das Leben autistischer Menschen.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Gestützte Kommunikation als Therapiemethode für Autismus; Analyse der Kommunikationsschwierigkeiten von Menschen mit Autismus; Anwendung und Effektivität der Gestützten Kommunikation im Filmbeispiel; Herausforderungen und Grenzen der Gestützten Kommunikation; Der Film „Niemand hört den Schrei“ als Fallbeispiel; Definition und verschiedene Formen von Autismus; Techniken der Gestützten Kommunikation (körperliche und emotionale Stütze, Übergang von „Setwork“ zu freier Kommunikation).
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit gliedert sich in fünf Kapitel: Einleitung, Handlungsabriss des Films „Niemand hört den Schrei“, Autismus (Definition, Formen, Auswirkungen), Gestützte Kommunikation (Definition, Techniken, Anwendung im Film) und Fazit. Jedes Kapitel wird zusammengefasst.
Was wird in der Einleitung erläutert?
Die Einleitung betont die Bedeutung von Kommunikation, hebt Kommunikationsdefizite bei Autismus hervor und beschreibt die Notwendigkeit alternativer Kommunikationswege. Sie stellt die Gestützte Kommunikation als Therapieansatz vor und benennt das Ziel der Arbeit: Präsentation der Methode, Beleuchtung von Vor- und Nachteilen und Untersuchung ihres Einflusses auf das Leben autistischer Menschen.
Wie wird der Film „Niemand hört den Schrei“ in der Arbeit verwendet?
Der Film dient als Fallbeispiel. Der Handlungsabriss beschreibt die Schwierigkeiten des autistischen Jungen Michael im Umgang mit Kommunikation und seinen Verhaltensauffälligkeiten sowie den schwierigen Umgang seiner Mutter damit. Die Einführung der Gestützten Kommunikation als Therapiemethode und der sexuelle Missbrauch, der zu einer Gerichtsverhandlung führt, werden ebenfalls dargestellt. Die Anwendung der GK in diesem Kontext wird analysiert.
Was wird im Kapitel über Autismus erklärt?
Dieses Kapitel definiert Autismus als tiefgreifende Entwicklungsstörung mit komplexen Störungen des zentralen Nervensystems. Es beschreibt die vielfältigen Auswirkungen auf Beziehungen und die gesellschaftliche Teilhabe und geht auf kognitive, sprachliche, motorische, emotionale und interaktionale Funktionen ein. Es erklärt den Begriff „Autismus“ etymologisch und bezieht sich auf das Autismusspektrum und die internationalen Klassifikationssysteme (ICD-10 und DSM-IV).
Wie wird die Gestützte Kommunikation (GK) in der Arbeit beschrieben?
Das Kapitel über GK beschreibt sie als Methode, Menschen mit eingeschränkten Kommunikationsmöglichkeiten zusätzliche Wege der Verständigung zu eröffnen. Es erläutert die Bedeutung von Kommunikation und beschreibt detailliert die Methode der GK. Es stellt verschiedene Techniken vor, darunter die körperliche Stütze und ihre Ausblendung, die „emotionale“ Stütze und den Übergang vom „Setwork“ zur freien Kommunikation. Die Anwendung der GK im Film wird analysiert.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Seminararbeit?
Das Fazit fasst die Ergebnisse der Analyse zusammen und diskutiert die Erkenntnisse. (Der genaue Inhalt des Fazits ist in der vorliegenden Zusammenfassung nicht explizit genannt.)
- Citation du texte
- Katja Schiemann (Auteur), 2006, Gestützte Kommunikation als Therapieansatz für Menschen mit Autismus am Beispiel des Filmes "Niemand hört den Schrei", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/67065