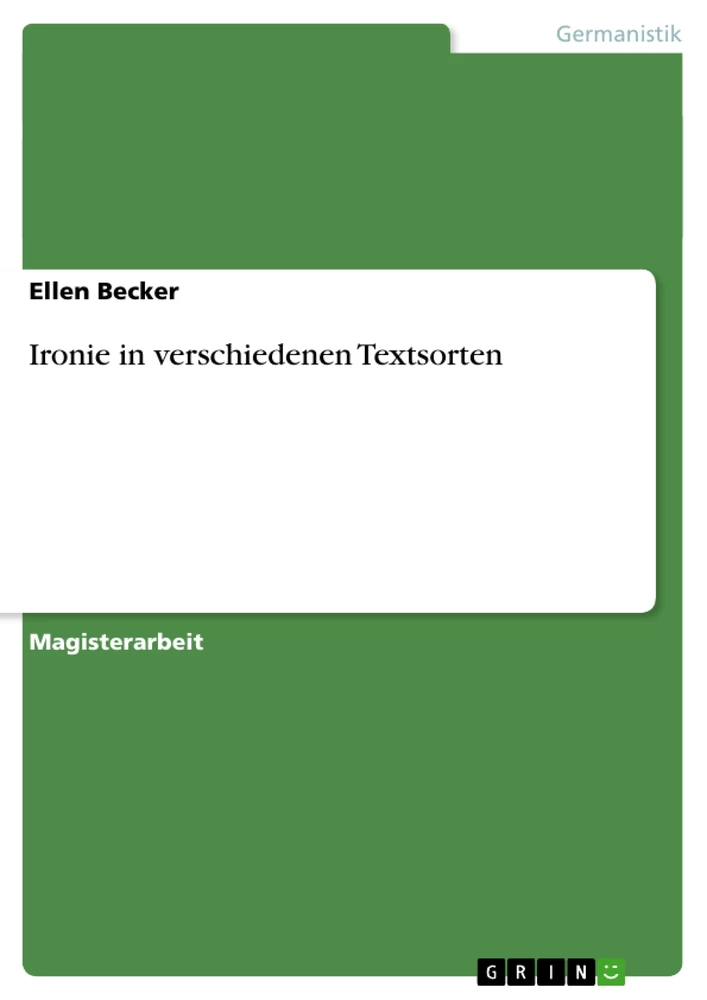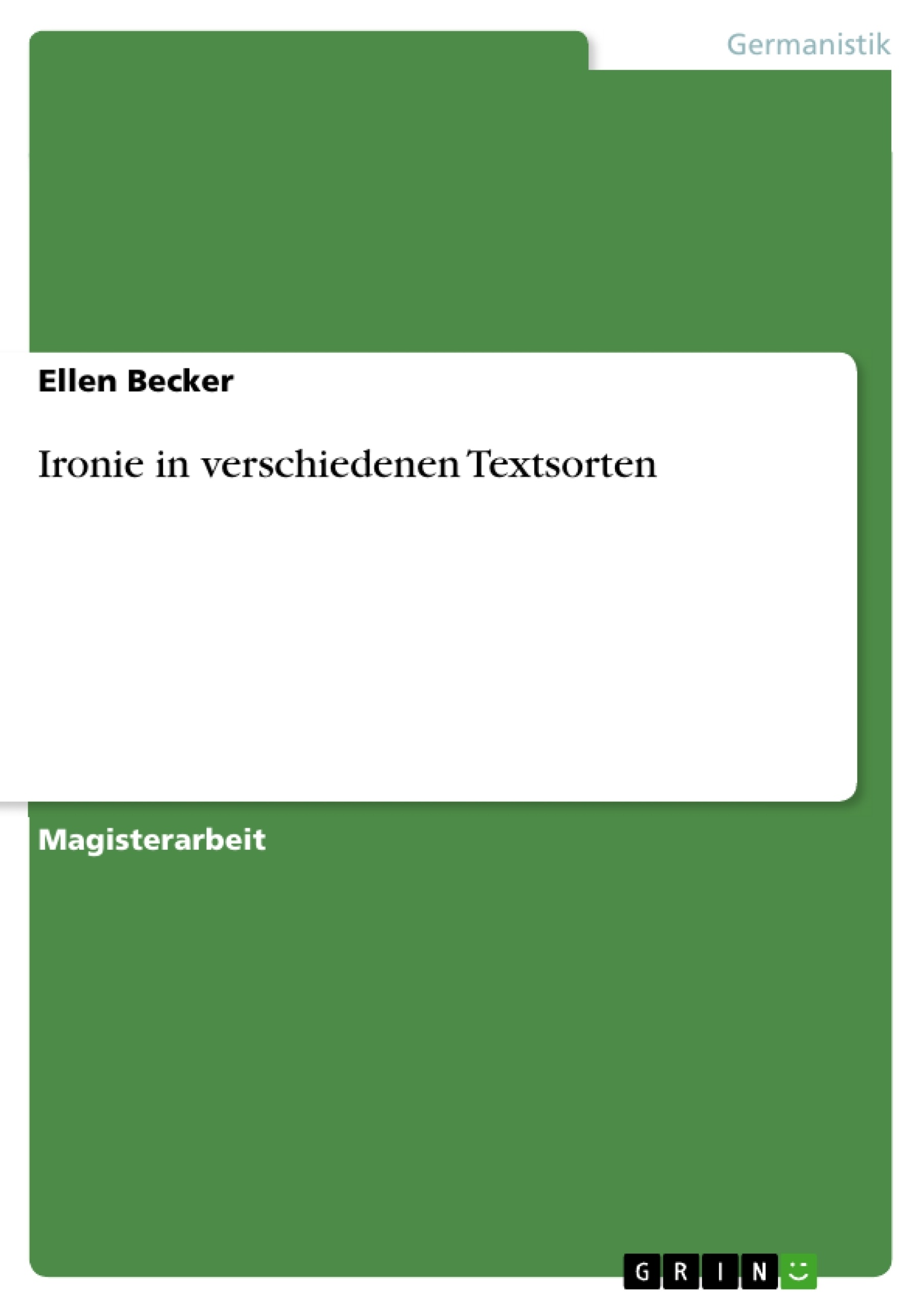Kommunikation dient nicht ausschließlich der Übertragung von Informationen. Häufig wenden Sprecher indirekte Sprechweisen an, um ihrem Gegenüber, über Informationen hinaus, etwas zu vermitteln. Die Ironie, als allgegenwärtiges Phänomen, stellt eines dieser indirekten Kommunikationsmittel dar. Sie ist sowohl in Alltagsgesprächen als auch in der Literatur zu beobachten. Zudem kann Ironie in anderen schriftlichen Texten, wie z.B. der folgenden Kontaktanzeige gefunden werden.
„Frau völlig außer sich, weil die ‚4 davorsteht’ und auch noch alleine mit Sohnemann (auch mit einer 4 aber ohne 0) ...brauche unzuverlässigen Mann, der mich kritisiert und mich nach kurzer Zeit wieder verlässt.“ (Kontaktanzeige aus: Colibri April 2006)
Ein Leser erkennt die Ironie hier intuitiv. Was veranlasst ihn aber, diese Kontaktanzeige als ironisch aufzufassen? Es scheinen sich komplexe Strukturen dahinter zu verbergen, die weder leicht zu durchschauen noch auf einer rein syntaktischen Ebene auszumachen sind.
In der Literaturwissenschaft sind viele Beiträge zur Ironie in Bezug auf die Stilistik entstanden. Seit den 1960er Jahren befasst sich die Linguistik mit diesem Thema. Es lassen sich viele Auffassungen und Untersuchungen zur verbalen Ironie in der Literatur finden. Hieraus entwickelten sich konkrete Theorien, die herausstellen, wie ironische Äußerungen erkannt bzw. verstanden werden. Allerdings gibt es wenig linguistisch fundierte Arbeiten zur Ironie in Texten bzw. bestimmten Textsorten. In dieser Arbeit soll deshalb der Frage nachgegangen werden, ob sich die Theorien, die ursprünglich für ironische Äußerungen konzipiert worden sind, auch auf Ironie in Textsorten anwenden lassen.
Die vorliegende Arbeit ist in zwei Teile gegliedert. Der theoretische Hintergrund bestimmt zunächst den Ironiebegriff, um die Ironie von anderen Stilformen abzugrenzen. Im Folgenden wird diese aus implikatur- und sprechakttheoretischer Sicht erläutert. Darüber hinaus werden weitere Erklärungsmodelle vorgestellt und diskutiert, die neue Herangehensweisen postulieren. Es wird zudem ein Überblick von Ironiesignalen aufgezeigt und im Anschluss diskutiert, ob diese zur Ironieerkennung notwendig sind.
Den zweiten Teil dieser Arbeit bildet eine empirische Analyse, welche sich mit Ironie in verschiedenen Textsorten befasst und herausstellt, welche Ironietheorie die umfassendste ist. Abschließend werden ergänzend mögliche Verwendungsmotivationen von verbaler und textueller Ironie angeführt.
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einleitung
- 1.1 Gliederung der Arbeit
- I. Teil: Theoretischer Hintergrund
- 2. Begriffsbestimmung der Ironie
- 2.1 Ironie seit dem klassischen Altertum
- 2.2 Ironie in Wörterbüchern des 20. Jahrhunderts
- 2.3 Die Abgrenzung der Ironie von anderen Stilformen
- 3. Erste Ironietheorien der Linguistik
- 3.1 Implikaturtheorie nach Grice
- 3.1.1 Kooperationsprinzip und Konversationsmaximen
- 3.1.2 Generelle und partikuläre Implikaturen
- 3.1.3 Ironie als konversationelle partikuläre Implikatur
- 3.2 Ironie als Sprechakt
- 3.2.1 Ironie als indirekter Sprechakt
- 3.2.2 Ironie als uneigentlicher Sprechakt
- 4. Neuere Erklärungsmodelle
- 4.1 Echoic Mention Theory
- 4.2 Echoic Reminder Theory
- 4.3 Pretense Theory
- 4.4 Allusional Pretense Theory
- 5. Zusammenfassung der Theorien
- 6. Ironiesignale
- II. Teil: Ironie in schriftlichen Textsorten - Eine Analyse
- 7. Ironie in schriftlichen Texten
- 7.1 Textsorte und Textsortenklasse
- 7.2 Ironie in verschiedenen Textsorten
- 8. Anwendung der allusional pretense theory auf Ironie in verschiedenen Textsorten
- 8.1 Analyse
- 8.2 Zusammenfassung und Auswertung der Ergebnisse
- 9. Verwendungsmotivationen von verbaler und textueller Ironie
- 9.1 Höflichkeit
- 9.2 Negative Bewertung
- 9.3 Ästhetischer Humor
- 10. Schlussbetrachtung
- 10.1 Ausblick
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Magisterarbeit untersucht die Anwendbarkeit von linguistischen Ironietheorien auf schriftliche Textsorten. Ziel ist es, herauszufinden, ob Theorien, die ursprünglich für verbale Ironie entwickelt wurden, auch auf die Analyse von Ironie in verschiedenen Texttypen übertragen werden können. Die Arbeit konzentriert sich auf die Analyse schriftlicher Texte und untersucht, wie Ironie in diesen Texten erkannt und interpretiert wird.
- Begriffsbestimmung und Abgrenzung der Ironie von anderen Stilmitteln
- Anwendung verschiedener linguistischer Ironietheorien (Implikaturtheorie, Sprechakttheorie, etc.)
- Analyse von Ironie in verschiedenen schriftlichen Textsorten
- Untersuchung von Ironiesignalen in Texten
- Motivationen für die Verwendung von Ironie in Texten
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einleitung: Die Einleitung führt in das Thema Ironie als indirektes Kommunikationsmittel ein und stellt die Forschungsfrage nach der Anwendbarkeit von Ironietheorien auf schriftliche Textsorten. Sie verdeutlicht die Komplexität der Ironieerkennung und benennt den Mangel an linguistisch fundierten Arbeiten zu diesem Thema. Die Arbeit wird als Antwort auf diese Forschungslücke konzipiert.
2. Begriffsbestimmung der Ironie: Dieses Kapitel liefert eine umfassende Definition des Begriffs „Ironie“, indem es historische Perspektiven (klassisches Altertum) und Definitionen aus Wörterbüchern des 20. Jahrhunderts berücksichtigt. Es grenzt die Ironie klar von anderen Stilfiguren ab und legt damit die Basis für die folgenden theoretischen Ausführungen.
3. Erste Ironietheorien der Linguistik: Hier werden die grundlegenden linguistischen Ansätze zur Erklärung von Ironie präsentiert. Die Implikaturtheorie nach Grice wird detailliert erläutert, inklusive des Kooperationsprinzips und der Konversationsmaximen. Die Betrachtung der Ironie als Sprechakt (indirekt und uneigentlich) erweitert das Verständnis der komplexen Mechanismen hinter ironischen Äußerungen.
4. Neuere Erklärungsmodelle: Dieses Kapitel stellt neuere, innovative Ansätze zur Erklärung von Ironie vor, wie die Echoic Mention Theory, die Echoic Reminder Theory, die Pretense Theory und die Allusional Pretense Theory. Diese Theorien bieten alternative Perspektiven auf die Erzeugung und Interpretation ironischer Äußerungen und bereiten den Boden für die spätere Analyse.
5. Zusammenfassung der Theorien: Die verschiedenen im vorherigen Kapitel vorgestellten Theorien werden hier vergleichend gegenübergestellt und zusammengefasst. Das Ziel besteht darin, die jeweils Stärken und Schwächen hervorzuheben und eine umfassende Grundlage für die anschließende Analyse zu schaffen.
6. Ironiesignale: In diesem Kapitel werden verschiedene Indikatoren und Signale diskutiert, die auf das Vorhandensein von Ironie in Texten hindeuten können. Die Frage nach der Notwendigkeit dieser Signale für die erfolgreiche Ironieerkennung wird kritisch beleuchtet.
7. Ironie in schriftlichen Texten: Dieses Kapitel definiert die Begriffe „Text“, „Textsorte“ und „Textsortenklasse“ und bereitet so den Weg für die Analyse von Ironie in verschiedenen schriftlichen Texttypen im darauf folgenden Kapitel.
8. Anwendung der allusional pretense theory auf Ironie in verschiedenen Textsorten: Der Kern dieser Arbeit, in dem die ausgewählte Ironietheorie auf konkrete schriftliche Texte angewendet wird. Die Analyse selbst wird detailliert dargestellt, gefolgt von einer Zusammenfassung und Auswertung der gewonnenen Ergebnisse. Die Ergebnisse bilden die empirische Basis für die Schlussfolgerungen.
9. Verwendungsmotivationen von verbaler und textueller Ironie: Dieses Kapitel untersucht die Gründe, warum Ironie in schriftlichen Texten verwendet wird. Dabei werden Aspekte wie Höflichkeit, negative Bewertung und ästhetischer Humor berücksichtigt und in Bezug auf die Analyseergebnisse gesetzt.
Schlüsselwörter
Ironie, Linguistik, Textsorten, Textanalyse, Implikaturtheorie, Sprechakttheorie, Allusional Pretense Theory, Ironiesignale, Kommunikation, Indirekte Sprechweise.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zur Magisterarbeit: "Ironie in schriftlichen Textsorten - Eine Analyse"
Was ist das Thema dieser Magisterarbeit?
Die Magisterarbeit untersucht die Anwendbarkeit linguistischer Ironietheorien auf schriftliche Textsorten. Das zentrale Forschungsziel ist es herauszufinden, ob Theorien, die ursprünglich für verbale Ironie entwickelt wurden, auch auf die Analyse von Ironie in verschiedenen Texttypen übertragen werden können.
Welche linguistischen Ironietheorien werden behandelt?
Die Arbeit behandelt verschiedene linguistische Ironietheorien, darunter die Implikaturtheorie nach Grice (mit Kooperationsprinzip und Konversationsmaximen), die Sprechakttheorie (indirekte und uneigentliche Sprechakte), die Echoic Mention Theory, die Echoic Reminder Theory, die Pretense Theory und die Allusional Pretense Theory. Diese Theorien werden vergleichend dargestellt und ihre Stärken und Schwächen beleuchtet.
Welche Textsorten werden analysiert?
Die Arbeit analysiert Ironie in verschiedenen schriftlichen Textsorten. Die genaue Auswahl der Textsorten wird im Haupttext der Arbeit spezifiziert. Die Analyse konzentriert sich darauf, wie Ironie in diesen Texten erkannt und interpretiert wird.
Welche Methode wird zur Analyse der Ironie verwendet?
Die Arbeit verwendet die Allusional Pretense Theory als Hauptansatz zur Analyse von Ironie in den ausgewählten schriftlichen Textsorten. Die Anwendung dieser Theorie auf konkrete Textbeispiele wird detailliert beschrieben und die Ergebnisse werden ausgewertet.
Welche Ergebnisse werden präsentiert?
Die Arbeit präsentiert die Ergebnisse der Analyse von Ironie in verschiedenen Textsorten unter Anwendung der Allusional Pretense Theory. Diese Ergebnisse werden zusammengefasst und interpretiert, um Schlussfolgerungen über die Anwendbarkeit der Theorie auf schriftliche Texte zu ziehen.
Welche Motivationen für die Verwendung von Ironie werden untersucht?
Die Arbeit untersucht verschiedene Motivationen für die Verwendung von Ironie in schriftlichen Texten, darunter Höflichkeit, negative Bewertung und ästhetischer Humor. Diese Motivationen werden im Kontext der Analyseergebnisse diskutiert.
Wie ist die Arbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in zwei Hauptteile gegliedert: einen theoretischen Teil, der sich mit der Begriffsbestimmung und verschiedenen Ironietheorien beschäftigt, und einen empirischen Teil, der die Anwendung der ausgewählten Theorie auf schriftliche Textsorten beinhaltet. Die Arbeit umfasst eine Einleitung, eine Schlussbetrachtung mit Ausblick und eine Zusammenfassung der Kapitel.
Welche Schlüsselbegriffe sind relevant für die Arbeit?
Wichtige Schlüsselbegriffe sind: Ironie, Linguistik, Textsorten, Textanalyse, Implikaturtheorie, Sprechakttheorie, Allusional Pretense Theory, Ironiesignale, Kommunikation, indirekte Sprechweise.
Wo finde ich die detaillierte Analyse der Ironie in den Textsorten?
Die detaillierte Analyse der Ironie in den verschiedenen Textsorten findet sich im Kapitel "Anwendung der allusional pretense theory auf Ironie in verschiedenen Textsorten". Dieses Kapitel enthält eine detaillierte Darstellung der Analysemethode und der Ergebnisse.
Welche Schlussfolgerungen zieht die Arbeit?
Die Schlussfolgerungen der Arbeit beziehen sich auf die Anwendbarkeit der Allusional Pretense Theory und anderer linguistischer Theorien auf die Analyse von Ironie in schriftlichen Textsorten. Die Arbeit bewertet, inwieweit diese Theorien geeignet sind, die Komplexität der Ironieerkennung und -interpretation in verschiedenen Texttypen zu erklären.
- Citation du texte
- Ellen Becker (Auteur), 2006, Ironie in verschiedenen Textsorten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/67079