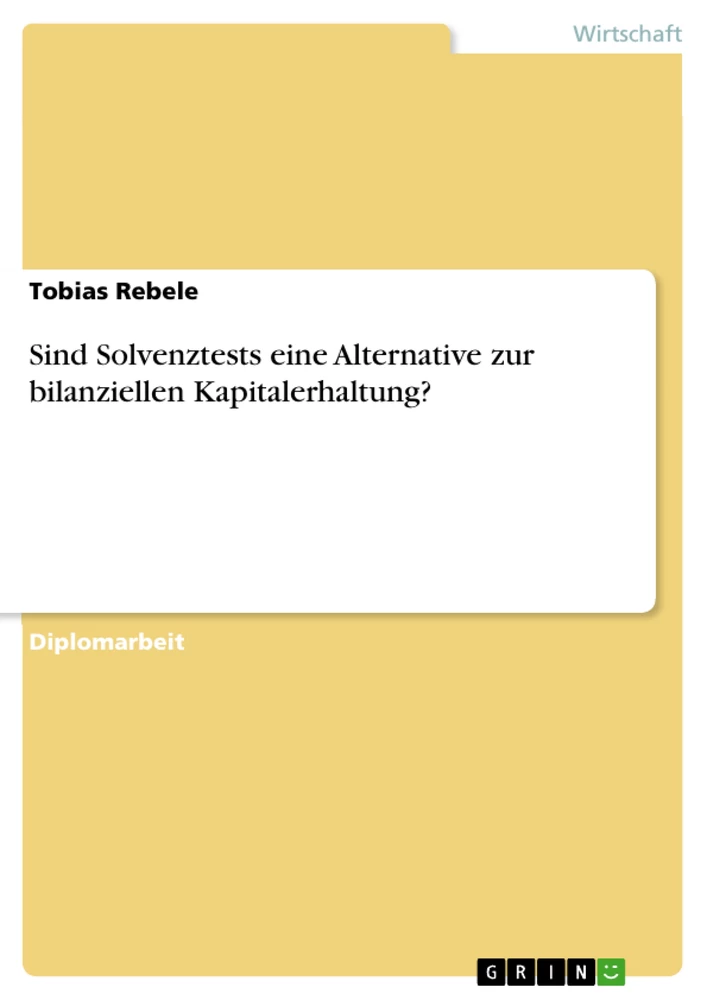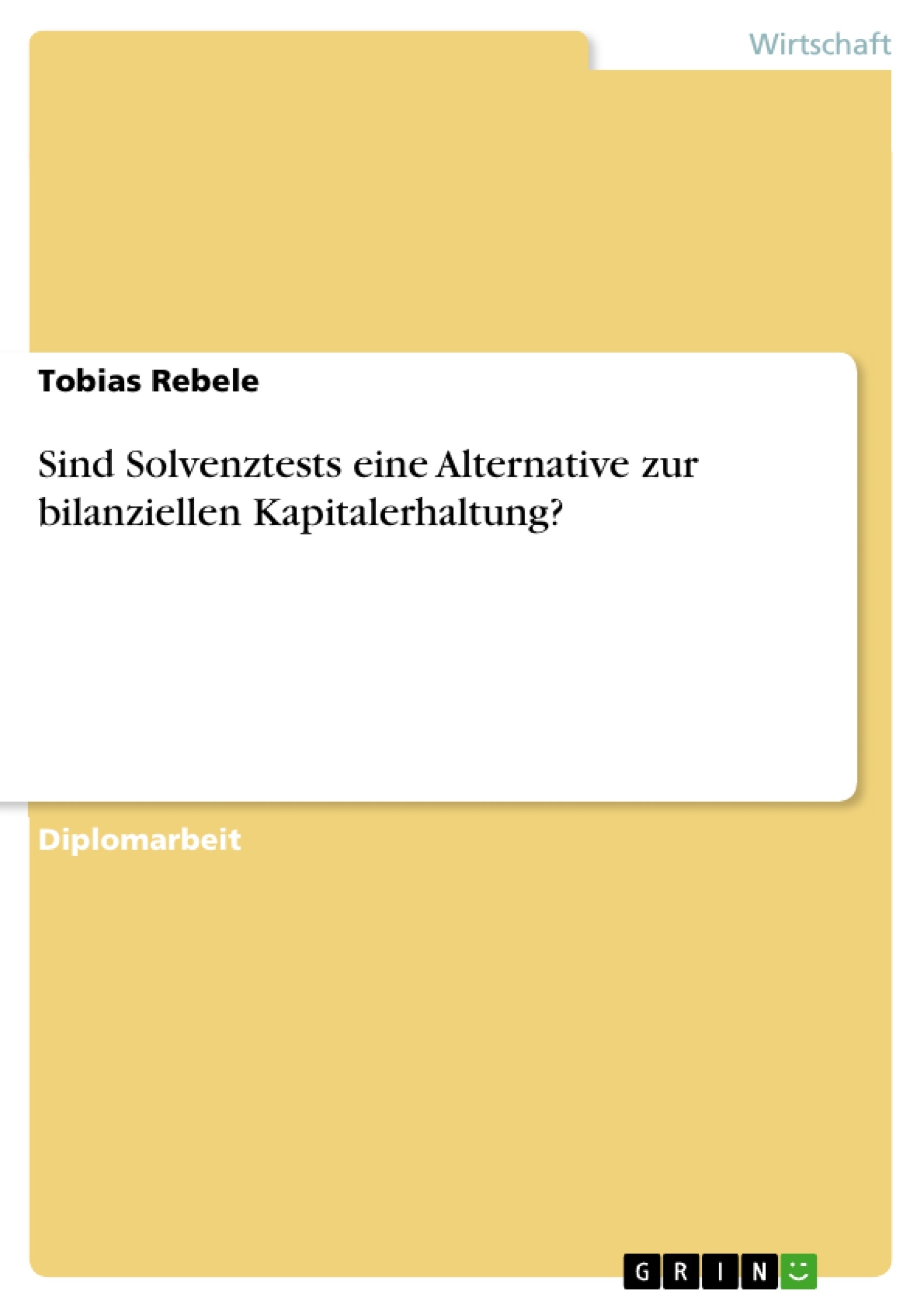Die Züge eines Paradigmawechsels in der europäischen Rechnungslegung, der bereits 1999 durch Vorlage des Aktionsplans für Finanzdienstleistungen eingesetzt hat und dessen Umsetzung bis Ende 2005 durch die EU-Kommission vorgesehen war, nehmen immer konkretere Formen an. So wurde durch die Umsetzung der „IAS-Verordnung“ durch das Bilanzrechtsreformgesetz (BilReG) „ein Nebeneinander mehrerer Rechnungslegungssysteme“ mgeschaffen.
Demnach müssen alle Unternehmen, deren Wertpapiere auf einem geregelten Markt gehandelt werden oder zu einem solchen Markt zugelassen werden sollen (im Folgenden: kapitalmarktorientierte Unternehmen), ihre Konzernabschlüsse nach in der EU anerkannten Rechnungslegungsgrundsätzen (IAS/IFRS) aufstellen. Ebenso sind alle kapitalmarktorientierten Mutterunternehmen verpflichtet, neben einem IFRS-Konzernabschluss einen HGB-Einzelabschluss für Steuer- und Ausschüttungszwecke zu erstellen, sowie bei gleichzeitiger Notierung an der US-amerikanischen Börse eine Überleitungsrechnung des Konzernabschlusses auf die US-GAAP vorzunehmen. Im Gegensatz zu einigen europäischen EU-Mitgliedstaaten hat sich Deutsch-land mangels angemessener Alternativen zur bilanziellen Kapitalerhaltung einer zwingenden Vorschrift der IAS/IFRS für den Jahresabschluss bislang verwahrt.
Doch nicht nur durch die abnehmende Bedeutung der handelsrechtlichen Grundsätze im Konzern gerät das deutsche Kapitalschutzsystem zunehmend unter Druck, sondern auch und vor allem durch eine Reform des Gesellschaftsrechts, die sich auf europäischer Ebene anbahnt. Denn die „Inspire Art“-Entscheidung des Europäischen Gerichtshofs sowie die momentan auf großes Interesse treffende englischeprivate limited company als Pendant zur deutschen GmbH oder GmbH & Co. KG rütteln an der Wettbewerbsfähigkeit der deutschen Gesellschaftsrechtsformen, da die Kapitalerhaltungsregelungen in den anderen 25 EU-Mitgliedstaaten teilweise wesentlich lockerer ausfallen. Diese aufrüttelnde Wirkung wird aus deutscher Sicht durch die im Vorjahr in Kraft getretene Rechtsreform der französischen Société à résponsabilité limitée verstärkt. So wurde für diese Gesellschaftsform die Mindestkapitalerfordernis „abgeschafft“, indem der Gesetzgeber den Weg zur „1-Euro-GmbH“ geebnet hat.
Inhaltsverzeichnis
- Problemstellung
- Gläubigerschutz
- Institutioneller Gläubigerschutz durch Kapitalerhaltung
- Gläubigerschutz durch Ausschüttungssperren
- Die Bilanzaufgabe „Ausschüttungssperre“
- Eigner-Gläubiger-Interessenkonflikt
- Aussagegrenzen von Bilanzen und Finanzplanüberlegenheit
- Gläubigerschutz durch Information
- Gläubigerschutz durch Solvenztests
- Der Solvenzbegriff nach US-amerikanischem Recht
- Die Aufgabe des Konzeptes vom legal capital im RMBCA
- Insolvency test
- Equity insolvency test
- Balance sheet test
- Der Ausschüttungsbegriff nach dem Cal. Corp. Code
- Der Solvenzbegriff nach europäischem und deutschem Recht
- Der Reformprozess des europäischen Gesellschafts- und Kapitalerhaltungsrechts
- Die Überprüfung der Solvenz nach dem „Rickford-Bericht“
- Die deutschen Insolvenztatbestände nach der InsO
- Die Zahlungsunfähigkeit (§ 17 InsO)
- Die Überschuldung (§ 19 InsO)
- Die drohende Zahlungsunfähigkeit (§ 18 InsO)
- Der Solvenzbegriff nach US-amerikanischem Recht
- Erfordernis einer bilanziellen Kapitalerhaltung?
- Gründe für gesetzliche Kapitalerhaltungsregeln
- Reduzierung der „financial agency“- Kosten
- Verminderung negativer externer Effekte – eine Analyse der Anreizwirkungen der Kapitalerhaltung
- Problematik stiller Reserven
- Die Auswirkungen bilanzieller Wahlrechte auf den Gläubigerschutz
- Funktionsfähigkeit des entziehbaren Gewinns zur Vermeidung von Unternehmensinsolvenzen
- Fazit
- Gründe für gesetzliche Kapitalerhaltungsregeln
- Würdigung von Solvenztests als Alternative zum System der Kapitalerhaltung
- Kritik an bestehenden US-amerikanischen Solvenztests
- Bedeutung der Rechnungslegung im Rahmen der insolvency tests
- Problem einer justiziablen Definition der equity insolvency
- Kritik an den europäischen Reformvorschlägen
- Bestehende Instrumente zur Solvenzeinschätzung in Deutschland
- Nutzung von finanzplanorientierten Zahlungsgrößen – Kernstück der Prüfung eingetretener oder drohender Zahlungsunfähigkeit nach IDW PS 800
- Statistische Jahresabschlussanalysen zur Früherkennung der Insolvenzgefahr
- Prüfung der going concern-Prämisse
- Bonitätsbeurteilung anhand von Ratings
- Ausgestaltung eines „Gläubigerschutz-idealen“ Solvenztests
- Fazit
- Kritik an bestehenden US-amerikanischen Solvenztests
- Thesenförmige Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit der Frage, ob Solvenztests eine Alternative zur bilanziellen Kapitalerhaltung darstellen können. Sie analysiert die verschiedenen Formen des Gläubigerschutzes und beleuchtet dabei insbesondere die Rolle der Kapitalerhaltung im Vergleich zu Solvenztests. Die Arbeit untersucht die Funktionsweise und die Grenzen der bilanziellen Kapitalerhaltung sowie die Vor- und Nachteile von Solvenztests aus Sicht des Gläubigerschutzes.
- Gläubigerschutz und Kapitalerhaltung
- Solvenztests als Alternative zur Kapitalerhaltung
- Kritik an bestehenden Solvenztests in den USA und Europa
- Instrumente zur Solvenzeinschätzung in Deutschland
- Ausgestaltung eines „Gläubigerschutz-idealen“ Solvenztests
Zusammenfassung der Kapitel
Kapitel 1 führt in die Problemstellung ein und stellt die zentrale Forschungsfrage nach der Alternative von Solvenztests zur bilanziellen Kapitalerhaltung vor. Kapitel 2 befasst sich mit dem Gläubigerschutz und betrachtet verschiedene Formen des Schutzes, darunter den institutionellen Gläubigerschutz durch Kapitalerhaltung, Ausschüttungssperren, Information und Solvenztests. Es analysiert den Solvenzbegriff im US-amerikanischen und europäischen Recht und untersucht die relevanten Insolvenztatbestände nach der deutschen Insolvenzordnung.
Kapitel 3 analysiert das Erfordernis der bilanziellen Kapitalerhaltung und beleuchtet die Gründe für gesetzliche Kapitalerhaltungsregeln, die Problematik stiller Reserven und die Auswirkungen bilanzieller Wahlrechte auf den Gläubigerschutz. Kapitel 4 widmet sich der Würdigung von Solvenztests als Alternative zur Kapitalerhaltung. Es kritisiert bestehende US-amerikanische und europäische Solvenztests und stellt die bestehenden Instrumente zur Solvenzeinschätzung in Deutschland dar. Zudem wird ein „Gläubigerschutz-idealer“ Solvenztest entwickelt. Schließlich fasst Kapitel 5 die wichtigsten Erkenntnisse der Arbeit in Form von Thesen zusammen.
Schlüsselwörter
Gläubigerschutz, Kapitalerhaltung, Solvenztests, Insolvenz, Rechnungslegung, US-amerikanisches Recht, Europäisches Recht, Deutsches Recht, Finanzplan, Jahresabschlussanalyse, Ratings, IDW PS 800
Häufig gestellte Fragen
Sind Solvenztests eine echte Alternative zur Kapitalerhaltung?
Die Arbeit untersucht, ob Solvenztests (wie im US-Recht) den Gläubigerschutz ebenso effektiv gewährleisten können wie das deutsche System der bilanziellen Kapitalerhaltung.
Was ist der Unterschied zwischen „Equity Insolvency Test“ und „Balance Sheet Test“?
Der Equity Insolvency Test prüft die laufende Zahlungsfähigkeit, während der Balance Sheet Test die rechnerische Überschuldung (Vermögen vs. Verbindlichkeiten) bewertet.
Warum gerät das deutsche Kapitalschutzsystem unter Druck?
Durch die Einführung der IFRS und den Wettbewerb europäischer Gesellschaftsformen (z. B. Limited) werden die strengen deutschen Regeln zunehmend hinterfragt.
Welche Rolle spielen stille Reserven beim Gläubigerschutz?
Stille Reserven erschweren die Beurteilung der tatsächlichen Solvenz eines Unternehmens, da sie in der Bilanz nicht unmittelbar ersichtlich sind.
Was ist ein „Gläubigerschutz-idealer“ Solvenztest?
Die Arbeit skizziert ein Modell, das finanzplanorientierte Zahlungsgrößen und Ratings nutzt, um die Insolvenzgefahr frühzeitig und präzise zu erkennen.
- Citation du texte
- Tobias Rebele (Auteur), 2006, Sind Solvenztests eine Alternative zur bilanziellen Kapitalerhaltung?, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/67233