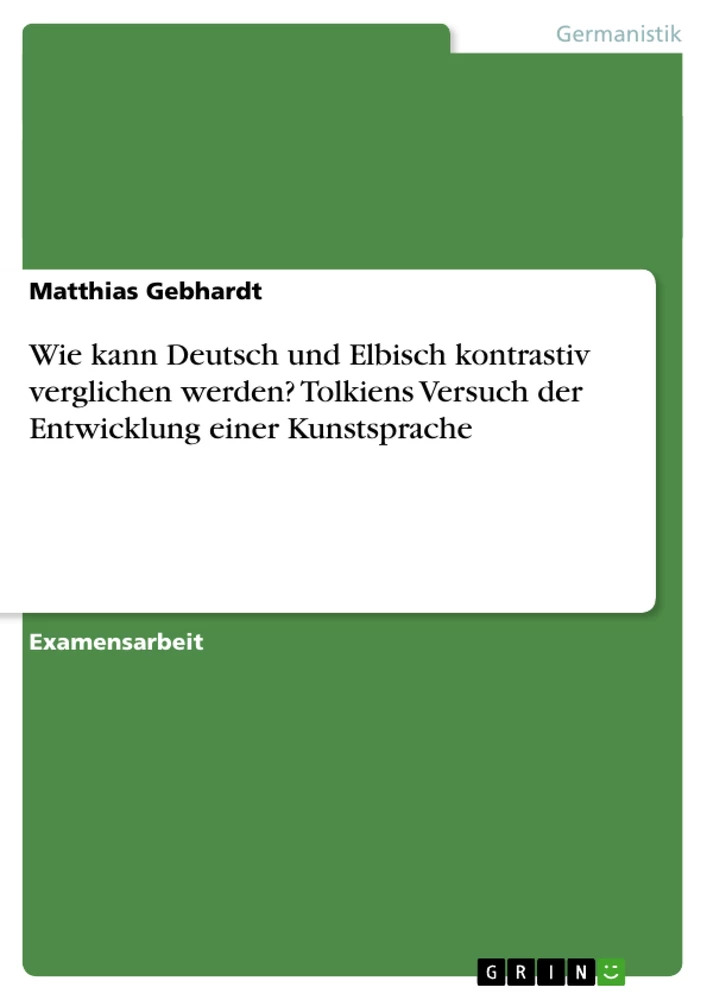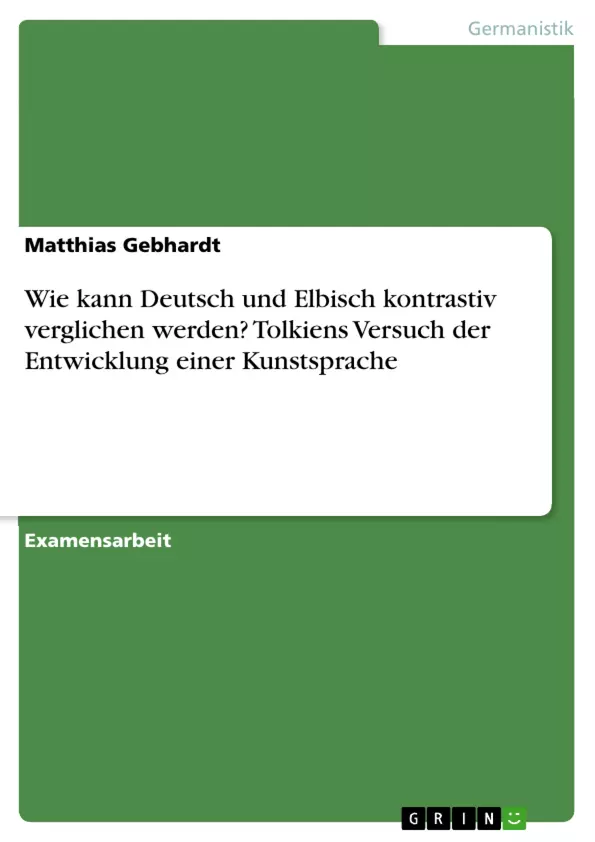Als 2001 die Premiere des Kinoerfolgs „Der Herr der Ringe: Die Gefährten“ in den Kinos anlief, waren elbische Worte, die ersten, die der Kinobesucher vernehmen konnte. So begann einer der erfolgreichsten Fantasyfilme der letzten Jahre mit Worten aus einer Sprache, die den wenigsten Menschen bekannt sein dürfte und die von noch weniger Leuten verstanden, geschweige denn gesprochen wird.
Manchen Kinobesuchern war oder ist nicht bewusst, dass diese Filme auf der Grundlage eines umfassenden literarischen Werkes des englischen Professors John Ronald Reuel Tolkien basieren. Die Geschichten Mittelerdes entstanden Anfang des 20. Jahrhunderts in dem Kopf eines einzelnen, von vielen als genial bezeichneten Mannes. Als 1937 das Buch „The Hobbit“ erschienen war, wurde Tolkien bald gebeten, einen zweiten Teil zu schreiben. Dieses Werk entpuppte sich nicht als Fortsetzung, sondern als eigenständiges Werk von erheblich größerem Umfang, als ursprünglich beabsichtigt: „Der Herr der Ringe“ stieß auf ein begeistertes Publikum, so dass „Der Herr der Ringe“ zum zweit meist gelesenen Buch nach der Bibel avancierte.
Tolkien, der als Sprachwissenschaftler eine große Liebe für Sprachen empfand und selbst eigene Sprachen erdachte, hatte Sprachen im Kopf, die er entwickeln wollte und brauchte eine Welt, in der diese existieren, leben und sich verändern konntent. Es handelt sich bei Tolkiens Sprachen nicht um Phantasiesprachen aus willkürlich zusammengesetzten Wortkonstrukten, sondern um Sprachen mit einer relativ vollständigen Grammatik, einem Wortkorpus, Phonologie und eigener Schrift.
Dank vieler Bemühungen Christopher Tolkiens, sowie verschiedener Schüler und Fans seines Vaters, ist es möglich geworden, das Elbische (Sindarin und Quenya) zu erforschen und sie ein wenig zu erlernen.
Das Ziel dieser Arbeit ist es, auf Basis des literarischen Werkes einen tieferen Einblick in die Kunstsprachen Tolkiens und vor allem in das Elbische (Quenya) zu geben. Um dies zu erreichen, wird zunächst ein umfassender Einblick in Tolkiens literarisches Schaffen und das Werk selbst nötig sein. Anschließend soll das „Quenya“ auf der Ebene der Grammatik dem Deutschen gegenübergestellt werden, um zu zeigen, auf welche Weise beide Sprachen verglichen werden können. Im Verlauf der Betrachtung wird auch der Aspekt „Kunstsprachen“ Beachtung finden und es sollen sich am Ende Überlegungen anschließen, inwiefern Tolkiens „Elbisch“ als Kunstsprache gewertet werden kann.
Inhaltsverzeichnis
- 1 Einleitung
- 2 John Ronald Reuel Tolkien
- 3 Die Völker und Sprachen Mittelerdes
- 3.1 Tolkiens Sprachen
- 3.2 Ab wann ist eine Sprache eine Sprache?
- 3.3 Was ist eine Kunstsprache?
- 3.4 Die Sprachen in Mittelerde
- 3.5 Die Elben
- 3.6 Elbisch – Eine Eingrenzung
- 3.7 Quenya - Die alte Sprache
- 3.7.1 Externe Geschichte des Quenya
- 3.7.2 Interne Geschichte des Quenya
- 3.7.3 Quenya in Tolkiens Werk
- 4 Quenya - Deutsch
- 4.1 Laut und Lautstruktur
- 4.2 Die Schrift
- 4.3 Wortarten
- 4.3.1 Das Verb
- 4.3.2 Das Substantiv
- 4.3.3 Das Adjektiv
- 4.3.4 Der Artikel
- 4.3.5 Die Pronomen
- 4.3.6 Das Adverb
- 4.3.7 Die Partikeln
- 4.3.8 Die Präposition
- 4.3.9 Die Konjunktion
- 4.4 Wortbildung Quenya – Deutsch
- 4.5 Syntax Quenya - Deutsch
- 5 Quenya im Gebrauch
- 6 Zusammenfassung
- 7 Literaturverzeichnis
- 8 Anhang
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Hausarbeit untersucht den kontrastiven Vergleich der von J.R.R. Tolkien entwickelten Kunstsprache Quenya mit dem Deutschen. Ziel ist es, die sprachlichen Strukturen und Besonderheiten des Quenya aufzuzeigen und diese mit den entsprechenden Strukturen des Deutschen zu vergleichen. Die Arbeit beleuchtet Tolkiens Ansatz der Kunstsprachenentwicklung und analysiert verschiedene Aspekte des Quenya, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten.
- Kontrastiver Vergleich von Quenya und Deutsch
- Analyse der sprachlichen Strukturen des Quenya
- Untersuchung von Tolkiens Ansatz der Kunstsprachenentwicklung
- Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Quenya und Deutsch
- Die Rolle der Sprache in Tolkiens Werk
Zusammenfassung der Kapitel
1 Einleitung: Die Einleitung führt in die Thematik ein und stellt den Kontext durch die Verwendung elbischen im Film "Der Herr der Ringe" her. Sie erläutert die Bedeutung von Tolkiens Werk und die Faszination, die seine Sprachen auf die Leser ausüben. Die Einleitung hebt die Komplexität und Ausführlichkeit von Tolkiens Sprachen hervor, im Gegensatz zu den meisten "Phantasiesprachen" in anderen Werken.
2 John Ronald Reuel Tolkien: (Kapitel fehlt im Auszug)
3 Die Völker und Sprachen Mittelerdes: Dieses Kapitel bietet einen Überblick über die verschiedenen Sprachen und Völker in Tolkiens Mittelerde. Es definiert den Begriff der Kunstsprache und untersucht, unter welchen Kriterien eine Sprache als solche gilt. Es konzentriert sich besonders auf die Elbensprache Quenya und deren Einordnung in das Gesamtwerk.
4 Quenya - Deutsch: Dieses Kapitel bildet den Kern der Arbeit und vergleicht detailliert die phonetischen, schriftlichen und grammatischen Strukturen von Quenya und Deutsch. Es untersucht die Laute, die Schriftsysteme (Tengwar), Wortarten (Verb, Substantiv, Adjektiv usw.) und die Wortbildung sowie die Syntax beider Sprachen. Es analysiert die Unterschiede und Gemeinsamkeiten auf allen Ebenen und legt die methodischen Grundlagen für den kontrastiven Vergleich.
5 Quenya im Gebrauch: (Kapitel fehlt im Auszug)
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Kontrastiver Vergleich von Quenya und Deutsch
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den kontrastiven Vergleich der von J.R.R. Tolkien entwickelten Kunstsprache Quenya mit dem Deutschen. Das Ziel ist es, die sprachlichen Strukturen und Besonderheiten des Quenya aufzuzeigen und diese mit den entsprechenden Strukturen des Deutschen zu vergleichen. Die Arbeit beleuchtet Tolkiens Ansatz der Kunstsprachenentwicklung und analysiert verschiedene Aspekte des Quenya, um Gemeinsamkeiten und Unterschiede herauszuarbeiten.
Welche Themen werden in der Arbeit behandelt?
Die Arbeit behandelt folgende Themen: Kontrastiver Vergleich von Quenya und Deutsch; Analyse der sprachlichen Strukturen des Quenya; Untersuchung von Tolkiens Ansatz der Kunstsprachenentwicklung; Gemeinsamkeiten und Unterschiede zwischen Quenya und Deutsch; Die Rolle der Sprache in Tolkiens Werk. Insbesondere werden phonetische, schriftliche und grammatische Strukturen verglichen, einschließlich der Laute, Schriftsysteme (Tengwar), Wortarten (Verb, Substantiv, Adjektiv usw.), Wortbildung und Syntax beider Sprachen.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit umfasst (zumindest im Auszug) die Kapitel: 1. Einleitung, 2. John Ronald Reuel Tolkien (im Auszug fehlt), 3. Die Völker und Sprachen Mittelerdes, 4. Quenya - Deutsch, 5. Quenya im Gebrauch (im Auszug fehlt), 6. Zusammenfassung, 7. Literaturverzeichnis, 8. Anhang. Kapitel 3 bietet einen Überblick über die Sprachen und Völker Mittelerdes, definiert Kunstsprachen und konzentriert sich auf Quenya. Kapitel 4 bildet den Kern der Arbeit mit dem detaillierten Vergleich von Quenya und Deutsch.
Wie wird der Vergleich von Quenya und Deutsch durchgeführt?
Der Vergleich in Kapitel 4 erfolgt detailliert auf verschiedenen Ebenen: Laut- und Lautstruktur, Schrift (Tengwar), Wortarten (mit Unterkapiteln zu Verb, Substantiv, Adjektiv, Artikel, Pronomen, Adverb, Partikeln, Präposition und Konjunktion), Wortbildung und Syntax. Es werden sowohl Gemeinsamkeiten als auch Unterschiede analysiert, um einen umfassenden kontrastiven Vergleich zu ermöglichen.
Was ist die Zielsetzung der Arbeit?
Die Zielsetzung ist es, einen umfassenden kontrastiven Vergleich zwischen Quenya und Deutsch durchzuführen, um die sprachlichen Besonderheiten von Quenya aufzuzeigen und diese im Kontext des Deutschen zu beleuchten. Dies beinhaltet auch die Analyse von Tolkiens Ansatz bei der Entwicklung von Kunstsprachen.
Welche Rolle spielt J.R.R. Tolkien in dieser Arbeit?
J.R.R. Tolkien ist der Schöpfer der Kunstsprache Quenya. Die Arbeit untersucht seinen Ansatz bei der Entwicklung von Kunstsprachen und analysiert, wie seine Ideen und Methoden sich in der Struktur und den Besonderheiten von Quenya niederschlagen. Ein eigenes Kapitel (Kapitel 2) ist ihm gewidmet, ist aber im vorliegenden Auszug nicht enthalten.
Wie ist die Arbeit aufgebaut?
Die Arbeit beginnt mit einer Einleitung, die den Kontext und die Bedeutung von Tolkiens Werk und seinen Sprachen darstellt. Es folgt ein Kapitel über Tolkien selbst (im Auszug fehlt), dann ein Kapitel über die Völker und Sprachen Mittelerdes mit Fokus auf Quenya. Der Hauptteil besteht aus dem detaillierten Vergleich von Quenya und Deutsch. Die Arbeit schließt mit einer Zusammenfassung, Literaturverzeichnis und Anhang.
- Citar trabajo
- Matthias Gebhardt (Autor), 2006, Wie kann Deutsch und Elbisch kontrastiv verglichen werden? Tolkiens Versuch der Entwicklung einer Kunstsprache, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/67260