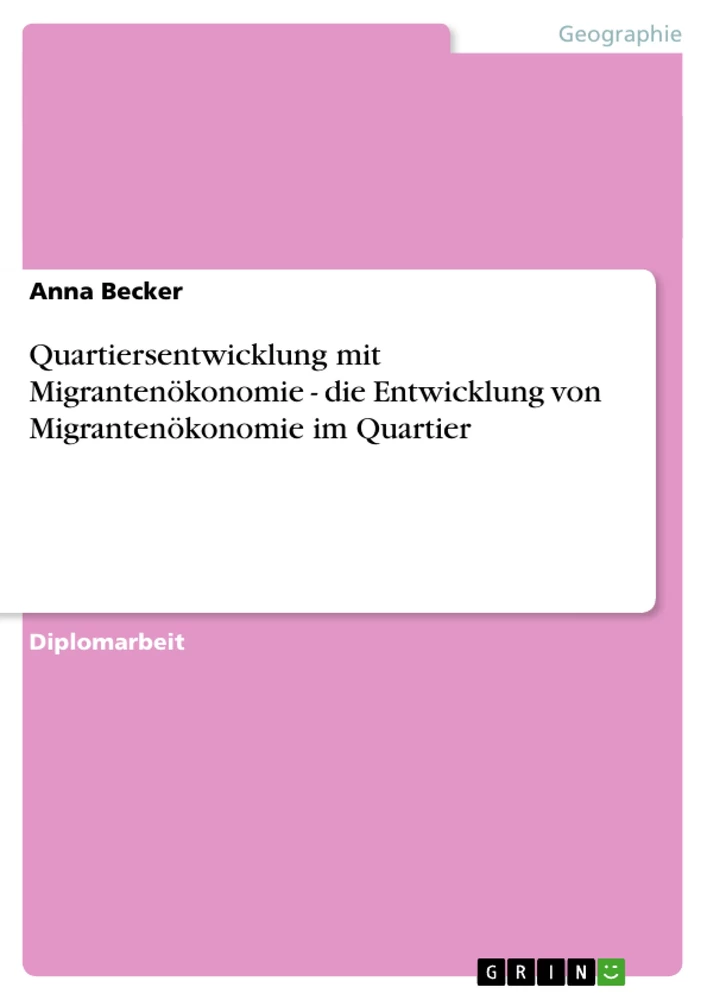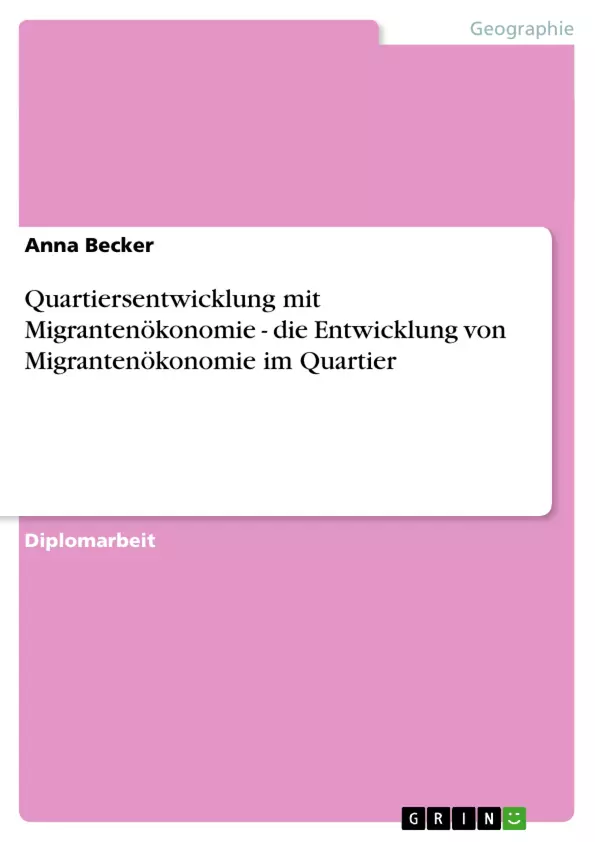Die Planungspolitik in Deutschland ist zu Beginn des 21. Jahrhunderts vor zwei zentrale Herausforderungen gestellt: Die Verfestigung hoher struktureller Arbeitslosigkeit und die wachsende soziale und kulturelle Heterogenität der Bevölkerung.
Der im Juni 2006 vorgelegte Bericht der UNO dokumentiert, dass jeder fünfte Mensch in Deutschland einen Migrationshintergrund aufweist. Mit dem am 01.01.2005 in Kraft getretenen Zuwanderungsgesetz wurde die Zuwanderung nach Deutschland erstmals rechtlich geregelt und sich von politischer Seite zu Deutschland als einem Einwanderungsland bekannt. Zurzeit leben knapp 9% ausländische Staatsbürger in Deutsch-land, die überwiegend in den städtischen Ballungsräumen in Westdeutschland ansässig sind.
Der Wandel von der Industrie- zur Dienstleistungsgesellschaft und den Folgen der Globalisierung geht mit einer tief greifenden Umstrukturierung der nationalen Wirtschaft einher. Den neu entstehenden Arbeitsplätzen im hochqualifizierten Bereich stehen die freigesetzten Arbeitsplätze im industriellen Bereich sowie eine Vielzahl an unregelmäßigen und prekären Arbeitsverhältnissen gegenüber. Die Migranten sind gegenüber dem Durchschnitt der deutschen Bevölkerung besonders stark von Arbeitslosigkeit und prekärer Beschäftigung betroffen. Durch den Rückzug der öffentlichen Hand aus der Regulierung des Wohnungsmarktes überlagern sich die Probleme der hohen Arbeitslosigkeit mit der hohen Konzentration von Migranten auf der Ebene des Quartiers. Damit sind besondere Herausforderungen für die Quartiersentwicklung in den Bereichen der sozialen und ökonomischen Integration, der Sicherung von Infrastruktur und Versorgung und der Bekämpfung von Armut, Arbeitslosigkeit und Ausgrenzung auf Quartiersebene entstanden.
Bei der Auseinandersetzung mit den Problemstellungen wurden die Stadtteil- und Quartiersbetriebe als Akteure entdeckt, um strukturelle Verbesserungen vor Ort herbeiführen zu können. In jüngerer Zeit sind besonders die Migrantenökonomien in den Mittelpunkt des Interesses gerückt, da sie die Schnittstelle zwischen Mehrheitsgesellschaft und Migranten sowie zwischen Erwerbslosigkeit und Beschäftigung darstellen.
Inhaltsverzeichnis
- EINFÜHRUNG
- Einleitung
- Erkenntnisinteresse und Ziel der Arbeit
- Aufbau der Arbeit
- Methodisches Vorgehen
- Literatur- und Internetrecherche
- Medienanalyse
- Experteninterviews
- Unternehmensbefragung
- Qualitative und quantitative Kartierung
- A. Theorie
- 1. MIGRANTENÖKONOMIE ZWISCHEN NISCHE UND MARKT
- 1.1. Bedeutungsgewinn der Migrantenökonomie
- 1.2. strukturelle Merkmale und Besonderheiten
- 1.3. Definition und Begriffsabgrenzung
- 1.4. Entstehungstheorien und Erklärungsansätze
- 1.5. Bewertung der Entstehungstheorien und Erklärungsansätze
- 2. QUARTIERSENTWICKLUNG
- 2.1. Das Quartier als „gesellschaftlicher Raum“
- 2.2. Das Quartier als Ort von „Milieus“
- 2.2.1. Das Milieu in der Ökonomie
- 2.3. Quartiersentwicklung durch Segregation
- 2.3.1. Mechanismen der Segregation
- 2.4. Prozesse der Quartiersentwicklung
- 2.4.1. Gentrifizierung
- 2.4.2. Marginalisierung
- 2.4.3. Die Entstehung „Ethnischer Kolonien“
- 2.5. Die Stadt als Ort der Integration?
- 2.6. Resümee
- 3. STADTTEIL- UND QUARTIERSBETRIEBE
- 3.1. Das Konzept der städtischen Teilökonomien
- 3.2. Arbeitswelten der Stadtteil- und Quartiersbetriebe: „Gemeinschaften, Gesellschaften, Partnerschaften“
- 3.2.1. Bedeutung des Quartiers für Stadtteilbetriebe
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit der Entwicklung von Migrantenökonomie im Quartier. Sie untersucht die wechselseitige Beeinflussung von Quartiersentwicklung und lokal eingebetteter Ökonomie am Beispiel migrantischer Stadtteil- und Quartiersbetriebe.
- Die Bedeutung der Migrantenökonomie in der heutigen Gesellschaft
- Die strukturellen Merkmale und Besonderheiten der Migrantenökonomie
- Die Prozesse der Quartiersentwicklung und ihre Auswirkungen auf die Migrantenökonomie
- Die Rolle von Stadtteil- und Quartiersbetrieben in der Migrantenökonomie
- Die Herausforderungen und Chancen der Integration von Migrantenökonomie in die Gesamtgesellschaft
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung führt in das Thema der Arbeit ein und definiert das Erkenntnisinteresse sowie das Ziel der Arbeit. Sie erläutert das methodische Vorgehen, das sich auf Literatur- und Internetrecherche, Medienanalyse, Experteninterviews, Unternehmensbefragung und qualitative sowie quantitative Kartierung stützt. Das erste Kapitel befasst sich mit der Migrantenökonomie, ihren Entstehungsgründen und ihrer Bedeutung im Vergleich zum „Mainstream-Markt“. Es beleuchtet die strukturellen Merkmale und Besonderheiten der Migrantenökonomie und analysiert verschiedene Entstehungstheorien und Erklärungsansätze. Im zweiten Kapitel wird der Begriff der Quartiersentwicklung aus verschiedenen Perspektiven betrachtet. Es geht auf die Bedeutung des Quartiers als „gesellschaftlicher Raum“ und „Ort von Milieus“ ein und analysiert die Entstehung von Segregation und die damit verbundenen Mechanismen. Zudem werden die Prozesse der Gentrifizierung, Marginalisierung und der Entstehung „Ethnischer Kolonien“ im Kontext der Quartiersentwicklung untersucht. Das dritte Kapitel fokussiert auf Stadtteil- und Quartiersbetriebe als zentrale Akteure in der Migrantenökonomie. Es beleuchtet das Konzept der städtischen Teilökonomien und analysiert die Bedeutung des Quartiers für Stadtteilbetriebe.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit den Themen Migrantenökonomie, Quartiersentwicklung, Stadtteil- und Quartiersbetriebe, Segregation, Integration, städtische Teilökonomien, Milieus, Gentrifizierung, Marginalisierung, Ethnische Kolonien.
Häufig gestellte Fragen
Was versteht man unter Migrantenökonomie?
Es bezeichnet die wirtschaftliche Tätigkeit von Menschen mit Migrationshintergrund, oft in Form von lokal eingebetteten Stadtteil- und Quartiersbetrieben.
Warum ist die Migrantenökonomie für die Quartiersentwicklung wichtig?
Sie fungiert als Schnittstelle zwischen Mehrheitsgesellschaft und Migranten und schafft Arbeitsplätze in Gebieten mit hoher Arbeitslosigkeit.
Welche Rolle spielt die Segregation?
Segregation führt zu einer Konzentration von Migranten in bestimmten Quartieren, was einerseits soziale Herausforderungen birgt, andererseits aber „ethnische Kolonien“ als Wirtschaftsraum entstehen lässt.
Was ist Gentrifizierung im Kontext dieser Arbeit?
Gentrifizierung ist ein Prozess der Quartiersentwicklung, bei dem die Aufwertung eines Viertels zur Verdrängung einkommensschwacher Bevölkerungsgruppen führen kann.
Wie wurden die Daten für diese Arbeit erhoben?
Die Methodik umfasst Literaturrecherche, Experteninterviews, Unternehmensbefragungen sowie qualitative und quantitative Kartierungen vor Ort.
- Quote paper
- Anna Becker (Author), 2006, Quartiersentwicklung mit Migrantenökonomie - die Entwicklung von Migrantenökonomie im Quartier, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/67396