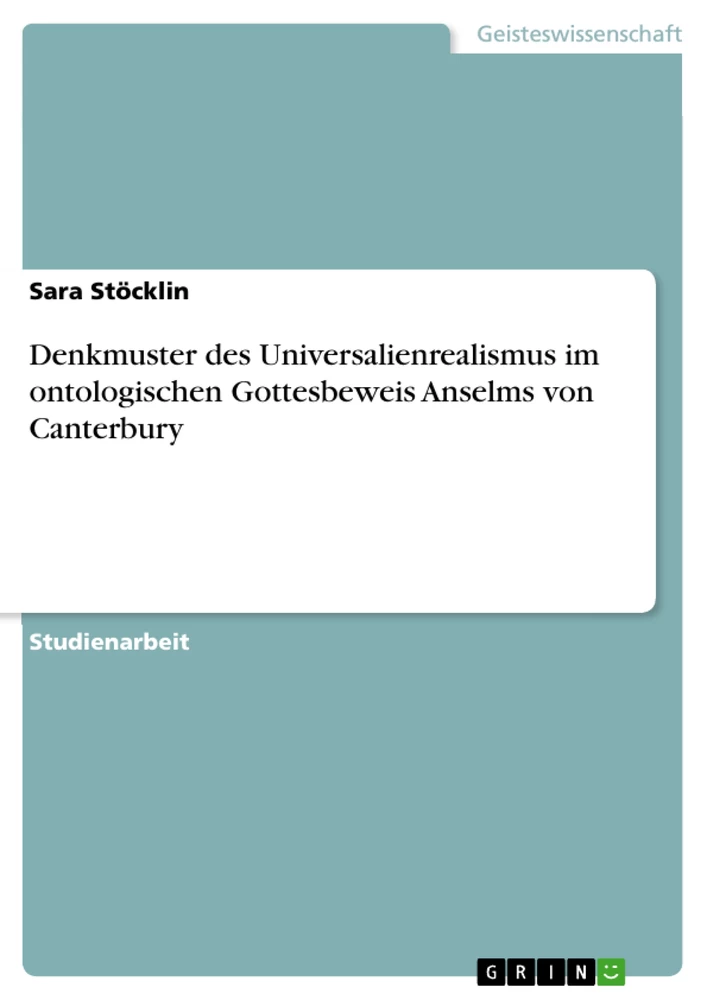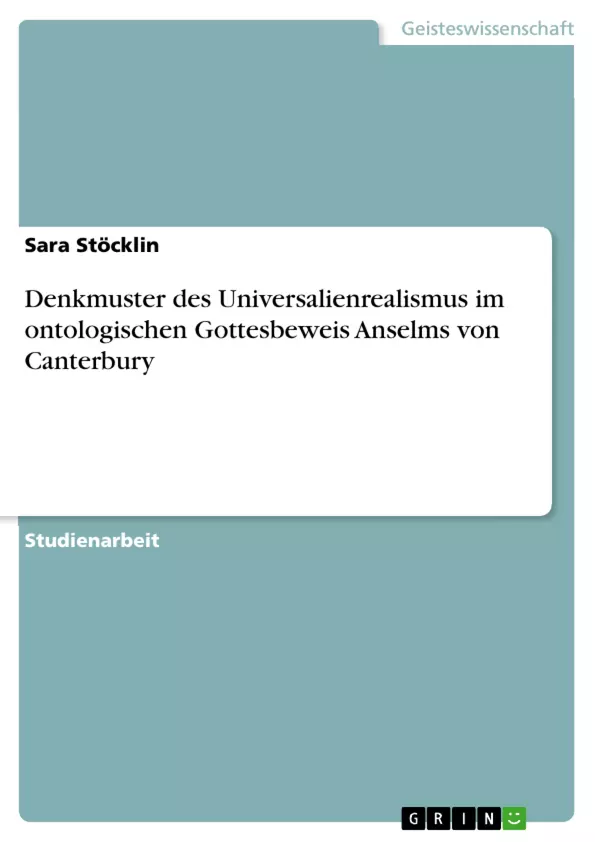Anselm von Canterbury hat um das Jahr 1080 in nur zwei Kapiteln seines Werkes „Proslogion“ einen Gottesbeweis aufgestellt, der Philosophiegeschichte geschrieben hat. Philosophen wie Décartes, Leibniz, Kant oder Hegel haben es sich zur Aufgabe gemacht, ihn zu bestätigen oder zu widerlegen. In der folgenden Arbeit möchte ich den von Kant „ontologisch“ genannten Gottesbeweis Anselms rekonstruieren und in seiner Zeit und seinem theologischen Umfeld verorten. Dabei werde ich mich weniger mit der formal-logischen Struktur des Arguments auseinandersetzen, sondern die philosophischen, zeit- und umwelt-bedingten Denkmuster dahinter zu erkennen versuchen.
Anselm, dessen Wirken vor allem die zweite Hälfte des 11. Jahrhunderts umfasste, lebte in einer Zeit, in der nach vielen Jahrhunderten relativ starrer Überlieferung theologischer Glaubensinhalte durch das Mönchstum wieder neue intellektuelle Impulse vom Klerus ausgingen. Er erlebte zwei der grössten theologischen Auseinandersetzungen des Mittelalters, den Investiturstreit und den Universalienstreit, und beteiligte sich aktiv an beiden Debatten. Während der Investiturstreit, bei dem es um den Anspruch von kirchlichen und weltlichen Obrigkeiten auf die Amtseinsetzung von Geistlichen ging, eher das Handeln Anselms prägte, hatte der Universalienstreit, bei dem das Verhältnis zwischen allgemeinen Begriffen und der Wirklichkeit diskutiert wurde, starken Einfluss auf sein philosophisches Denken. Ob dieser Einfluss so stark war, dass er sich auch im Gottesbeweis niederschlug, soll Gegenstand der folgenden Untersuchung sein.
Unumstritten ist, dass Anselm trotz seiner Originalität wie alle Denker ein Kind seiner Zeit war. Sein Umfeld und die aktuellen theologisch-philosophischen Diskurse, an denen er teilnahm, prägten sein Weltbild und waren immer Teil der bewussten oder unbewussten Prämissen seiner Argumentation. Es wird deshalb im ersten Teil der vorliegenden Arbeit auf Anselms Leben, Werk und Denken eingegangen, bevor der Gottesbeweis rekonstruiert wird, und im zweiten Teil das Grundproblem und die Positionen des Universalienstreits erläutert, welche Anselm prägten und welche er prägte. In einem dritten Teil wird versucht, die verschiedenen Puzzlesteine zusammenzufügen und die aus Anselms philosophisch-theologischer Disposition hervorgehenden Denkvoraussetzungen im ontologischen Gottesbeweis nachzuweisen.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Anselm von Canterbury
- Leben und Werk
- War Anselm Theologe oder Philosoph?
- Der Gottesbeweis in Proslogion II/III
- Der Universalienstreit
- Thema und Ursprung des Universalienstreits
- Position des Realismus
- Position des Nominalismus
- Anselm als Universalienrealist
- Anselms Haltung im Universalienstreit
- Denkmuster des Realismus im Gottesbeweis
- Schluss
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die vorliegende Arbeit befasst sich mit dem ontologischen Gottesbeweis Anselms von Canterbury, der in seinem Werk „Proslogion“ erstmals formuliert wurde. Ziel ist es, den Gottesbeweis in seiner Zeit und seinem theologischen Umfeld zu verorten, ohne seine formal-logische Struktur im Vordergrund zu betrachten. Stattdessen stehen die philosophischen Denkmuster, die den Gottesbeweis prägten, im Zentrum der Untersuchung.
- Rekonstruktion des ontologischen Gottesbeweises
- Einfluss des Universalienstreits auf Anselms Denken
- Bedeutung der aristotelisch-boethianischen Dialektik für Anselm
- Anselms Verbindung von Glaube und Vernunft
- Die Rolle des Universalienrealismus im Gottesbeweis
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel der Arbeit führt in die Thematik ein und stellt den Kontext des Gottesbeweises dar. Es werden Anselms Leben, Werk und Denken beleuchtet sowie die Bedeutung seines Gottesbeweises in der Geschichte der Philosophie hervorgehoben. Das zweite Kapitel widmet sich dem Universalienstreit, der Anselms Denken prägte. Es werden die Positionen des Realismus und des Nominalismus dargestellt sowie Anselms eigene Haltung im Streit um die Frage nach der Existenz von allgemeinen Begriffen erläutert. Im dritten Kapitel wird Anselm als Universalienrealist vorgestellt und der Einfluss des Realismus auf den Gottesbeweis analysiert. Es werden die Denkmuster des Realismus in Anselms Argumentation aufgezeigt und ihre Bedeutung für die Konstruktion des Gottesbeweises herausgestellt.
Schlüsselwörter
Ontologischer Gottesbeweis, Anselm von Canterbury, Universalienrealismus, Universalienstreit, Glaube und Vernunft, Proslogion, aristotelisch-boethianische Dialektik, mittelalterliche Philosophie, theologische Diskurse.
Häufig gestellte Fragen zu Anselms ontologischem Gottesbeweis
Was ist der Kern von Anselms ontologischem Gottesbeweis?
Anselm definiert Gott als das, "worüber hinaus nichts Größeres gedacht werden kann". Er argumentiert, dass etwas, das sowohl im Verstand als auch in der Realität existiert, größer ist als etwas, das nur im Verstand existiert.
Was ist "Universalienrealismus"?
Eine philosophische Position, die besagt, dass Allgemeinbegriffe (Universalien) eine eigene, reale Existenz besitzen und nicht bloße Namen sind.
Wie beeinflusste der Universalienstreit Anselms Gottesbeweis?
Als Realist ging Anselm davon aus, dass Begriffe eine Entsprechung in der Wirklichkeit haben müssen, was die Grundlage für seinen Schluss von der Idee Gottes auf dessen Existenz bildete.
In welchem Werk findet man diesen Gottesbeweis?
Anselm formulierte ihn in den Kapiteln II und III seines Werkes "Proslogion" (um 1080).
War Anselm eher Theologe oder Philosoph?
Er verband beide Disziplinen ("fides quaerens intellectum" – der Glaube, der nach Einsicht sucht) und nutzte die Vernunft (Dialektik), um Glaubenswahrheiten zu begründen.
Welche Denker setzten sich später mit seinem Beweis auseinander?
Bedeutende Philosophen wie Descartes, Leibniz, Kant und Hegel haben Anselms Argument entweder bestätigt, weiterentwickelt oder kritisch zu widerlegen versucht.
- Quote paper
- Sara Stöcklin (Author), 2006, Denkmuster des Universalienrealismus im ontologischen Gottesbeweis Anselms von Canterbury, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/67557