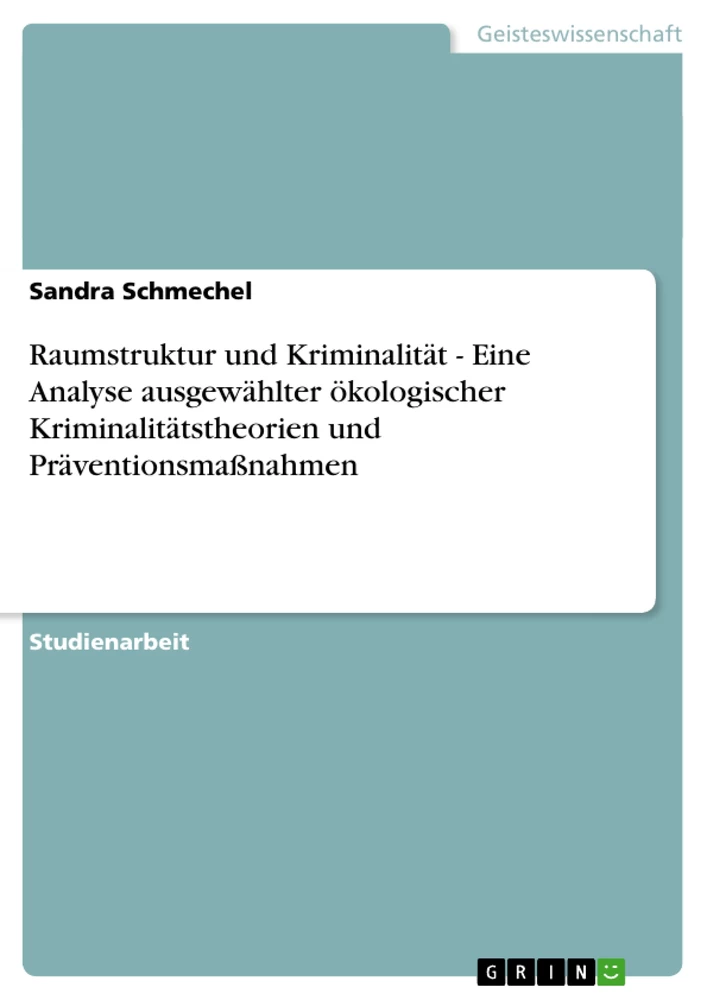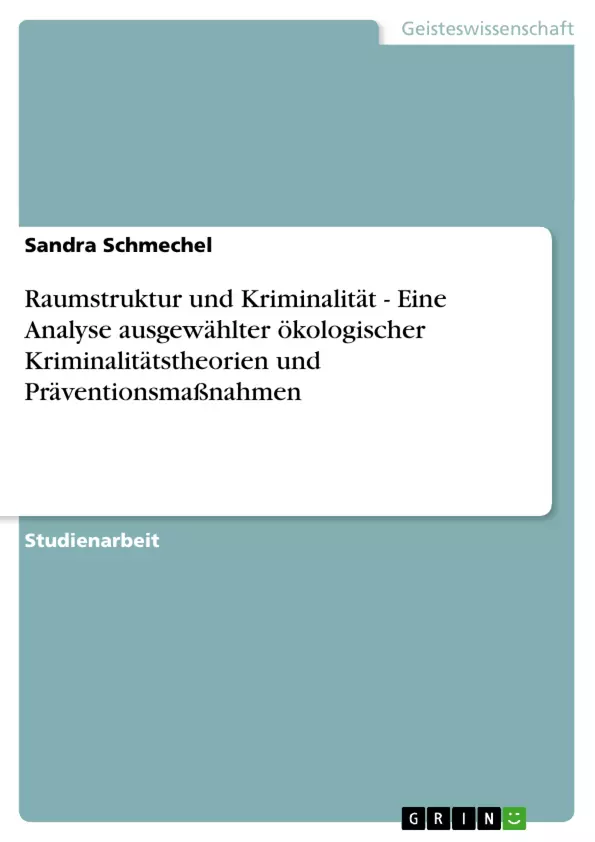Aus den aktuellen Entwicklungen der sicherheitspolitischen Kriminalitätsprävention geht hervor, dass sich die kriminologische Forschung zunehmend wieder mit dem Einfluss der Wohnumwelt auf die Kriminalitätsentwicklung beschäftigt. Im Hinblick auf die Eindämmung der Jugendkriminalität wird der Stadtplanung dabei eine präventive Rolle zugeschrieben. Die vorliegende Arbeit befasst sich aus diesem Anlass mit ökologischen Ansätzen, die zur Erklärung von erhöhtem Kriminalitätsaufkommen in bestimmten Stadtteilen und -vierteln herangezogen werden können, sowie mit Präventionsstrategien, die als Reaktion auf solche Ansätze entwickelt wurden. Überprüft werden soll die These, dass die Struktur des Raumes als Begründung für abweichendes Verhalten (Delinquenz) bei Jugendlichen nicht ausreichend ist. Dabei soll analysiert werden, welche Reichweite die ökologischen Ansätze für die Erklärung der (Jugend-) Kriminalität haben und wie erfolgreich demnach Präventionsstrategien (wie z.B. die „Zero- Tolerance“ Strategie)sein können, die sich ausschließlich auf die Erkenntnisse der ökologischen Kriminalitätstheorien stützen. Dafür sollen ökologische Kriminalitätstheorien wie der Desorganisationsansatz von SHAW und MCKAY, die broken window Theorie von WILSON und KELLING und der defensible space Ansatz von NEWMANN zunächst vorgestellt werden. Dies impliziert eine Betrachtung der ihnen vorangegangenen Untersuchungen und der Daten auf denen ihre Annahmen beruhen, sowie ihrer Grenzen. Neben ihren Begrenzungen sollen ihre durchaus anwendbaren Erkenntnisse und Anstöße für die Kriminalitätsprävention Beachtung finden. Diskutiert wird darüber hinaus eine mögliche Erweiterung dieser Ansätze. Im Anschluss daran sollen zwei Präventionsstrategien vorgestellt werden, die exemplarisch für die aus den ökologischen Ansätzen hervorgegangenen Präventionsmaßnahmen stehen. Abschließend erfolgt die Auswertung der Möglichkeiten und eventuellen Ergänzungen dieser Konzepte. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung
- 2. Ökologische Ansätze und ihre Grenzen
- 2.1. Datenerhebungen der ökologischen Analysen
- 2.2. Theorieentwicklung auf der Basis ökologischer Analysen
- 2.2.1. Der Desorganisationsansatz von SHAW und MCKAY
- 2.2.2. Der defensible space Ansatz von NEWMANN
- 2.2.3. Die broken window Theorie von WILSON und KELLING
- 3. Zusammenfassung der Grenzen und Möglichkeiten ökologischer Theorien
- 4. Anwendbarkeit von ökologischen Kriminalitätstheorien. – Entwicklung von Präventionsstrategien
- 4.1. Präventive Stadtplanung nach dem defensible space Ansatz
- 4.2. Zero Tolerance Strategie
- 5. Votum
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht den Einfluss von Raumstrukturen auf Kriminalität, insbesondere Jugendkriminalität. Sie analysiert ökologische Kriminalitätstheorien und deren Anwendbarkeit auf Präventionsstrategien. Das Hauptziel ist die Überprüfung der These, dass Raumstruktur allein keine ausreichende Erklärung für abweichendes Verhalten darstellt.
- Ökologische Ansätze zur Erklärung von Kriminalität
- Grenzen und Möglichkeiten ökologischer Kriminalitätstheorien
- Präventionsstrategien basierend auf ökologischen Ansätzen (z.B. "Zero Tolerance")
- Bewertung der Effektivität ökologisch-basierter Präventionsmaßnahmen
- Analyse der Datenbasis ökologischer Kriminalitätsforschung
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung: Die Einleitung beschreibt den Fokus der Arbeit auf den Einfluss der Wohnumwelt auf die Kriminalitätsentwicklung, insbesondere Jugendkriminalität, und die präventive Rolle der Stadtplanung. Die Arbeit untersucht ökologische Ansätze zur Erklärung erhöhten Kriminalitätsaufkommens in bestimmten Stadtteilen und evaluiert darauf basierende Präventionsstrategien. Die zentrale These hinterfragt die alleinige Relevanz von Raumstrukturen als Begründung für abweichendes Verhalten. Die Arbeit kündigt die Vorstellung ökologischer Theorien (Desorganisationsansatz, defensible space, broken windows) und die Analyse exemplarischer Präventionsstrategien an.
2. Ökologische Ansätze und ihre Grenzen: Dieses Kapitel analysiert die Datenerhebungsmethoden ökologischer Analysen, differenziert zwischen deskriptiven und erklärenden Ansätzen und beschreibt die Kriminalgeographie/Kriminalökologie als soziologischen Ansatz, der geographische Daten zur Erklärung von Kriminalität heranzieht. Es betont die Verwendung von Daten über Stadtbezirke und nicht über einzelne Täter. Der Fokus liegt auf der Beschreibung und Kritik der Datengrundlagen und der daraus abgeleiteten Theorien.
4. Anwendbarkeit von ökologischen Kriminalitätstheorien. – Entwicklung von Präventionsstrategien: Dieses Kapitel behandelt die Anwendung ökologischer Kriminalitätstheorien auf die Entwicklung von Präventionsstrategien. Es werden exemplarisch zwei Strategien vorgestellt: Präventive Stadtplanung nach dem "defensible space" Ansatz und die "Zero Tolerance" Strategie. Der Fokus liegt auf der praktischen Umsetzung und der Bewertung der Effektivität der Strategien basierend auf den vorgestellten ökologischen Theorien.
Schlüsselwörter
Ökologische Kriminalitätstheorien, Raumstruktur, Kriminalität, Jugendkriminalität, Prävention, Stadtplanung, Desorganisationsansatz, defensible space, broken windows Theorie, Zero Tolerance Strategie, Kriminalgeographie, Kriminalökologie.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu: Einfluss von Raumstrukturen auf Kriminalität
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht den Einfluss von Raumstrukturen, insbesondere der Wohnumwelt, auf die Entstehung von Kriminalität, vor allem Jugendkriminalität. Sie analysiert verschiedene ökologische Kriminalitätstheorien und deren Anwendbarkeit auf die Entwicklung von Präventionsstrategien. Ein zentrales Thema ist die Frage, inwieweit Raumstruktur allein als Erklärung für abweichendes Verhalten ausreicht.
Welche ökologischen Kriminalitätstheorien werden behandelt?
Die Arbeit befasst sich mit dem Desorganisationsansatz von Shaw und McKay, dem defensible space Ansatz von Newman und der broken windows Theorie von Wilson und Kelling. Diese Theorien werden im Detail vorgestellt, kritisch analysiert und hinsichtlich ihrer Anwendbarkeit auf Präventionsstrategien bewertet.
Wie werden die Daten in der ökologischen Kriminalitätsforschung erhoben und verwendet?
Das Dokument beschreibt die Datenerhebungsmethoden ökologischer Analysen. Es wird darauf hingewiesen, dass im Fokus geographische Daten über Stadtbezirke und nicht über einzelne Täter stehen. Die Arbeit analysiert die Grenzen und Möglichkeiten, die sich aus dieser Datenbasis ergeben.
Welche Präventionsstrategien werden im Zusammenhang mit ökologischen Ansätzen diskutiert?
Die Arbeit behandelt exemplarisch zwei Strategien: Präventive Stadtplanung basierend auf dem "defensible space" Ansatz und die "Zero Tolerance" Strategie. Die praktische Umsetzung und die Effektivität dieser Strategien werden im Hinblick auf die vorgestellten ökologischen Theorien bewertet.
Welche Schlussfolgerung zieht die Arbeit bezüglich der Relevanz von Raumstrukturen für Kriminalität?
Die zentrale These der Arbeit hinterfragt die alleinige Relevanz von Raumstrukturen als Begründung für abweichendes Verhalten. Obwohl die ökologischen Theorien und Präventionsstrategien ausführlich behandelt werden, wird die These der unzureichenden Erklärungskraft der Raumstruktur allein untersucht und wahrscheinlich im Votum begründet.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt der Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Ökologische Kriminalitätstheorien, Raumstruktur, Kriminalität, Jugendkriminalität, Prävention, Stadtplanung, Desorganisationsansatz, defensible space, broken windows Theorie, Zero Tolerance Strategie, Kriminalgeographie, Kriminalökologie.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in folgende Kapitel: 1. Einführung, 2. Ökologische Ansätze und ihre Grenzen, 3. Zusammenfassung der Grenzen und Möglichkeiten ökologischer Theorien, 4. Anwendbarkeit von ökologischen Kriminalitätstheorien. – Entwicklung von Präventionsstrategien, 5. Votum.
Wo finde ich detailliertere Informationen zu den einzelnen Theorien und Strategien?
Detaillierte Informationen zu den einzelnen ökologischen Ansätzen (Desorganisationsansatz, defensible space, broken windows Theorie) und den Präventionsstrategien (präventive Stadtplanung nach defensible space und Zero Tolerance Strategie) finden sich in den jeweiligen Kapiteln der Arbeit.
- Quote paper
- Sandra Schmechel (Author), 2006, Raumstruktur und Kriminalität - Eine Analyse ausgewählter ökologischer Kriminalitätstheorien und Präventionsmaßnahmen, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/67574