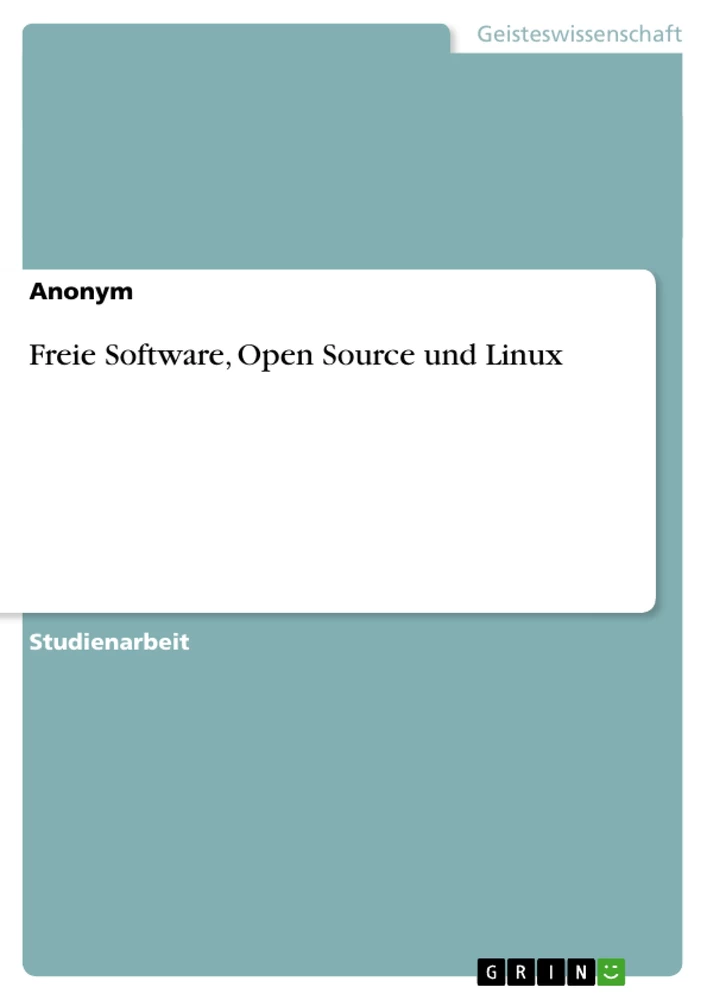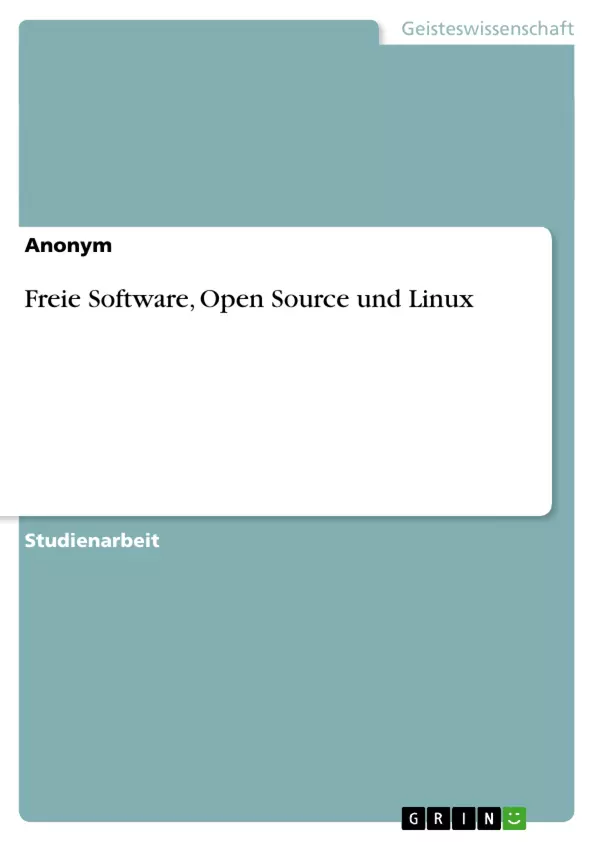Bei der vorliegenden Arbeit handelt es sich um die Ausarbeitung eines Referats, welches von den Autoren im Rahmen der Lehrveranstaltung „Soziologie und politische Ökonomie des Internet“, die unter Leitung von Dr. Ulrich Dolata im Sommersemester 2004 an der Universität Bremen stattfand, gehalten wurde. Es soll im Folgenden der Versuch gemacht werden, einen Einblick zu gewähren, in die Sphäre der Open Source Software (im folgenden auch kurz OSS) bzw. Free Software. Begonnen wird mit einer grundlegenden Einführung zu informationstechnischen (Kapitel 2: Quellcode und Objektcode) und rechtlichen Belangen (Kapitel 3: Free Software und Open Source Software). Anschließend wird Open Source Software aus der Benutzerperspektive beleuchtet (Kapitel 4), dabei wird sowohl auf ideologische Beweggründe von Benutzern, wie auch auf den Einsatz von OSS im Vergleich zu proprietärer Software beispielsweise in der Bürolandschaft eingegangen. Ökonomische Aspekte werden größtenteils in den Kapiteln 5 und 6 herausgearbeitet, wobei in Kapitel 5 anhand einer allgemeinen Software-Value-Chain Geschäftsmodelle mit proprietärer Software und OSS vorgestellt werden. In Kapitel 6 folgt eine Beschreibung der ökonomisch relevanten Akteure rund um OSS in ihrem Verhältnis zuein-ander, außerdem wird hier versucht, sowohl eine Akteurskonstellation wie auch einen Ausblick zu skizzieren. Das Kapitel 7 ist dem Softwarepatent gewidmet, welches im direkten Zusammenhang mit der Zukunft der Open Source Bewegung steht. [...]
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- Quellcode und Objektcode
- Programmiersprachen
- Die Unumkehrbarkeit des Übersetzens
- Free-Software und Open-Source-Software
- Proprietäre Software
- Freie Lizenzen
- Die BSD-Lizenz
- Die GNU General Public License (GPL)
- Free Software versus Open Source Software
- Linux Userperspektive
- OSS als Projekttionsfläche von Idealen
- Ideologischer Diskurs
- Bildungsbereich / Wissensallmende
- OSS in Nicht-G8-Länder
- OSS in der ökonomischen Nutzung
- Kosteneinsparung
- Systemadministration
- Implementierung
- Kooperative Hilfe
- OSS als Projekttionsfläche von Idealen
- Geschäftsmodell „Free Software / Open Source Software“
- Allgemeine Software-Value-Chain
- Geschäftsmodelle mit proprietärer Software
- Geschäftsmodelle mit Open-Source-Software
- Akteure und Akteurskonstellation
- Akteure
- Entwicklergemeinde
- Hardwarehersteller
- Aktuelle Entwicklungen
- Wirtschaftliche Motivation
- Softwareproduktion
- Aktuelle Entwicklungen
- Microsoft / Initiative for Software Choice
- IT-Dienstleister
- Kunden
- Staatliche Einrichtungen
- Akteurskonstellation
- Ausblick
- Akteure
- Das Softwarepatent
- Definition
- Koexistenz von Urheberrecht und Softwarepatent
- Trivialpatente
- Volkswirtschaftliche Auswirkungen
- Der europäische Mittelstand
- Zukunft von OSS?
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit bietet einen Einblick in die Welt der Open Source Software (OSS) und Free Software. Ziel ist es, die technischen, rechtlichen und ökonomischen Aspekte von OSS zu beleuchten und die verschiedenen Akteure und deren Konstellationen zu analysieren. Die Arbeit betrachtet OSS sowohl aus der Benutzerperspektive als auch aus der Perspektive der Geschäftsmodelle.
- Technische Grundlagen von Quellcode und Objektcode
- Rechtliche Rahmenbedingungen freier Softwarelizenzen
- Ökonomische Aspekte und Geschäftsmodelle von OSS
- Die Rolle verschiedener Akteure im OSS-Ökosystem
- Die Auswirkungen von Softwarepatenten auf die OSS-Bewegung
Zusammenfassung der Kapitel
Einleitung: Die Arbeit untersucht Open Source Software (OSS) und Free Software, beginnend mit einer Einführung in informationstechnische und rechtliche Grundlagen. Sie beleuchtet die Benutzerperspektive, ökonomische Aspekte und die Rolle verschiedener Akteure. Das Kapitel 7 behandelt das Softwarepatent und dessen Einfluss auf die Zukunft von OSS.
Quellcode und Objektcode: Dieses Kapitel erläutert die grundlegenden Konzepte von Quellcode und Objektcode in der Computerprogrammierung. Es erklärt den Unterschied zwischen diesen beiden und betont die Bedeutung dieses Unterschieds für das Verständnis quelloffener Programme. Die Erläuterung von Programmiersprachen und deren Funktion bildet den Kern dieses Kapitels und legt die Grundlage für die spätere Diskussion von freier Software.
Free-Software und Open-Source-Software: Hier werden die Begriffe "Free Software" und "Open Source Software" definiert und voneinander abgegrenzt. Es werden verschiedene freie Lizenzen wie die BSD-Lizenz und die GNU General Public License (GPL) vorgestellt und ihre Auswirkungen auf die Nutzung und Weiterentwicklung der Software erläutert. Der Vergleich mit proprietärer Software wird ebenfalls durchgeführt.
Linux Userperspektive: Dieses Kapitel beleuchtet die Nutzung von OSS aus der Perspektive der Benutzer. Es werden sowohl ideologische Beweggründe für den Einsatz von OSS als auch die ökonomischen Vorteile gegenüber proprietärer Software, z.B. im Büroalltag, diskutiert. Es werden Aspekte wie Kosteneinsparung, Systemadministration und die Möglichkeit der kooperativen Hilfe hervorgehoben.
Geschäftsmodell „Free Software / Open Source Software“: Dieses Kapitel analysiert die Geschäftsmodelle im Kontext von OSS und vergleicht sie mit den Geschäftsmodellen proprietärer Software. Es verwendet das Konzept einer allgemeinen Software-Value-Chain, um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufzuzeigen.
Akteure und Akteurskonstellation: Der Fokus liegt hier auf den wichtigsten Akteuren im OSS-Ökosystem, wie Entwicklergemeinschaften, Hardwarehersteller, Softwareproduzenten, IT-Dienstleister, Kunden und staatliche Einrichtungen. Das Kapitel analysiert die Interaktionen und das Verhältnis dieser Akteure zueinander und gibt einen Ausblick auf zukünftige Entwicklungen.
Schlüsselwörter
Open Source Software (OSS), Free Software, Quellcode, Objektcode, freie Lizenzen (BSD, GPL), Softwarepatente, ökonomische Aspekte, Geschäftsmodelle, Akteure, Akteurskonstellation, Benutzerperspektive, ideologische Beweggründe, Kooperation.
Häufig gestellte Fragen (FAQ) zu "Open Source Software (OSS) und Free Software"
Was ist der Inhalt dieses Dokuments?
Dieses Dokument bietet eine umfassende Übersicht über Open Source Software (OSS) und Free Software. Es beinhaltet ein Inhaltsverzeichnis, eine Zielsetzung mit Themenschwerpunkten, Zusammenfassungen der einzelnen Kapitel und ein Glossar mit Schlüsselbegriffen. Der Fokus liegt auf den technischen, rechtlichen und ökonomischen Aspekten von OSS, der Analyse der verschiedenen Akteure und deren Interaktionen sowie der Betrachtung verschiedener Geschäftsmodelle.
Welche Themen werden im Dokument behandelt?
Das Dokument behandelt folgende Kernbereiche: Technische Grundlagen von Quellcode und Objektcode, rechtliche Rahmenbedingungen freier Softwarelizenzen (BSD, GPL), ökonomische Aspekte und Geschäftsmodelle von OSS, die Rolle verschiedener Akteure im OSS-Ökosystem (Entwickler, Hardwarehersteller, Softwareproduzenten, IT-Dienstleister, Kunden, Staat), die Auswirkungen von Softwarepatenten auf die OSS-Bewegung und die Benutzerperspektive auf OSS, inklusive ideologischer und ökonomischer Aspekte.
Welche Kapitel umfasst das Dokument und worum geht es in jedem einzelnen?
Das Dokument ist in mehrere Kapitel gegliedert: Eine Einleitung, die die Thematik einführt; ein Kapitel zu Quellcode und Objektcode, das die technischen Grundlagen erläutert; ein Kapitel zu Free- und Open-Source-Software, das die Lizenzmodelle erklärt; ein Kapitel zur Linux-Benutzerperspektive, das die Nutzung und die Beweggründe der Nutzer beleuchtet; ein Kapitel zu den Geschäftsmodellen von OSS; ein Kapitel zu den Akteuren und deren Konstellation im OSS-Ökosystem; und schließlich ein Kapitel zum Softwarepatent und seinen Auswirkungen auf OSS.
Was sind die wichtigsten Akteure im OSS-Ökosystem?
Zu den wichtigsten Akteuren im OSS-Ökosystem gehören Entwicklergemeinschaften, Hardwarehersteller, Softwareproduzenten, IT-Dienstleister, Kunden und staatliche Einrichtungen. Das Dokument analysiert die Interaktionen und das Verhältnis dieser Akteure zueinander.
Welche Arten von freien Lizenzen werden behandelt?
Das Dokument behandelt unter anderem die BSD-Lizenz und die GNU General Public License (GPL) und erklärt deren Auswirkungen auf die Nutzung und Weiterentwicklung der Software.
Wie werden die Geschäftsmodelle von Open-Source-Software im Vergleich zu proprietärer Software dargestellt?
Das Dokument analysiert die Geschäftsmodelle von OSS und vergleicht sie mit den Geschäftsmodellen proprietärer Software. Es nutzt das Konzept einer allgemeinen Software-Value-Chain, um die Unterschiede und Gemeinsamkeiten aufzuzeigen.
Welche Rolle spielen Softwarepatente im Kontext von Open-Source-Software?
Das Dokument widmet ein eigenes Kapitel dem Softwarepatent und untersucht dessen Definition, Koexistenz mit Urheberrecht, Auswirkungen auf den europäischen Mittelstand und die potenziellen Auswirkungen auf die Zukunft von OSS.
Welche Zielsetzung verfolgt dieses Dokument?
Das Dokument zielt darauf ab, einen umfassenden Einblick in die Welt der Open Source Software (OSS) und Free Software zu geben. Es beleuchtet die technischen, rechtlichen und ökonomischen Aspekte von OSS und analysiert die verschiedenen Akteure und deren Konstellationen sowohl aus der Benutzerperspektive als auch aus der Perspektive der Geschäftsmodelle.
Welche Schlüsselwörter charakterisieren den Inhalt?
Schlüsselwörter sind: Open Source Software (OSS), Free Software, Quellcode, Objektcode, freie Lizenzen (BSD, GPL), Softwarepatente, ökonomische Aspekte, Geschäftsmodelle, Akteure, Akteurskonstellation, Benutzerperspektive, ideologische Beweggründe, Kooperation.
- Citar trabajo
- Anonym (Autor), 2004, Freie Software, Open Source und Linux, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/67812