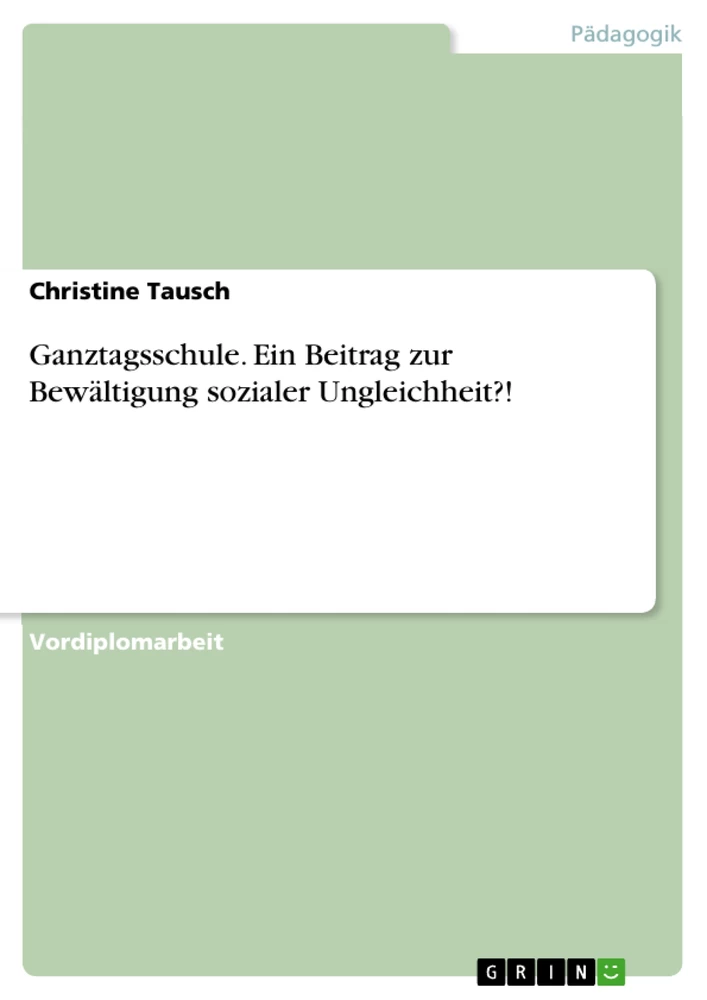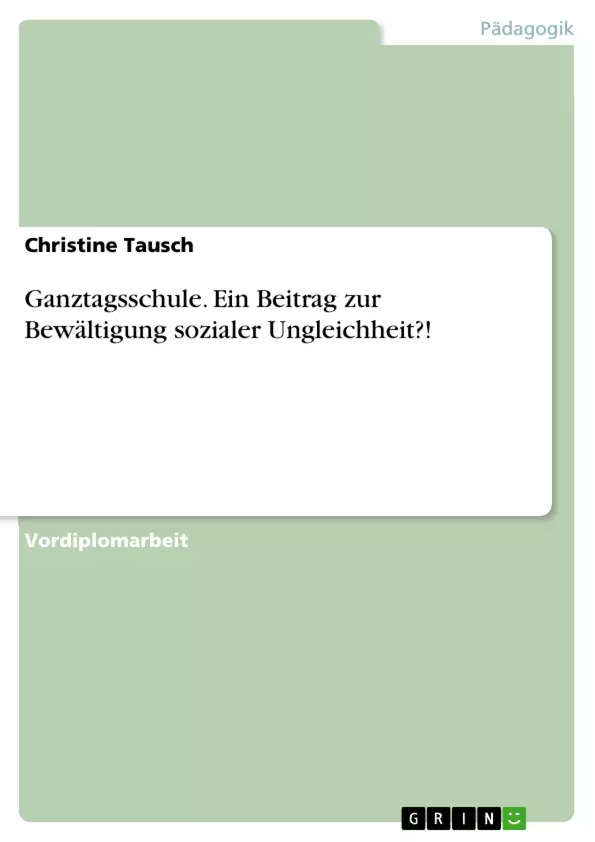Die Veröffentlichung der ersten PISA-Studie im Jahr 2001 eröffnete eine intensive Debatte über das deutsche Bildungswesen. In der kontroversen Diskussion über Lösungsmöglichkeiten der deutschen „Bildungsmisere“ geriet insbesondere das Thema Ganztagsschule in den Fokus. Vorangetrieben wurde die Diskussion auch durch ein Investitionsprogramm der Bundesregierung zur Förderung von Ganztagsschulen. Dass die Errichtung von Ganztagsschulen eine so zentrale Rolle im öffentlichen Diskurs und im schulpolitischen Handeln einnimmt, liegt daran, dass sich in ihr ganz unterschiedliche Argumentationslinien und Erwartungen verschiedener politischer und gesellschaftlicher Akteure bündeln: Zentral ist die Hoffnung, damit ein besseres Leistungsniveau der Schüler zu erreichen und Schüler stärker individuell zu fördern. Weiter werden mit der Ganztagsschule familienpolitische, sozialpädagogische und didaktische Zielsetzungen verfolgt.
Von den vielen Hoffnungen, die sich an Ganztagsschulen richten, interessiert in dieser Arbeit die, dass Ganztagsschulen Nachteile von Kindern aus sozial schwachen Familien ausgleichen und damit helfen, Chancengleichheit in der Bildungsbeteiligung zu verwirklichen. Ob diese Hoffnung berechtigt ist, ist die zentrale Frage dieser Arbeit. Ihr wird in zwei Schritten nachgegangen.
Zuerst steht der Zusammenhang von Bildung und sozialer Ungleichheit im Fokus. Nach Klärung zentraler Begriffe soll darauf eingegangen werden, wie stark Bildungschancen in Deutschland von der sozialen Herkunft abhängen und wodurch dies verursacht ist. Hier werden empirische Befunde sowie Erklärungsansätze im Anschluss an die bildungssoziologischen Theorien von Boudon und Bourdieu rezipiert. Deutlich wird, dass soziale Herkunft in Deutschland eine wichtige Determinante von Bildungserfolg ist. Bildungsungleichheiten werden von einer Reihe von Mechanismen hervorgebracht und reproduziert, deren genaue Funktion und Gewichtung noch nicht ausreichend erforscht ist.
Danach wendet sich die Arbeit der Ganztagsschule in Deutschland zu. Hier werden die zentralen Merkmale unterschiedlicher Konzeptionen von Ganztagsschule herausgearbeitet und daraufhin untersucht, ob sie dazu geeignet sind, Bildungsdisparitäten abzubauen. Aus Basis der zuvor gewonnenen Kriterien kommt die Arbeit hier für den größeren Teil der Ganztagsschulmodelle in Deutschland zu eher skeptisch stimmenden Befunden.
(Studienabschließende Hausarbeit zum Vordiplom Erziehungswissenschaft, Universität Marburg, 2006.)
Inhaltsverzeichnis
- EINLEITUNG UND FRAGESTELLUNG
- BEGRIFFSKLÄRUNG: SOZIALE UNGLEICHHEIT UND BILDUNG
- Zum Begriff „soziale Ungleichheit“
- Bildung als zentrale Dimension sozialer Ungleichheit
- UNGLEICHHEIT DER BILDUNGSCHANCEN IN DEUTSCHLAND
- Ausmaß der Ungleichheit
- Erklärungsansätze
- Boudon
- Bourdieu
- Zentrale Ursachenkomplexe
- Familienspezifische Sozialisation
- Institutionelle Ursachen
- ANNÄHERUNG DER BILDUNGSCHANCEN DURCH DIE GANZTAGSSCHULE?
- Entwicklung von Ganztagsschulen in Deutschland
- Was ist Ganztagsschule?
- Teilnahme an Ganztagsschulen in Deutschland
- Chancen und Probleme der Ganztagsschule in Bezug auf die Verringerung der soziale Bildungsungleichheiten
- Entlastung der Eltern
- Ganztagsschule als Ort vielseitigen Lernens
- Individuelle Förderung und Reform des Unterrichts
- Institutionelle Aspekte
- Ganztagsschule - Stigmatisierung oder Nachteilsausgleich?
- FAZIT: ANFORDERUNGEN AN DIE GANZTAGSSCHULE
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht, ob Ganztagsschulen einen Beitrag zur Bewältigung sozialer Ungleichheit in Deutschland leisten können. Hierzu wird zunächst der Zusammenhang von Bildung und sozialer Ungleichheit beleuchtet und analysiert, wie stark Bildungschancen in Deutschland von der sozialen Herkunft abhängen. Anschließend wird untersucht, inwiefern die Konzeption von Ganztagsschulen dazu beitragen kann, die soziale Ungleichheit der Bildungschancen zu verringern.
- Soziale Ungleichheit und Bildung als zentrale Dimension
- Ungleichheit der Bildungschancen in Deutschland
- Erklärungsansätze für die Ungleichheit der Bildungschancen
- Konzeption und Entwicklung von Ganztagsschulen in Deutschland
- Chancen und Probleme der Ganztagsschule in Bezug auf die Verringerung sozialer Bildungsungleichheiten
Zusammenfassung der Kapitel
- Die Einleitung stellt die Problematik der sozialen Ungleichheit im deutschen Bildungssystem dar und erläutert die Forschungsfrage, ob Ganztagsschulen einen Beitrag zur Chancengleichheit leisten können.
- Kapitel 2 klärt die Begriffe „soziale Ungleichheit“ und „Bildung“ und zeigt auf, wie eng diese beiden Bereiche miteinander verknüpft sind.
- Kapitel 3 beleuchtet das Ausmaß der Ungleichheit der Bildungschancen in Deutschland und diskutiert verschiedene Erklärungsansätze, insbesondere die Theorien von Boudon und Bourdieu.
- Kapitel 4 untersucht die Entwicklung von Ganztagsschulen in Deutschland und analysiert, ob diese Form der Schule einen Beitrag zur Verringerung sozialer Ungleichheit leisten kann. Dabei werden die Chancen und Probleme der Ganztagsschule im Hinblick auf die Entlastung der Eltern, die Förderung vielseitigen Lernens, die individuelle Förderung sowie institutionelle Aspekte diskutiert.
Schlüsselwörter
Soziale Ungleichheit, Bildung, Bildungschancen, Ganztagsschule, Chancengleichheit, PISA-Studie, Erklärungsansätze, Boudon, Bourdieu, Familienspezifische Sozialisation, Institutionelle Ursachen, Entwicklung von Ganztagsschulen, Chancen und Probleme der Ganztagsschule, Stigmatisierung, Nachteilsausgleich.
Häufig gestellte Fragen
Kann die Ganztagsschule soziale Ungleichheit abbauen?
Die Hoffnung ist groß, doch die Arbeit zeigt sich skeptisch. Viele aktuelle Ganztagsmodelle in Deutschland reichen nicht aus, um tief verwurzelte Bildungsdisparitäten allein durch längere Anwesenheit zu beseitigen.
Welchen Einfluss hat die soziale Herkunft auf den Bildungserfolg?
In Deutschland ist die soziale Herkunft eine der stärksten Determinanten für den Schulerfolg. Dies wird durch Theorien von Bourdieu (kulturelles Kapital) und Boudon (primäre/sekundäre Herkunftseffekte) erklärt.
Was sind die Vorteile der Ganztagsschule für sozial schwache Familien?
Sie bietet eine Entlastung der Eltern, ermöglicht individuelle Förderung und schafft einen Raum für vielseitiges Lernen, der über den klassischen Fachunterricht hinausgeht.
Welche Rolle spielt die PISA-Studie in dieser Debatte?
Die erste PISA-Studie 2001 deckte die starke Kopplung von sozialer Herkunft und Kompetenzerwerb auf, was den massiven Ausbau von Ganztagsschulen als Lösungsansatz vorantrieb.
Gibt es Risiken bei der Ganztagsschule?
Ein Risiko ist die Stigmatisierung, wenn Ganztagsschulen primär als "Reparaturbetriebe" für Problemgruppen wahrgenommen werden, statt als pädagogische Reform für alle Schüler.
- Citar trabajo
- Christine Tausch (Autor), 2006, Ganztagsschule. Ein Beitrag zur Bewältigung sozialer Ungleichheit?!, Múnich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/67879