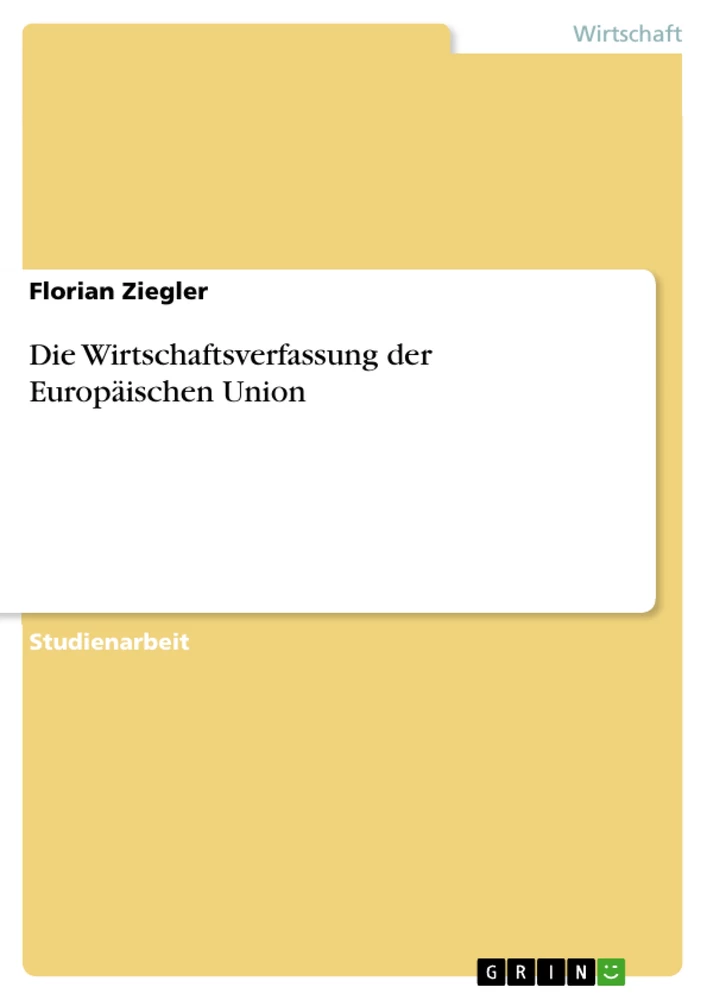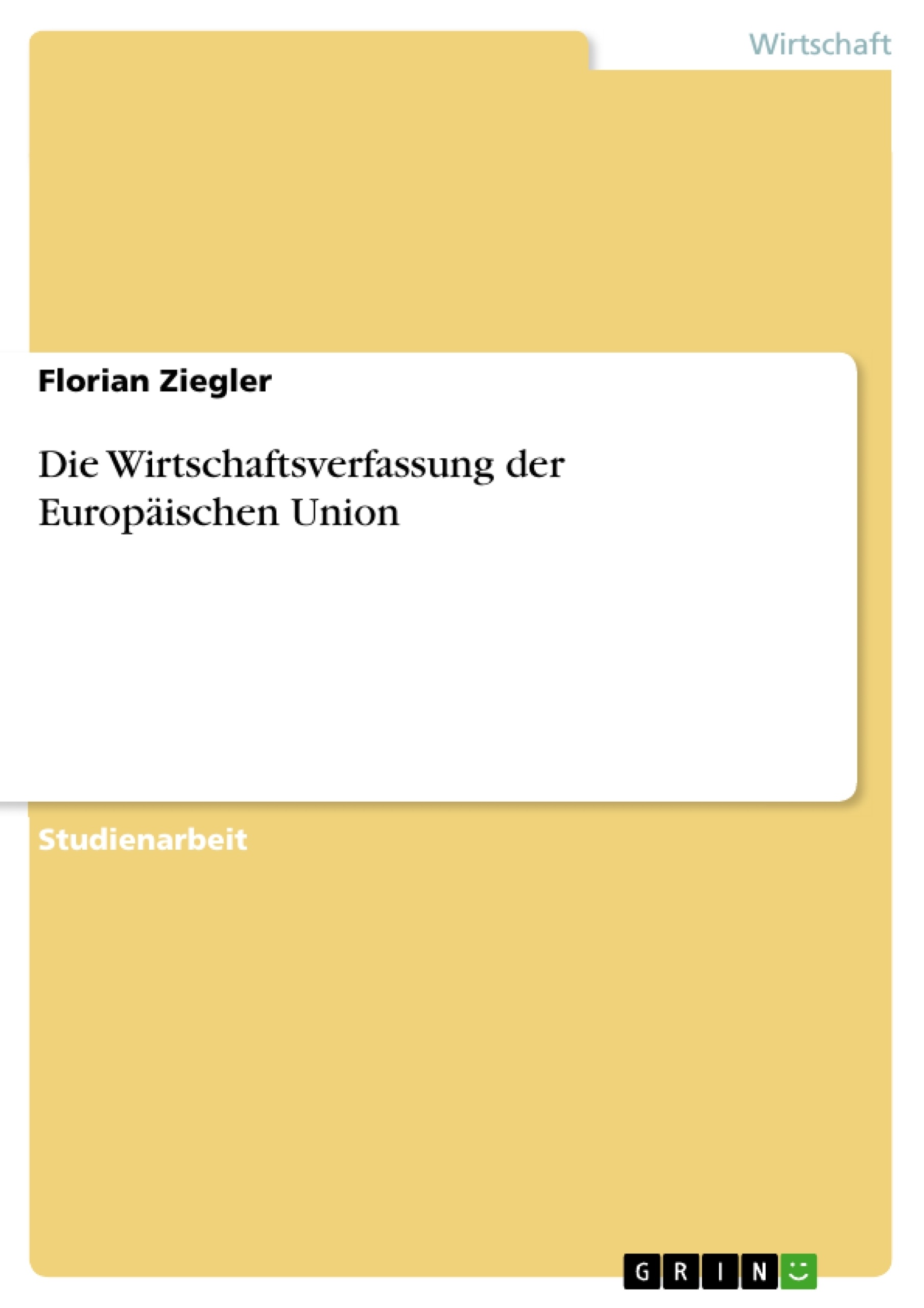Nach Ende des Zweiten Weltkriegs, der weite Teile des europäischen Kontinents verwüstete und Millionen Menschenleben forderte, herrschte in Europa allgemeiner Konsens ein solches Verbrechen zukünftig mit allen Mitteln zu verhindern, oder besser, dem Entstehen von Krieg und Gewalt im Ansatz zu begegnen. In seiner historischen Zürcher Rede im Jahre 1946 forderte der britische Premierminister Sir Winston Churchill die Gründung einer Art Vereinigter Staaten von Europa und wurde damit einer der Väter der nachfolgenden europäischen Einigung. Die grundlegende Idee zur Friedenssicherung war die Schaffung einer engen wirtschaftlichen und politischen Gemeinschaft der europäischen Staaten. Eine „erste Etappe der Europäischen Föderation“ war die Ratifikation des Vertrags zur Gründung der Europäischen Gemeinschaft für Kohle und Stahl (EGKS) im Jahre 1951, der eine gemeinsame Förderung und Gewinnung der Rohstoffe vorsah. Der Vertrag basierte auf einem Plan des französischen Außenministers Robert Schuman sowie dessen Mitarbeiters Jean Monnet und wurde von Deutschland, Frankreich und den Beneluxstaaten unterzeichnet. Im Jahre 1957 wurden durch Unterzeichnung der „Römischen Verträge“ zwei weitere Gemeinschaften gegründet. Die „Europäische Wirtschaftsgemeinschaft“ (EWG) sowie die „Europäische Atomgemeinschaft“ (EAG). Die EAG war, und ist immer noch, Eigentümer aller europäischen Kernbrennstoffe. Sie hat die Aufgabe der Atomforschung und verwaltet die zivile Nutzung der Atomkraft zur Energiegewinnung. Die wichtigste der drei Europäischen Gemeinschaften war seit Gründung jedoch stets die EWG, die gewissermaßen von der EGKS und EAG flankiert wurde. Hauptaufgaben der EWG waren die Errichtung eines gemeinsamen Marktes und einerWirtschaft- und Währungsunion, die Annäherung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten sowie die Entstehung engerer Beziehungen zwischen den Staaten zu fördern. Die EWG bildete die Grundlage für eine fortschreitende wirtschaftliche und politische Einigung Europas und führte 1993 durch den Vertrag von Maastricht zur Gründung der Europäischen Union. Diese wird in Artikel 1 II des EU-Vertrages als eine „neue Stufe bei der Verwirklichung einer immer engeren Union der Völker Europas…“ beschrieben. Um vor allem die politische Dimension der voranschreitenden Integration durch den Vertrag über die Europäisch Union zu betonen, wurde die Europäische Wirtschaftsgemeinschaft (EWG) in die Europäische Gemeinschaft (EG) umbenannt. [...]
Inhaltsverzeichnis
- 1. Einführung und Begriffsbestimmung
- 1.1 Die Entstehung der Europäischen Gemeinschaften
- 1.2 Begriff der Wirtschaftsverfassung
- 2. Die deutsche Wirtschaftsverfassung
- 3. Die Europäische Wirtschaftsverfassung
- 3.1 Der Anwendungsvorrang des Gemeinschaftsrechts
- 3.3 Die Grund- und Hilfsfreiheiten des EGV
- 3.3.1 Der freie Warenverkehr
- 3.3.2 Die Arbeitnehmerfreizügigkeit
- 3.3.3 Die Niederlassungsfreiheit
- 3.3.4 Die Dienstleistungsfreiheit
- 3.3.5 Der freie Kapital- und Zahlungsverkehr
- 4. Steuerungs- und Interventionsmöglichkeiten am Beispiel Industriepolitik
- 4.1 Die strukturelle Industriepolitik der EG
- 4.2 Die sektorelle Industriepolitik der EG
- 5. Fazit
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Seminararbeit untersucht die Wirtschaftsverfassung der Europäischen Union. Ziel ist es, die Entstehung und Entwicklung der europäischen Wirtschaftsordnung zu beleuchten und deren zentrale Elemente zu analysieren. Dabei wird der Fokus auf die Zusammenhänge zwischen nationaler und europäischer Wirtschaftspolitik gelegt.
- Entstehung und Entwicklung der Europäischen Gemeinschaften
- Begriff und Elemente der Wirtschaftsverfassung der EU
- Grundfreiheiten des europäischen Binnenmarktes
- Steuerungs- und Interventionsmöglichkeiten der EU-Industriepolitik
- Zusammenspiel von nationaler und europäischer Wirtschaftspolitik
Zusammenfassung der Kapitel
1. Einführung und Begriffsbestimmung: Dieses Kapitel beleuchtet die Entstehung der Europäischen Gemeinschaften nach dem Zweiten Weltkrieg, ausgehend von der Zürcher Rede Churchills und dem Schuman-Plan. Es beschreibt die Gründung der EGKS, EWG und EAG und deren Entwicklung zur Europäischen Union, wobei der Schwerpunkt auf der wirtschaftlichen Ausrichtung der EU liegt. Der Begriff der Wirtschaftsverfassung wird eingeführt und als ein übergeordnetes Konzept zur Koordinierung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten definiert, das auf der Harmonisierung der Wirtschaftspolitiken und der Schaffung eines gemeinsamen Wirtschaftsraums basiert.
2. Die deutsche Wirtschaftsverfassung: [Da der Text keine Informationen zum Inhalt dieses Kapitels liefert, kann hier keine Zusammenfassung erstellt werden.]
3. Die Europäische Wirtschaftsverfassung: Dieses Kapitel befasst sich mit der Europäischen Wirtschaftsverfassung im Detail. Es behandelt den Vorrang des Gemeinschaftsrechts und die Grundfreiheiten des EGV, darunter der freie Warenverkehr, die Arbeitnehmer-, Niederlassungs-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehrsfreiheit. Diese Freiheitsgarantien bilden das Fundament des europäischen Binnenmarktes und ermöglichen den freien Fluss von Gütern, Dienstleistungen, Kapital und Arbeitskräften innerhalb der EU. Die detaillierte Auseinandersetzung mit diesen Grundfreiheiten verdeutlicht die Komplexität und Bedeutung des europäischen Integrationsprozesses.
4. Steuerungs- und Interventionsmöglichkeiten am Beispiel Industriepolitik: Dieses Kapitel analysiert die Möglichkeiten der EU, in die Wirtschaft einzugreifen, am Beispiel der Industriepolitik. Es unterscheidet zwischen struktureller und sektoraler Industriepolitik, wobei beide Ansätze darauf abzielen, die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft zu stärken und den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt in der Union zu fördern. Die Beispiele zeigen die Instrumente und Strategien, die die EU zur Steuerung und Lenkung der Wirtschaftsentwicklung einsetzt.
Schlüsselwörter
Europäische Union, Wirtschaftsverfassung, Gemeinschaftsrecht, Binnenmarkt, Grundfreiheiten, Industriepolitik, Wirtschaftsintegration, Harmonisierung, Wettbewerb, Mitgliedstaaten.
Häufig gestellte Fragen zur Seminararbeit: Europäische Wirtschaftsverfassung
Was ist der Gegenstand der Seminararbeit?
Die Seminararbeit untersucht die Wirtschaftsverfassung der Europäischen Union. Sie beleuchtet die Entstehung und Entwicklung der europäischen Wirtschaftsordnung und analysiert deren zentrale Elemente, insbesondere die Zusammenhänge zwischen nationaler und europäischer Wirtschaftspolitik.
Welche Themen werden in der Seminararbeit behandelt?
Die Arbeit umfasst folgende Themen: Entstehung und Entwicklung der Europäischen Gemeinschaften, Begriff und Elemente der Wirtschaftsverfassung der EU, Grundfreiheiten des europäischen Binnenmarktes (freier Warenverkehr, Arbeitnehmerfreizügigkeit, Niederlassungsfreiheit, Dienstleistungsfreiheit, Kapitalverkehrsfreiheit), Steuerungs- und Interventionsmöglichkeiten der EU-Industriepolitik (strukturelle und sektorale Industriepolitik) und das Zusammenspiel von nationaler und europäischer Wirtschaftspolitik.
Wie ist die Seminararbeit strukturiert?
Die Arbeit ist in fünf Kapitel gegliedert: Eine Einführung mit Begriffsbestimmung, ein Kapitel zur deutschen Wirtschaftsverfassung, ein Kapitel zur Europäischen Wirtschaftsverfassung mit detaillierter Betrachtung der Grundfreiheiten, ein Kapitel zu Steuerungs- und Interventionsmöglichkeiten anhand der Industriepolitik und abschließend ein Fazit. Jedes Kapitel wird in der vorliegenden Übersicht zusammengefasst.
Was wird in der Einleitung behandelt?
Die Einleitung beleuchtet die Entstehung der Europäischen Gemeinschaften nach dem Zweiten Weltkrieg, beginnend mit der Zürcher Rede Churchills und dem Schuman-Plan. Sie beschreibt die Gründung der EGKS, EWG und EAG und deren Entwicklung zur Europäischen Union mit Fokus auf die wirtschaftliche Ausrichtung. Der Begriff der Wirtschaftsverfassung wird definiert als übergeordnetes Konzept zur Koordinierung der Wirtschaftspolitik der Mitgliedstaaten durch Harmonisierung und Schaffung eines gemeinsamen Wirtschaftsraums.
Was ist der Inhalt des Kapitels zur deutschen Wirtschaftsverfassung?
Der Text enthält leider keine Informationen zum Inhalt dieses Kapitels. Daher kann keine Zusammenfassung erstellt werden.
Was wird im Kapitel zur Europäischen Wirtschaftsverfassung behandelt?
Dieses Kapitel behandelt den Vorrang des Gemeinschaftsrechts und die Grundfreiheiten des EGV (freier Warenverkehr, Arbeitnehmer-, Niederlassungs-, Dienstleistungs- und Kapitalverkehrsfreiheit). Es verdeutlicht deren Bedeutung für den europäischen Binnenmarkt und den freien Fluss von Gütern, Dienstleistungen, Kapital und Arbeitskräften innerhalb der EU.
Welche Steuerungs- und Interventionsmöglichkeiten der EU werden behandelt?
Das Kapitel zur Industriepolitik analysiert die Möglichkeiten der EU, in die Wirtschaft einzugreifen. Es unterscheidet zwischen struktureller und sektoraler Industriepolitik und zeigt die Instrumente und Strategien der EU zur Steuerung und Lenkung der Wirtschaftsentwicklung auf, mit dem Ziel die Wettbewerbsfähigkeit der europäischen Wirtschaft zu stärken und den wirtschaftlichen und sozialen Zusammenhalt zu fördern.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Seminararbeit?
Schlüsselwörter sind: Europäische Union, Wirtschaftsverfassung, Gemeinschaftsrecht, Binnenmarkt, Grundfreiheiten, Industriepolitik, Wirtschaftsintegration, Harmonisierung, Wettbewerb, Mitgliedstaaten.
Wo finde ich den vollständigen Text der Seminararbeit?
Der vollständige Text der Seminararbeit ist nicht hier enthalten. Diese HTML-Seite bietet lediglich eine Übersicht über den Inhalt.
- Citation du texte
- Florian Ziegler (Auteur), 2006, Die Wirtschaftsverfassung der Europäischen Union, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/67922