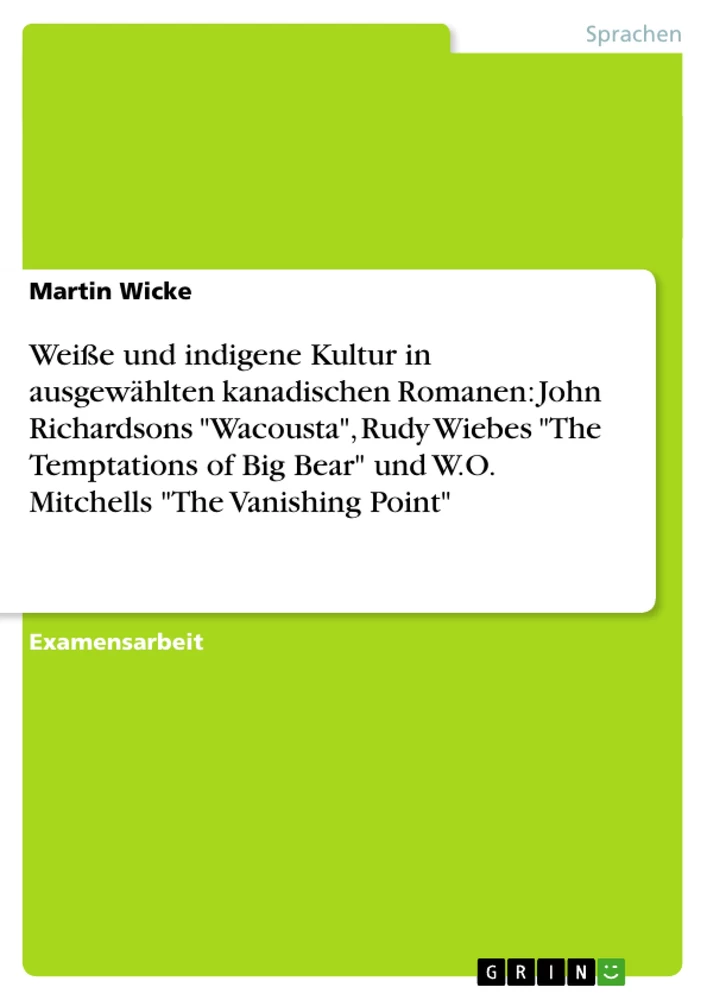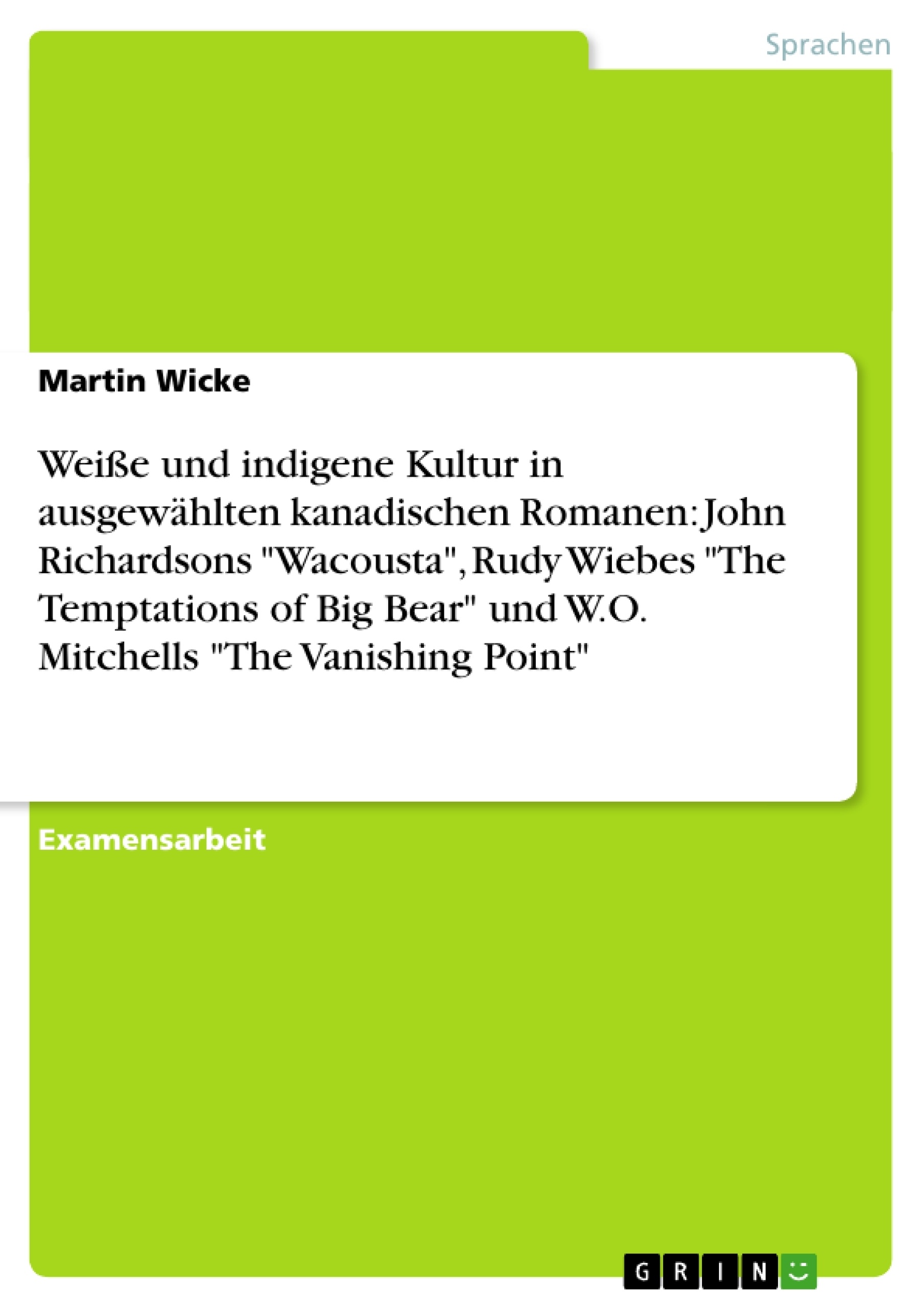Ziel dieser Abhandlung ist eine detaillierte Untersuchung der kontrastiven und kongruenten Darstellungsweisen indigener und weißer Kultur anhand von drei kanadischen Romanen, und zwar John Richardsons "Wacousta or The Prophecy", Rudy Wiebes "The Temptations of Big Bear" und W.O. Mitchells "The Vanishing Point". Alle drei Romane setzen sich mit einem zwischen beiden Kulturen bestehenden Mentalitätskonflikt auseinander. Überdies beschäftigen sie sich eingehend mit der Vergangenheit Kanadas und der Identität dieser multikulturellen Nation, welche in hohem Maße auch von einer indigenen Tradition geprägt ist. Ein weiteres Ziel dieser Abhandlung ist ein möglichst umfassendes Bild der kanadischen Einstellung gegenüber der indigenen Kultur von der ersten Besiedlung bis zur Neuzeit.
Die drei Romane unterscheiden sich insofern, als dass jeder von ihnen sich mit einem anderen Jahrhundert der kanadischen Vergangenheit und somit einer anderen Zeitphase der Kolonisation beschäftigt. Der Roman "Wacousta or The Prophecy" behandelt die Belagerung des Fort Detroit durch die Ottawa und ihren Häuptling Pontiac im Jahre 1763, und somit ein vergleichsweise frühes Stadium der Kolonisation. In "The Temptations of Big Bear" wird mit der Assimilierung der Plains Cree im Zeitraum von 1876 bis 1885 dagegen bereits deren Endphase eingeläutet. The "Vanishing Point" hingegen befasst sich mit den unmittelbaren Konsequenzen dieser Assimilationspolitik. Der Handlungsverlauf vollzieht sich wei-testgehend auf dem Gebiet des "Paradise Valley" Reservats der Stonys in der Nähe von Calgary in den fünfziger Jahren des letzten Jahrhunderts.
Inhaltsverzeichnis
- Einleitung
- John Richardson: Wacousta or The Prophecy (1832)
- Historischer Hintergrund und Handlungsverlauf
- Der Kontrast zwischen Zivilisation und Wildnis
- Das Fort und die Garnison
- Der Wald und seine Bewohner
- Die Gegensätzlichkeit geometrischer Formen
- Der See als europäischer Gegenpol
- Paradies und Oase als Fortsetzung des Gegenpols
- Der Grenzfluss, die Schlucht und die Brücke
- Die Darstellung der Kolonisten und der Natives
- Die Wiedergabe der indigenen Kultur
- Die Wiedergabe der weißen Kultur
- Der Kampf ungleicher Brüder
- Das Erscheinungsbild von Governor De Haldimar
- Das Erscheinungsbild von Wacousta
- Die weißen und indigenen Nebencharaktere
- Die Aufhebung der Dichotomie
- John Richardson und die nationale Identität
- Rudy Wiebe: The Temptations of Big Bear (1973)
- Historischer Hintergrund und Handlungsverlauf
- Die Darstellung der unterschiedlichen Lebenswelten
- Landbesitz und persönliche Habe
- Natur, Spiritualität und die Elemente
- Die 'zivilisierte' Zerstörung der Natur
- Sprache und Kommunikation
- Die Darstellung der weißen und indigenen Charaktere
- Erzähler und Erzählstruktur
- Die Bedeutung der Sonne
- Das Erscheinungsbild der Kolonisten und ihre Sichtweise
- Das Erscheinungsbild der Natives und ihre Sichtweise
- Kitty McLean als kulturelle Vermittlerin
- Rudy Wiebe als Sprachrohr der Natives
- W.O. Mitchell: The Vanishing Point (1973)
- Hintergrund und Handlungsverlauf
- Die Selbstfindung des Carlyle Sinclair
- Aunt Pearl und ihre puritanische Erziehung
- Old Kacky und "The Vanishing Point"
- Der Vater und die fehlende emotionale Bindung
- Selbstentfremdung und Selbstausgrenzung
- Victoria Rider als scheinbar erfolgreiche Selbstprojektion
- Selbsterkenntnis und Erleuchtung
- Der Kontrast von Stadt und Reservat
- Die Stadt und ihre befremdlichen Bewohner
- "Paradise Valley" und "Storm and Misty"
- Die Hängebrücke
- Die weißen und indigenen Nebencharaktere
- Die weißen Nebencharaktere
- Die indigenen Nebencharaktere
- W.O. Mitchell und "The Vanishing Point"
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Abhandlung analysiert die kontrastiven und kongruenten Darstellungsweisen indigener und weißer Kultur in drei kanadischen Romanen: John Richardsons Wacousta or The Prophecy, Rudy Wiebes The Temptations of Big Bear und W.O. Mitchells The Vanishing Point. Die Romane beleuchten den Mentalitätskonflikt zwischen den Kulturen und beschäftigen sich mit der Vergangenheit Kanadas sowie der Identität dieser multikulturellen Nation, die stark von einer indigenen Tradition geprägt ist. Die Abhandlung strebt ein umfassendes Bild der kanadischen Einstellung gegenüber der indigenen Kultur von der ersten Besiedlung bis zur Neuzeit an.
- Die Darstellung von Kulturkonflikten und -überschneidungen in kanadischen Romanen
- Die historische Entwicklung der Beziehung zwischen weißen Kolonisten und indigenen Völkern
- Die Frage der nationalen Identität in Kanada im Kontext der indigenen Kultur
- Die literarische Repräsentation indigener Lebensweisen und Perspektiven
- Die Analyse von Stereotypen und Vorurteilen gegenüber indigenen Völkern in der kanadischen Literatur
Zusammenfassung der Kapitel
- John Richardson: Wacousta or The Prophecy (1832)
- Das Kapitel analysiert den historischen Hintergrund und Handlungsverlauf des Romans und stellt den Kontrast zwischen Zivilisation und Wildnis dar.
- Es untersucht die Darstellung des Forts und der Garnison als Symbole europäischer Ordnung sowie des Waldes und seiner Bewohner als Ausdruck indigener Lebensweise.
- Das Kapitel beleuchtet die Wiedergabe der indigenen Kultur und der weißen Kultur im Roman und analysiert die Darstellung des Konflikts zwischen beiden Kulturen.
- Die Darstellung der Haupt- und Nebencharaktere wird kritisch betrachtet und die Rolle von Governor De Haldimar, Wacousta sowie die weißen und indigenen Nebencharaktere beleuchtet.
- Rudy Wiebe: The Temptations of Big Bear (1973)
- Das Kapitel untersucht den historischen Hintergrund und Handlungsverlauf des Romans und beleuchtet die Darstellung der unterschiedlichen Lebenswelten von weißen Kolonisten und indigenen Völkern.
- Es analysiert die Bedeutung von Landbesitz und persönlicher Habe, die Rolle der Natur und Spiritualität sowie die "zivilisierte" Zerstörung der Natur in der Erzählung.
- Das Kapitel betrachtet die Darstellung der weißen und indigenen Charaktere und analysiert die Erzählstruktur des Romans, die Bedeutung der Sonne sowie die Sichtweisen der Kolonisten und Natives.
- W.O. Mitchell: The Vanishing Point (1973)
- Das Kapitel beschreibt den Hintergrund und Handlungsverlauf des Romans und stellt die Selbstfindung des Protagonisten Carlyle Sinclair in den Mittelpunkt.
- Es beleuchtet die Rolle von Aunt Pearl und ihrer puritanischen Erziehung, Old Kacky und "The Vanishing Point" sowie die fehlende emotionale Bindung des Protagonisten zu seinem Vater.
- Das Kapitel analysiert die Selbstentfremdung und Selbstausgrenzung von Carlyle Sinclair und betrachtet die Figur von Victoria Rider als scheinbar erfolgreiche Selbstprojektion.
- Es untersucht den Kontrast zwischen Stadt und Reservat und beleuchtet die Darstellung der weißen und indigenen Nebencharaktere.
Schlüsselwörter
Die Schlüsselwörter dieser Abhandlung sind: kanadische Literatur, indigene Kultur, weiße Kultur, Kolonialismus, Identität, Assimilation, Wacousta or The Prophecy, The Temptations of Big Bear, The Vanishing Point, interkultureller Konflikt, Geschichte Kanadas, nationale Identität.
Häufig gestellte Fragen
Welche drei Romane stehen im Zentrum der Untersuchung?
Die Arbeit analysiert John Richardsons „Wacousta“, Rudy Wiebes „The Temptations of Big Bear“ und W.O. Mitchells „The Vanishing Point“.
Welche Zeitphasen der kanadischen Geschichte werden abgedeckt?
Die Romane behandeln verschiedene Stadien: das frühe Stadium der Kolonisation (1763), die Endphase und Assimilierung (1876-1885) sowie die Konsequenzen der Assimilationspolitik in den 1950er Jahren.
Was ist das Hauptziel der literarischen Analyse?
Ziel ist die Untersuchung der kontrastiven und kongruenten Darstellungsweisen von indigener und weißer Kultur sowie des daraus resultierenden Mentalitätskonflikts.
Wie wird der Kontrast zwischen Zivilisation und Wildnis in „Wacousta“ dargestellt?
Der Kontrast wird durch Symbole wie das Fort und die Garnison (europäische Ordnung) gegenüber dem Wald und seinen Bewohnern (Natives) verdeutlicht.
Welche Rolle spielt die nationale Identität Kanadas in der Arbeit?
Die Arbeit untersucht, wie die Identität Kanadas als multikulturelle Nation maßgeblich von der indigenen Tradition und der Auseinandersetzung mit der kolonialen Vergangenheit geprägt ist.
- Quote paper
- Martin Wicke (Author), 2002, Weiße und indigene Kultur in ausgewählten kanadischen Romanen: John Richardsons "Wacousta", Rudy Wiebes "The Temptations of Big Bear" und W.O. Mitchells "The Vanishing Point", Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/67954