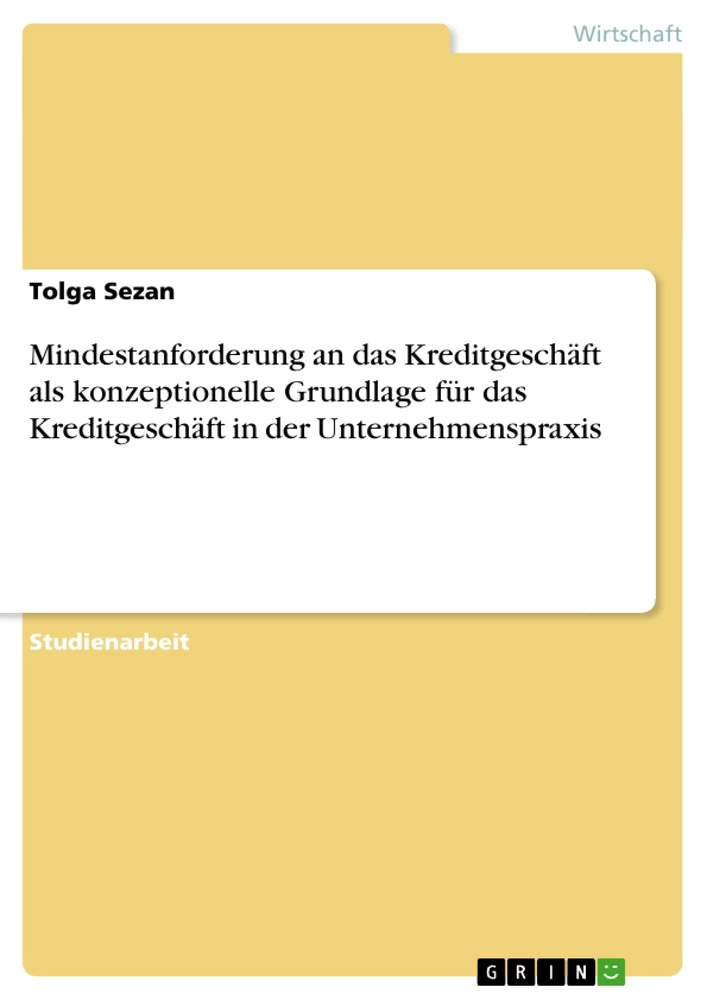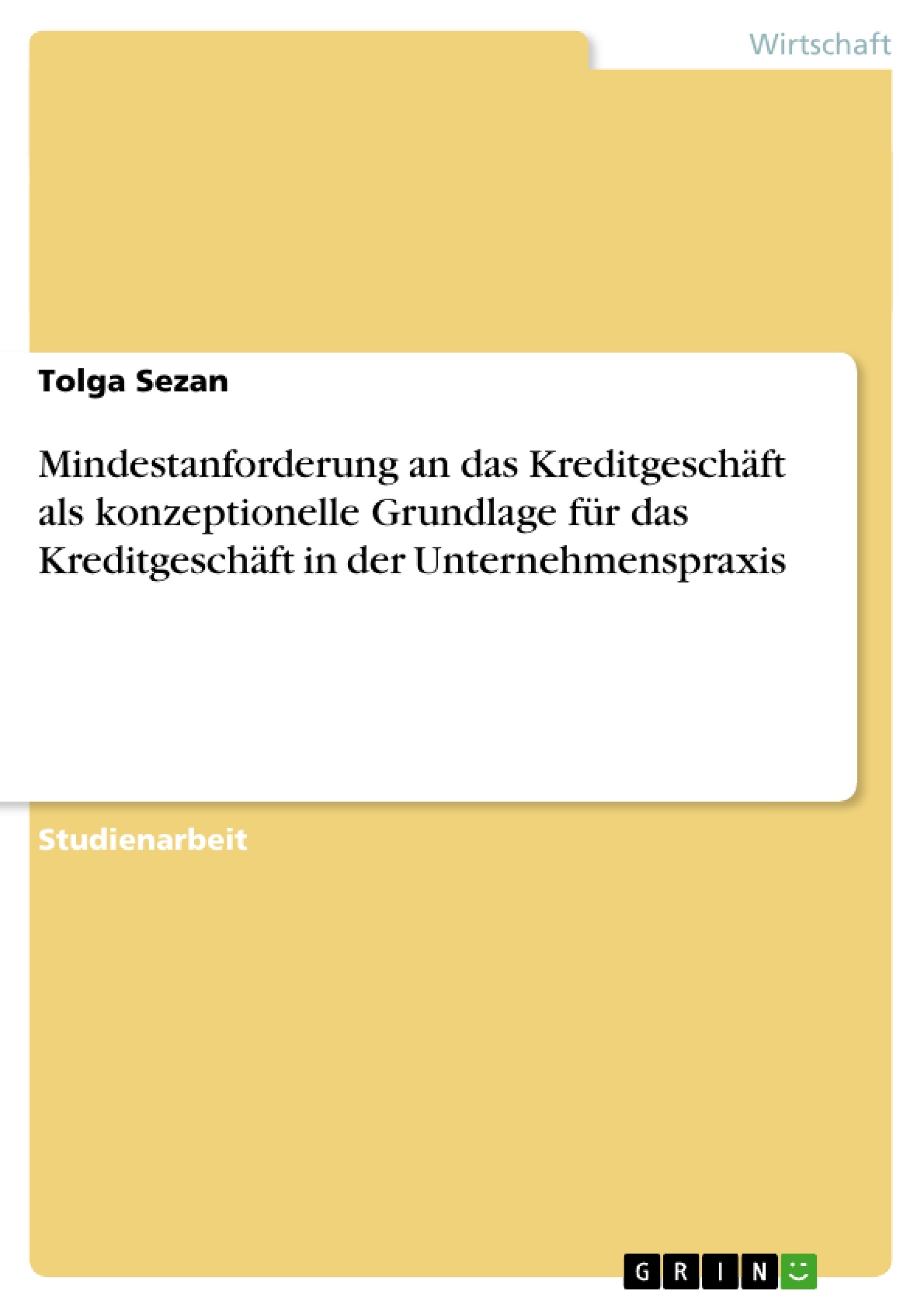A. Einleitung
Die Diskussion über Kreditrisikomanagement begann bereits vor 20 Jahren, als die renommierten Bankhäuser wie Herrstatt, Schröder, Münchmeyer und Hengst & Co. Insolvenz angemeldet hatten. Der Zusammenbruch dieser Banken war vor allem ein Mangel an Organisation und eine zu späte Erkenntnis der Risiken. Viele dieser Bankhäuser hätten den Satz des einstigen Philosophen Aristoteles beherzigen sollen: „Es ist wahrscheinlich, dass etwas Unwahrscheinliches passiert“. In vielen Fällen entstehen aber auch Zusatzkosten, die von Dritten, wie z.B. den Einlagensicherungssystemen, getragen werden müssen. Zu den Insolvenzen der oben genannten Banken zählten auch die Schmidt Bank, Gontard & Metallbank und die Bankgesellschaft Berlin. Da die Banken als Finanzintermediär eine große Rolle für eine stabile Volkswirtschaft spielen, können solche Schieflagen zu einer nachhaltigen Störung des gesamten Finanzsystems führen, wenn derartige Probleme häufiger auftreten. Nach solchen Vorfällen musste die Bankenaufsicht natürlich eingreifen. Da das primäre Interesse der Bank das Überleben seines eigenen Geschäftsbereiches ist, kam dies den Kreditinstituten zu Gute. Dies bedeutet, dass die Ziele der Bankenaufsicht und der Banken identisch sind. Die Entwicklung der MaK begann im Februar 2002, als zum ersten Mal ein Konsultationspapier erstellt wurde. Nachdem der Zentrale Kreditausschuss im Mai 2002 Stellung dazu nahm, wurde Ende September 2002 das zweite Konsultationspapier veröffentlicht. Letztendlich sind die MaK am 20.12.2002 in Kraft getreten, allerdings mit Übergangsfristen (30.06.2004 für Anforderungen, die keine IT-Umsetzung erfordern sowie 31.12.2005 für solche, die eine IT-Umsetzung erfordern). Dieses Rundschreiben von der BaFin über die MaK orientiert sich an § 25a Abs. 1 KWG, nach dem bei den Kreditinstituten geeignete Regelungen zur Steuerung, Überwachung und Kontrolle der Risiken, eine ordnungsgemäße Geschäftsorganisation sowie angemessene interne Kontrollverfahren einzurichten sind . Im Allgemeinen soll die MaK die Banken transparenter und risikobewusster machen. Im Folgenden wird das Rundschreiben erläutert und am Ende folgt ein Beispiel aus der Praxis, wie die Anforderungen umgesetzt werden können.
Inhaltsverzeichnis
- A. Einleitung
- B. Mindestanforderungen an das Kreditgeschäft der Kreditinstitute
- B.1 Anwendungsbereich
- B.2 Allgemeine Anforderungen
- B.2.1 Verantwortung der Geschäftsleitung
- B.2.2 Kreditrisikostrategie
- B.2.3 Organisationsrichtlinien
- B.2.4 Qualifikation der Mitarbeiter
- B.2.5 Kreditgeschäfte in neuartigen Produkten oder auf neuen Produkten
- B.2.6 Anforderung an die Dokumentation
- B.3 Organisation des Kreditgeschäfts
- B.3.1 Funktionstrennung
- B.3.2 Votierung
- B.3.3 Anforderungen an die Prozesse
- B.3.3.1 Kreditgewährung
- B.3.3.2 Kreditweiterbearbeitung
- B.3.3.3 Kreditbearbeitungskontrolle
- B.3.3.4 Intensivbetreuung
- B.3.3.5 Behandlung von Problemkrediten
- B.3.3.6 Risikovorsorge
- B.4 Risikoklassifizierungsverfahren
- B.5 Identifizierung, Steuerung und Überwachung der Risiken im Kreditgeschäft
- B.5.1 Allgemeine Anforderungen an die Verfahren
- B.5.2 Verfahren zur Früherkennung von Risiken
- B.5.3 Begrenzung der Risiken im Kreditgeschäft
- B.5.4 Berichtwesen
- B.5.5 Rechts- und Betriebsrisiken
- B.6 Auslagerung
- B.7 Prüfungen
- B.7.1 Revisionen
- B.7.1 Abschlussprüfer
- C. Der Stellenwert der MaK im Nichtbankensektor
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Die Arbeit befasst sich mit den Mindestanforderungen an das Kreditgeschäft von Kreditinstituten, auch bekannt als MaK. Das Ziel ist, die konzeptionelle Grundlage für das Kreditcontrolling in der Unternehmenspraxis zu liefern. Hierbei werden die wichtigsten Anforderungen an das Kreditgeschäft im Detail erläutert, um eine effiziente Steuerung und Kontrolle des Kreditrisikos zu gewährleisten.
- Verantwortung der Geschäftsleitung
- Organisation des Kreditgeschäfts
- Risikoklassifizierungsverfahren
- Identifizierung und Steuerung von Kreditrisiken
- Prüfungen und Revisionen
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung beleuchtet den historischen Kontext der MaK und die Notwendigkeit für ihre Einführung, insbesondere im Hinblick auf die Insolvenzen von renommierten Bankhäusern. Kapitel B befasst sich ausführlich mit den Mindestanforderungen an das Kreditgeschäft der Kreditinstitute. Hier werden Themen wie die Verantwortung der Geschäftsleitung, die Kreditrisikostrategie, die Organisation des Kreditgeschäfts, die Risikoklassifizierung und die Kontrolle der Risiken im Kreditgeschäft detailliert behandelt. Kapitel C diskutiert den Stellenwert der MaK im Nichtbankensektor.
Schlüsselwörter
Die Arbeit befasst sich mit dem Kreditrisikomanagement, den Mindestanforderungen an das Kreditgeschäft (MaK), der Kreditrisikostrategie, der Organisation des Kreditgeschäfts, der Risikoklassifizierung, der Kontrolle von Kreditrisiken und der Rolle der Bankenaufsicht im Kreditgeschäft.
Häufig gestellte Fragen
Was sind die Mindestanforderungen an das Kreditgeschäft (MaK)?
Die MaK sind von der BaFin festgelegte Richtlinien zur Steuerung, Überwachung und Kontrolle von Risiken im Kreditgeschäft der Banken.
Warum wurden die MaK eingeführt?
Anlass waren große Bankeninsolvenzen (z. B. Herstatt, Schmidt Bank), die durch mangelhafte Organisation und zu späte Risikoerkennung verursacht wurden.
Welche Rolle spielt die Funktionstrennung im Kreditgeschäft?
Um Interessenkonflikte zu vermeiden, müssen Marktbereich und Marktfolge (Risikokontrolle) organisatorisch bis in die Geschäftsleitungsebene getrennt sein.
Was bedeutet „Votierung“ im Kreditprozess?
Votierung bedeutet, dass bei Kreditentscheidungen zwei unabhängige Stimmen (Voten) – eine vom Markt und eine von der Marktfolge – vorliegen müssen.
Haben die MaK auch eine Bedeutung für Nichtbanken?
Ja, die Grundsätze dienen oft als konzeptionelle Basis für das Kreditcontrolling und Risikomanagement in der allgemeinen Unternehmenspraxis.
- Citation du texte
- Tolga Sezan (Auteur), 2006, Mindestanforderung an das Kreditgeschäft als konzeptionelle Grundlage für das Kreditgeschäft in der Unternehmenspraxis, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/68101