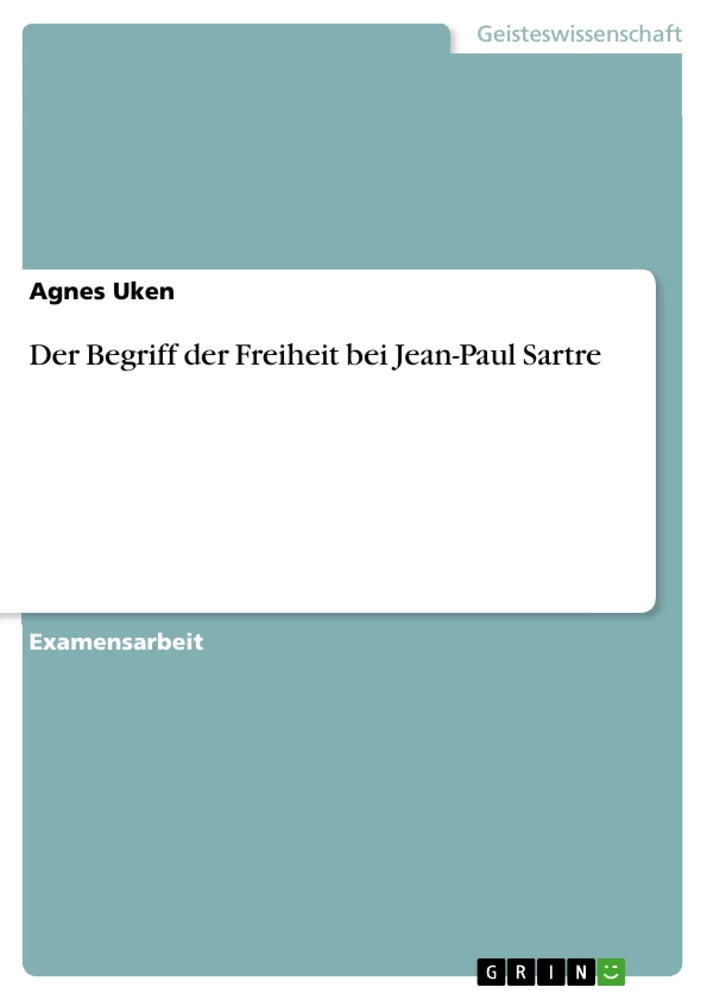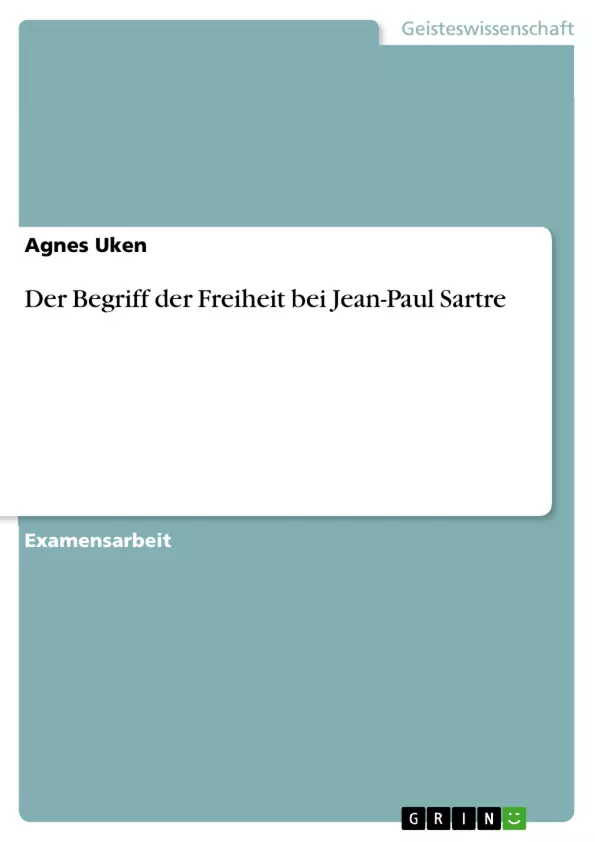Sartres Leben und Werk sind vor allem durch sein immer währendes Engagement für die Freiheit geprägt. Ob als Philosoph, Staatsbürger, Dramaturg oder Schriftsteller stets galt das Hauptinteresse Sartres dem Thema der Freiheit.
Da der Mensch die Erfahrung der Freiheit macht, d.h. sich als selbstbestimmt handelnd und denkend versteht, erhebt sich die Frage einer philosophischen Begründung der Freiheit. Sartre fasst die Freiheit nun aber nicht wie zum Teil in der Tradition vor ihm als eine Eigenschaft des Menschen auf, sondern als eine Grundbestimmung des menschlichen Seins, die von seiner Existenz nicht zu trennen ist.
Zunächst versteht Sartre wie auch Kant Freiheit als Freiheit von Kausalität. Eine freie Tat ist als eine absolut neue Schöpfung zu verstehen, deren Keim nicht in einem früheren Zustand der Welt enthalten ist, denn dann wäre sie ja nicht frei, sondern kausal bestimmt. Infolgedessen sind Freiheit und Schöpfung eins. Während Kant die Frage der Vereinbarkeit von Naturkausalität und Freiheit löst, indem er eine Trennung von Ding-an-sich und Erscheinung vornimmt, versucht Sartre ohne eine solche Trennung auszukommen, indem er Freiheit vor aller Bestimmung im Sein des Menschen verankert.
Die vorliegende Arbeit zeichnet diese ontologische Begründung der Freiheit nach, stellt die zentrale Bedeutung der Intentionalität und Negativität heraus und zeigt, inwiefern dem Bewusstsein eine Schlüsselstelle in der Sartreschen Philosophie zukommt.
Ausgangspunkt ist die Auseinandersetzung Sartres mit der Phänomenologie Husserls auf deren Basis Sartre seine eigene Philosophie weiterentwickelt und schließlich zur phänomenologischen Ontologie gelangt, wie sie sich in "Das Sein und das Nichts" findet.
Verdeutlicht werden der besondere Stellenwert des präreflexiven Bewusstsein und die sich daraus ergebenden weit reichenden Konsequenzen für den ontologischen Freiheitsbegriff Sartres, sowie die darauf aufbauende Grundunterscheidung des Seienden in ein solides nicht bewusstes An-sich und in ein Negation schaffendes bewusstes Für-sich.
Schließlich wird das Handeln des Menschen im Zusammenhang von Freiheit und Faktizität betrachtet. Dabei zeigt sich, dass dem Faktum der Existenz des Anderen eine besondere Bedeutung unter dem Gegebenen zukommt.
Die Frage nach dem Anderen leitet über zur Frage nach der Vereinbarkeit von Moralphilosophie und Ontologie. Abschließend wird ein Ausblick über die moralphilosophische Entwicklung Sartres gegeben.
Inhaltsverzeichnis
- 0. EINLEITUNG
- 1. AUSEINANDERSETZUNG MIT DER PHÄNOMENOLOGIE HUSSERLS
- 1.1 Intentionalität
- 1.2 Die Epoché
- 1.3 Das Ego als Objekt des Bewusstseins
- 1.4 Die Struktur des Bewusstseins
- 1.5 Bewusstsein als Schlüsselbegriff
- 1.6 Phänomenologische Ontologie
- 2. DAS SEIN UND DER URSPRUNG DES NICHTS
- 2.1 Das Sein des An-sich
- 2.2 Das Sein des Für-sich
- 2.3 Das Nichts
- 2.4 Das präreflexive Bewusstsein
- 2.5 Verbindung der beiden Seinsformen
- 3. SEIN UND HANDELN
- 3.1 Freiheit und Handlung
- 3.2 Existenzialismus versus Determinismus
- 3.3 Bedeutung des präreflexiven Bewusstseins für die Freiheit
- 3.4 Freiheit und Wille
- 3.5 Antrieb und Motiv
- 3.6 Entwurf oder In-der-Welt-sein
- 4. DIE,,RÜCKSEITE“ DER FREIHEIT
- 4.1 Freiheit und Faktizität
- 4.2 Freiheit in Situation
- 4.3 Die Existenz des Anderen
- 4.4 Der Blick und das Phänomen der Scham
- 4.5 Das Für-Andere-Sein als Grenze meiner Freiheit
- 4.6 Realisierung der internen Negation in Freiheit
- 4.7 Kampf um die Freiheit - Konflikt als ursprünglicher Sinn des Für-Andere-Seins
- 4.8 Der Dualismus von Objekt- und Subjekt-Anderem
- 5. ETHIK UND ONTOLOGIE
- 5.1 Unbestimmtheit der Freiheit
- 5.2 Für-sich als Mangel an Sein
- 5.3 Das Sein des Wertes
- 5.4 Ontologie und Ethik - ein Widerspruch?
- 5.5 Moral der Freiheit - Freiheit als Wert
- 5.6 Die Freiheit des Anderen
- 5.7 Die moralphilosophische Entwicklung Sartres
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Examensarbeit befasst sich mit dem Begriff der Freiheit bei Jean-Paul Sartre. Sie zeichnet die ontologische Begründung der Freiheit nach und stellt die zentrale Bedeutung der Intentionalität und Negativität heraus. Die Arbeit untersucht die Schlüsselrolle des Bewusstseins in Sartres Philosophie und analysiert die Auswirkungen der Freiheit auf das menschliche Handeln und die Beziehung zum Anderen.
- Die ontologische Begründung der Freiheit bei Sartre
- Die Bedeutung von Intentionalität und Negativität für die Freiheit
- Die Rolle des Bewusstseins in Sartres Philosophie
- Die Auswirkungen der Freiheit auf das menschliche Handeln
- Die Beziehung zum Anderen im Kontext der Freiheit
Zusammenfassung der Kapitel
Die Einleitung stellt das Thema der Arbeit, die ontologische Begründung der Freiheit bei Sartre, vor und führt in das Konzept der Freiheit als Grundbestimmung des menschlichen Seins ein. Kapitel 1 behandelt die Auseinandersetzung Sartres mit der Phänomenologie Husserls, wobei die zentralen Konzepte der Intentionalität, der Epoché und die Struktur des Bewusstseins erläutert werden. Kapitel 2 widmet sich dem Sein und dem Ursprung des Nichts, wobei die beiden Seinsformen "An-sich" und "Für-sich" sowie die Bedeutung des Nichts für das menschliche Bewusstsein beleuchtet werden. Kapitel 3 setzt sich mit der Beziehung zwischen Sein und Handeln auseinander, insbesondere mit der Freiheit des Menschen und den Herausforderungen des Determinismus. Die "Rückseite" der Freiheit wird in Kapitel 4 untersucht, wobei die Grenzen der Freiheit durch die Faktizität, die Situation und die Existenz des Anderen erörtert werden. Kapitel 5 schließlich behandelt die Verbindung zwischen Ethik und Ontologie im Rahmen der Sartreschen Philosophie.
Schlüsselwörter
Freiheit, Ontologie, Phänomenologie, Intentionalität, Negativität, Bewusstsein, Handeln, Existenzialismus, Determinismus, Faktizität, Situation, Anderer, Ethik.
- Quote paper
- Agnes Uken (Author), 2003, Der Begriff der Freiheit bei Jean-Paul Sartre, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/68265