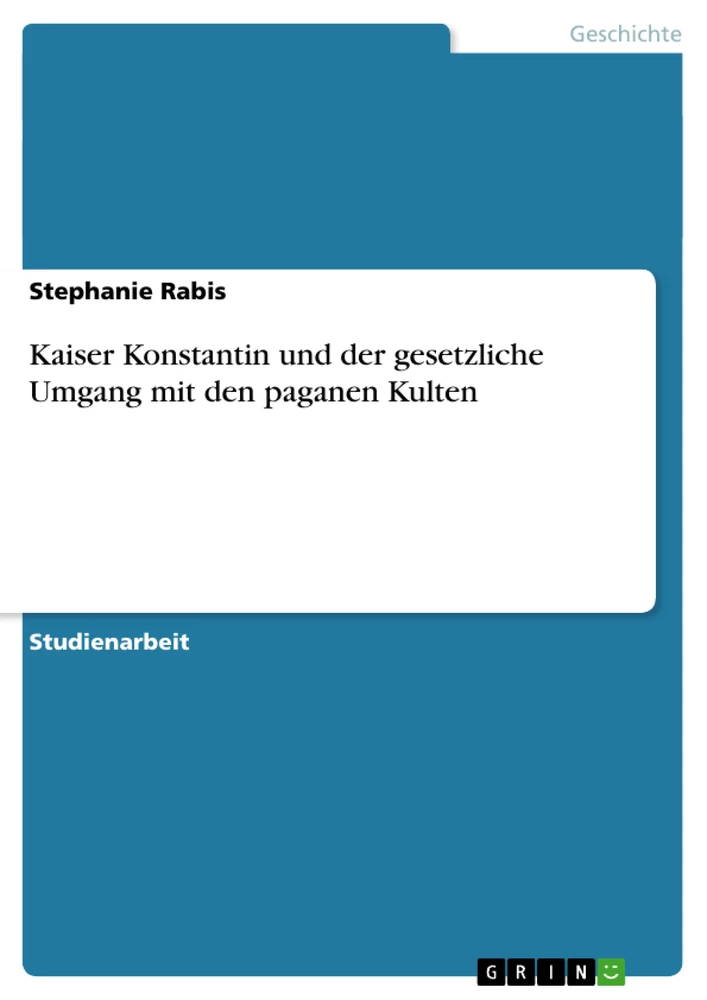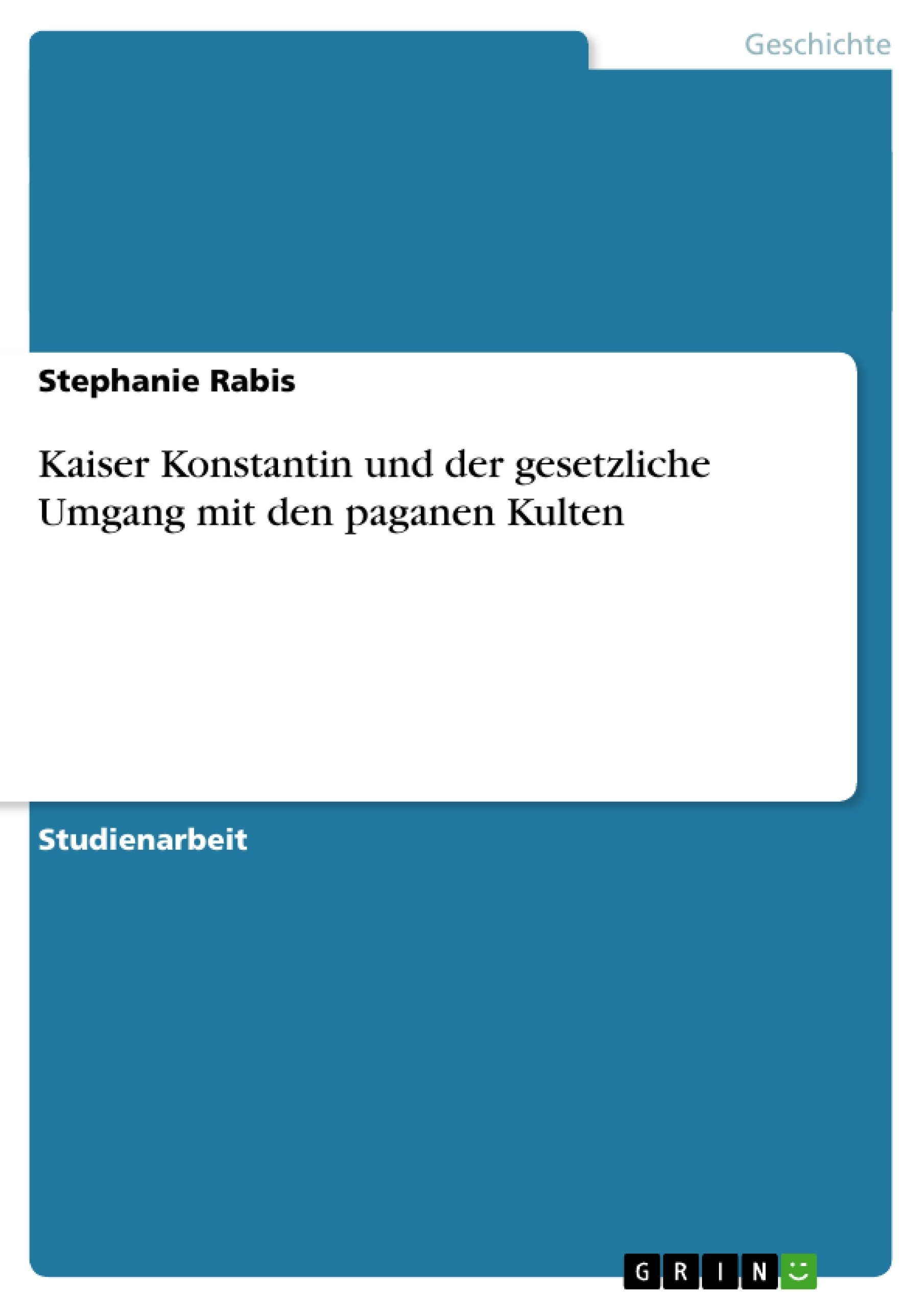Kaiser Konstantin der Große ging in die Geschichte ein als der Mann, der die Christenverfolgung abschaffte. Unter seinen Vorgängern und auch noch während der Tetrarchie, vor allem unter Diokletian, wurden Christen noch im gesamten Römischen Reich aufgrund ihres Glaubens verfolgt. Konstantin aber konnte sich mit dem christlichen Glauben identifizieren und verfasste 313 gemeinsam mit Licinius das Mailänder Edikt, das den Christen die Gleichstellung mit den Nichtchristen garantierte. Darin wurde das Christentum für legal erklärt und den Christen wurden ihre Besitztümer unmittelbar zurückgegeben.
Nach seinem Sieg über Licinius, den er auf göttliches Wirken zurückführte, forcierte er den christlichen Glauben immer mehr. Er war bei vielen christlichen Versammlungen anwesend und führte oftmals auch den Vorsitz, was zeigt, dass die Trennung zwischen Staat und Kirche nicht immer unternommen wurde. Auf dem Totenbett ließ er sich letztlich sogar noch taufen, um ohne Sünde in den Himmel aufsteigen zu können.
Doch wie ging er unterdessen mit den traditionellen römischen Religionen um? Versuchte er sie zurückzudrängen oder gar zu verbieten? Sollte die christliche Religion zur neuen Staatsreligion werden? Und wie reagierte die Bevölkerung darauf? Was bedeutete es für sie?
Diese und ähnliche Fragen sollen in der vorliegenden Hausarbeit geklärt werden. Dazu werden zuerst die paganen Kulte kurz vorgestellt, um zu zeigen, wie die Religion im Römischen Reich vor dem Christentum gesehen wurde. Dann werden einige Gesetze, die Konstantin erlassen haben soll, interpretiert und es wird die aktuelle Forschungsdebatte zu einigen unklaren Fragen dargestellt. Anschließend wird gezeigt, inwieweit die Gesetze auch wirklich umgesetzt wurden. Zum Schluss folgt noch eine knappe Zusammenfassung mit den wichtigsten Ergebnissen.
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einleitung
- I. Die paganen Kulte
- I. 1. Die Entwicklung der römischen Religion
- I. 2. Der Kaiserkult
- I. 3. Die Mysterienreligionen
- II. Gesetze gegen die paganen Kulte
- II. 1. Das Mailänder Edikt
- II. 2. Das Verbot der Haruspizien
- II. 3. Das Opferverbot
- II. 4. Konstantins Weigerung zu opfern
- II. 5. Die Zerstörung der Tempel
- II. 7. Die Umsetzung der Gesetze
- III. Zusammenfassung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit untersucht Kaiser Konstantins Umgang mit den paganen Kulten im Römischen Reich. Sie beleuchtet die religiöse Landschaft vor dem Aufstieg des Christentums und analysiert die von Konstantin erlassenen Gesetze, die die traditionellen römischen Religionen betrafen. Ziel ist es, die Motive und Auswirkungen dieser Politik zu verstehen und die Debatte um die tatsächliche Umsetzung der Gesetze zu beleuchten.
- Entwicklung der römischen Religion vor dem Christentum
- Konstantinische Gesetze gegen die paganen Kulte
- Der Kaiserkult und seine Bedeutung
- Auswirkungen der Gesetzgebung auf die Bevölkerung
- Umsetzung der Gesetze und deren Wirksamkeit
Zusammenfassung der Kapitel
0. Einleitung: Die Einleitung stellt die zentrale Forschungsfrage nach Konstantins Umgang mit den paganen Kulten im Römischen Reich. Sie skizziert Konstantins Rolle bei der Anerkennung des Christentums und hebt den Gegensatz zu den traditionellen römischen Religionen hervor. Die Arbeit kündigt eine Analyse der paganen Kulte, der von Konstantin erlassenen Gesetze und deren Umsetzung an, um ein umfassendes Bild der religiösen Politik Konstantins zu zeichnen. Die Einleitung legt den Fokus auf die Notwendigkeit, die Motive und Folgen von Konstantins Maßnahmen im Kontext der römischen Gesellschaft zu verstehen.
I. Die paganen Kulte: Dieses Kapitel bietet eine Übersicht über die religiöse Landschaft des römischen Reiches vor der Verbreitung des Christentums. Es beschreibt die Entwicklung der römischen Religion von einer frühen, unspezifischen Vorstellung des Göttlichen hin zu einer anthropomorphen Religion unter griechischem und etruskischem Einfluss. Der Fokus liegt auf der Opferreligion der Römer, ihrer Abwesenheit einer schriftlich fixierten Lehre, und der untrennbaren Verbindung von Religion und Politik. Der Abschnitt über den Kaiserkult beleuchtet dessen Bedeutung für den Zusammenhalt des Reiches und die Ambivalenz der Motivationen dahinter. Die Mysterienreligionen werden als Alternative zu den traditionellen Kulten und als Ausdruck der persönlichen Suche nach Erlösung dargestellt. Das Kapitel stellt den religiösen Kontext dar, in dem Konstantins Politik sich entfaltete.
Schlüsselwörter
Kaiser Konstantin, pagane Kulte, Römisches Reich, Mailänder Edikt, Kaiserkult, Mysterienreligionen, Religionspolitik, Gesetzgebung, Christentum, Opferreligion, Umsetzung von Gesetzen.
Häufig gestellte Fragen zu "Kaiser Konstantins Umgang mit den paganen Kulten"
Was ist der Gegenstand dieser Arbeit?
Diese Arbeit untersucht Kaiser Konstantins Politik gegenüber den paganen Kulten im Römischen Reich. Sie analysiert die religiöse Situation vor dem Aufstieg des Christentums und die von Konstantin erlassenen Gesetze, die die traditionellen römischen Religionen betrafen. Im Fokus stehen die Motive und Auswirkungen dieser Politik sowie die Debatte um die tatsächliche Umsetzung der Gesetze.
Welche Themen werden behandelt?
Die Arbeit behandelt die Entwicklung der römischen Religion vor dem Christentum, die konstantinischen Gesetze gegen die paganen Kulte, den Kaiserkult und seine Bedeutung, die Auswirkungen der Gesetzgebung auf die Bevölkerung und die Umsetzung der Gesetze und deren Wirksamkeit. Es werden die paganen Kulte selbst, darunter der Kaiserkult und die Mysterienreligionen, detailliert beschrieben.
Welche Kapitel umfasst die Arbeit?
Die Arbeit gliedert sich in drei Kapitel: Kapitel I behandelt die paganen Kulte, inklusive ihrer Entwicklung, des Kaiserkults und der Mysterienreligionen. Kapitel II konzentriert sich auf die Gesetze gegen die paganen Kulte, wie das Mailänder Edikt, das Verbot der Haruspizien und das Opferverbot, sowie Konstantins Weigerung zu opfern und die Zerstörung der Tempel. Kapitel III bietet eine zusammenfassende Darstellung der Ergebnisse.
Was ist das Ziel der Arbeit?
Das Ziel der Arbeit ist es, Konstantins Motive und die Auswirkungen seiner Politik gegenüber den paganen Kulten zu verstehen. Es soll ein umfassendes Bild seiner religiösen Politik gezeichnet und die Frage nach der effektiven Umsetzung der erlassenen Gesetze beleuchtet werden.
Welche Schlüsselwörter beschreiben die Arbeit?
Schlüsselwörter sind: Kaiser Konstantin, pagane Kulte, Römisches Reich, Mailänder Edikt, Kaiserkult, Mysterienreligionen, Religionspolitik, Gesetzgebung, Christentum, Opferreligion, Umsetzung von Gesetzen.
Wie wird die Einleitung gestaltet?
Die Einleitung formuliert die zentrale Forschungsfrage nach Konstantins Umgang mit den paganen Kulten und skizziert Konstantins Rolle bei der Anerkennung des Christentums im Gegensatz zu den traditionellen römischen Religionen. Sie kündigt die Analyse der paganen Kulte, der Gesetze und deren Umsetzung an, um ein umfassendes Bild von Konstantins religiöser Politik zu zeichnen. Der Fokus liegt auf dem Verständnis der Motive und Folgen seiner Maßnahmen im Kontext der römischen Gesellschaft.
Wie wird das Kapitel über die paganen Kulte beschrieben?
Das Kapitel über die paganen Kulte bietet einen Überblick über die religiöse Landschaft des römischen Reiches vor dem Christentum. Es beschreibt die Entwicklung der römischen Religion, die Opferreligion, die fehlende schriftlich fixierte Lehre, und die enge Verbindung von Religion und Politik. Es beleuchtet den Kaiserkult und seine Bedeutung für den Zusammenhalt des Reiches sowie die Mysterienreligionen als Alternative zu den traditionellen Kulten.
- Citation du texte
- Stephanie Rabis (Auteur), 2004, Kaiser Konstantin und der gesetzliche Umgang mit den paganen Kulten, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/68348