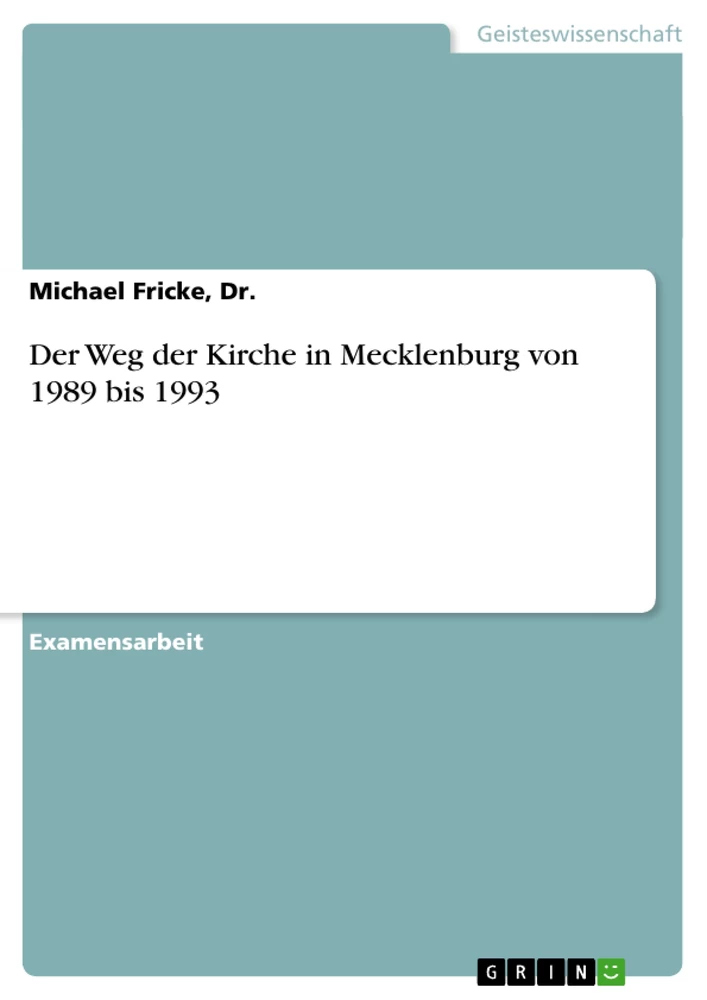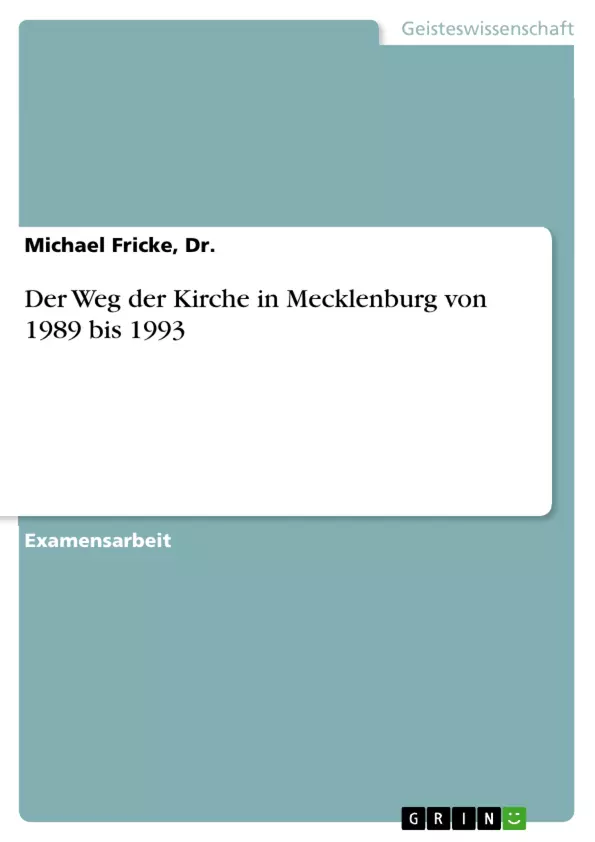„Kirche, die bereit ist, den ihr aufgetragenen Ort anzunehmen, hat die Verheißung, mit der
ihr aufgetragenen Botschaft und ihrer Lebensart ´Salz der Erde‘ zu sein.“
Die Landeskirche hat in den vergangenen vier Jahren einen weiten Weg zurückgelegt. Durch
die politischen, gesellschaftlichen und wirtschaftlichen Umwälzungen der Wende und der
Wiedervereinigung hat sie eine neue Rolle in der pluralistischen Gesellschaft übernehmen
müssen. Dabei stand sie oft unter hohem zeitlichem und inhaltlichem Anpassungsdruck und
hatte kaum Spielraum, zuerst eine grundsätzliche, theologische Stand ortbestimmung zu unternehmen
und dann daraus Konsequenzen für ihre Gestalt und Struktur zu ziehen.
Die Landeskirche hat sich sowohl aus pragmatischen als auch aus inhaltlichen Gründen weitgehend
dafür entschieden, den Weg der westdeutschen Landeskirchen mitzugehen. Sie hat
deren Modell von „Volkskirche“ übernommen. Da sie die flächendeckende, personalintens ive
geistliche Versorgung der Bevölkerung nach dem Parochialprinzip beibehalten und gleichzeitig
vielfältige neue Aufgabenfelder (Diakonie, Religionsunterricht, Seelsorge an speziellen
Gruppen) übernehmen wollte, mußte sie sich auch für das entsprechend effektive Finanzierungsmodell
entscheiden. Dazu gehörte die Einführung des neuen Kirchensteuerabzugsverfahrens
(s.u. Kapitel 1) und der Abschluß des Staat-Kirchen-Vertrages (u.a. Finanzierung
zweier theologischer Fakultäten, jährlicher Zuschuß zu Pfarrerbesoldung von 13 Mio. DM
für Mecklenburg-Vorpommern). Die Kirche hat sich damit aus der Marginalisierung herausgelöst
und ist eine gesellschaftlich relevante Gruppe geworden.
In Spannung dazu steht, daß der zu DDR-Zeiten begonnene Prozeß der Minorisierung weiter
fortschreitet: Die Kirche ist zwar nun wieder mit allen rechtlichen und finanziellen Möglichkeiten
ausgestattet, die sie sich wünschen kann, aber sie steht vor dem Problem, daß immer
weniger Menschen sich zu ihr halten. Weniger als 300.000 Glieder zählt die Landeskirche bei
sinkender Tendenz. Immer öfter taucht die Frage auf, ob die Kirche, die Strukturen, die sie
sich gegeben hat, überhaupt mit Menschen füllen kann und ob es noch sinnvoll ist, von Volkskirche
im Sinne einer Kirche zu sprechen, die die „umfassende Durchchristlichung des Volkes“
oder flächendeckende „pfarramtliche Versorgung“ verfolgt. ´[...]
Inhaltsverzeichnis
- 0. Einführung
- Ziel und Aufbau der Arbeit
- 1. Kirchensteuerabzug
- 1.1. Synodaltagung vom 15.-17.3.90
- 1.2. Nach der Synodaltagung
- 1.3. Die Synodaltagung vom 1.-4.11.90
- 1.4. Weiterer Verlauf
- 1.5. Thesen über die ekklesiologische Relevanz des Kirchensteuerabzugsverfahrens
- 2. Kirche und Vergangenheit - die Aufarbeitung der Stasi-Belastung
- 2.1. Synodaltagung vom 15.-17.3.1990
- 2.2. Synodaltagung vom 1.- 4.11.1990
- 2.3. Synodaltagung vom 13.-17.3.1991
- 2.4. Sondersynode vom 22.6.1991
- 2.5. Weiterer Verlauf bis zur Synodaltagung vom 17.-20.3.1994
- 2.6. Thesen zur ekklesiologischen Bedeutung der innerkirchlichen Aufarbeitung der Stasi-Vergangenheit
- 3. Kirche im Einheitsprozeß - der Abschied vom Bund, die Vereinigung mit der EKD und der Beitritt zur VELKD
- 3.1. Von der „Loccumer Erklärung“ bis zur Synode vom 15.-17.3.1990
- 3.2. Synodaltagung vom 1.-4.11.1990
- 3.3. Die „,dramatischen“ Synodaltagungen im März und November 1991
- 3.4. Die Synodaltagung vom 12.-15.3.1993
- 3.5. Thesen zur ekklesiologischen Bedeutung der Vereinigung mit der EKD und des Beitritts zur VELKD
- 4. Kirche und die Diskussion um Frieden, Krieg und „Seelsorge an Soldaten“
- 4.1. Vorgeschichte
- 4.2. Die Synoden im Jahr 1990
- 4.3. Die weitere Entwicklung von 1991 bis 1993
- 4.4. Thesen zur ekklesiologischen Bedeutung dieser Entwicklung
- 5. Kirche und geistliches Leben in der Gemeinde - Gemeindeaufbau
- 5.1. Vor dem „,Herbst '89“
- 5.2. Nach dem „Herbst '89“
- 5.3. Thesen zur ekklesiologischen Relevanz dieser Entwicklung
Zielsetzung und Themenschwerpunkte
Diese Arbeit befasst sich mit dem Weg der Kirche in Mecklenburg zwischen 1989 und 1993. Sie analysiert die ekklesiologische Relevanz der Verlautbarungen von Kirchenleitung, Bischof und Synode in dieser Zeit.
- Die Einführung eines neuen Kirchensteuerabzugsverfahrens und die Aufnahme des Modells der "Volkskirche" als Reaktion auf die gesellschaftlichen und politischen Veränderungen nach der Wende
- Die Aufarbeitung der Stasi-Vergangenheit in der Kirche und ihre Auswirkungen auf die ekklesiologische Identität
- Die Vereinigung mit der EKD, der Beitritt zur VELKD und der Abschied von der „Weg- und Arbeitsgemeinschaft des Bundes“
- Die Debatte um Frieden, Krieg und „Seelsorge an Soldaten“ im Kontext der neuen politischen Realität
- Die Entwicklung des Gemeindeaufbaus und des geistlichen Lebens in der Kirche nach dem „Herbst '89“
Zusammenfassung der Kapitel
Das erste Kapitel beschäftigt sich mit der Einführung des neuen Kirchensteuerabzugsverfahrens und der damit verbundenen Folgen für die Kirche. Es beleuchtet die Synodaltagungen und die Entscheidungen, die zur Adaption des Modells der "Volkskirche" führten.
Das zweite Kapitel befasst sich mit der Aufarbeitung der Stasi-Vergangenheit in der Kirche. Es analysiert die Synodaltagungen, die sich mit diesem Thema auseinandersetzten, und untersucht die ekklesiologischen Implikationen der Debatten um die Vergangenheit.
Das dritte Kapitel behandelt den Prozess der Vereinigung mit der EKD und den Beitritt zur VELKD. Es betrachtet die Bedeutung des Abschieds vom Bund und analysiert die Synodaltagungen, die sich mit diesem Wandel befassten.
Das vierte Kapitel untersucht die Debatte um Frieden, Krieg und "Seelsorge an Soldaten" im Kontext der neuen politischen Situation nach der Wende. Es beleuchtet die Vorgeschichte, die Synodaltagungen und die weitere Entwicklung der Diskussion um diese Thematik.
Das fünfte Kapitel befasst sich mit dem Gemeindeaufbau und dem geistlichen Leben in der Kirche nach dem "Herbst '89". Es analysiert die Veränderungen, die in diesem Bereich stattfanden, und untersucht die ekklesiologische Relevanz dieser Entwicklungen.
Schlüsselwörter
Die Arbeit beschäftigt sich mit zentralen Themen der Kirchengeschichte in Mecklenburg, insbesondere der ekklesiologischen Relevanz von Synodaltagungen, Verlautbarungen von Kirchenleitung und Bischof, der Aufarbeitung der Stasi-Vergangenheit, der "Volkskirche" und dem Gemeindeaufbau im Kontext der politischen und gesellschaftlichen Veränderungen nach der Wende 1989.
Häufig gestellte Fragen
Wie veränderte sich die Rolle der Mecklenburger Landeskirche nach 1989?
Die Kirche musste in einer pluralistischen Gesellschaft eine neue Rolle finden und entschied sich weitgehend für das westdeutsche Modell der „Volkskirche“, um gesellschaftlich relevant zu bleiben.
Was war die Bedeutung des Kirchensteuerabzugsverfahrens?
Die Einführung des Kirchensteuerabzugs war Teil eines Finanzierungsmodells, das die flächendeckende geistliche Versorgung und neue Aufgabenfelder wie Diakonie und Religionsunterricht ermöglichen sollte.
Wie ging die Kirche mit ihrer Stasi-Vergangenheit um?
Die Aufarbeitung der Stasi-Belastung war ein zentrales Thema mehrerer Synodaltagungen zwischen 1990 und 1994, um die ekklesiologische Identität der Kirche zu klären.
Was bedeutete die Vereinigung mit der EKD für die Landeskirche?
Es markierte den Abschied von der „Weg- und Arbeitsgemeinschaft des Bundes“ der DDR-Kirchen und den Beitritt zur Evangelischen Kirche in Deutschland (EKD) sowie zur VELKD.
Welches Problem verbindet man mit dem Begriff „Minorisierung“?
Trotz neuer rechtlicher und finanzieller Möglichkeiten sank die Zahl der Kirchenmitglieder stetig, was die Frage aufwarf, ob das Modell der flächendeckenden Volkskirche noch tragfähig ist.
Welche Rolle spielte die Seelsorge an Soldaten in der Nachwendezeit?
In der neuen politischen Realität wurde intensiv über Frieden, Krieg und die kirchliche Begleitung von Soldaten debattiert, was zu neuen ekklesiologischen Standpunkten führte.
- Citation du texte
- Michael Fricke, Dr. (Auteur), 1994, Der Weg der Kirche in Mecklenburg von 1989 bis 1993, Munich, GRIN Verlag, https://www.grin.com/document/6834